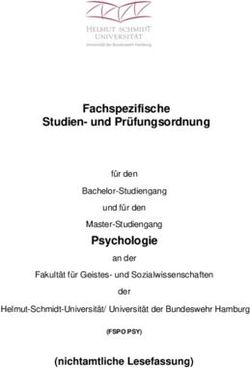Infoveranstaltung zum EWS-Examen Allgemeine Pädagogik - Psychologie - Schulpädagogik - Professional School of Education
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Infoveranstaltung
zum
EWS-Examen
Allgemeine Pädagogik – Psychologie –
Schulpädagogik –
Professional School of EducationÜbersicht • Welche Leistungen brauche ich, um mich anzumelden? • Wann, wo und wie melde ich mich an? • Wie berechnet sich meine EWS-Note? • Wann ist das EWS-Examen/die Prüfung bestanden? • Wie läuft die Prüfung ab?
Zulassungsvoraussetzungen
(§32 Abs. 1 LPO I)
Examenszulassung sobald alle
Zulassungsvoraussetzungen vorliegen
EWS: gemäß § 32 LPO I
Kein Freiversuch!!!! (§ 16 LPO I)Wie, wann und wo melde ich mich an?
Meldefristen
Herbsttermin (2020)
bis spätestens 1. Februar des
Prüfungsjahres (1.2.2020)
Frühjahrstermin (2021)
bis spätestens 1. August des
Vorjahres (1.8.2020)Herbsttermin 2020
Anmeldung: 01.12.2019 -
01.02.2020
Rücktritt: bis 07.07.2020
Nachreichen von
Prüfungsleistungen: spätestens bis 2
Werktage vor
der ersten Prüfung
Schriftlicher
Prüfungszeitraum: 03.08.2020 – 02.10.2020
(Prüfungstermine etwa ab Dezember online)Anmeldung
Meldung zum Examen beim KM
https://www.km.bayern.de/lehrer/leh
rerausbildung/meldung-zur-ersten-
staatspruefung-html
Link auf der Seite des Prüfungsamtes:
https://www.uni-
wuerzburg.de/studium/pruefungsamt/
staatsexamen/lehramt/Anmeldung
Anmeldebogen ausfüllen und ausdrucken
unterschreiben
beim Prüfungsamt vorlegen, zusätzlich:
• Nachweis Hochschulreife
• Geburtsurkunde (Original oder beglaubigte
Abschrift –keine Kopie, wird einbehalten)
• Notenspiegel/TranskriptWie berechnet sich meine Note?
EWS-Note Examen
Studienbegleitende
Staatsexamen
Leistungen
Prüfungsnote
Note EWS
EWS-Examen
Mindestens Note 5
x4 x6
Fachnote EWS
Mindestens Note 4,50Bestehen der Prüfung
Nicht bestanden, wenn Prüfung schlechter
als „mangelhaft“ (LPO I §32 Abs. 5)
Nicht bestanden, wenn Fachnote EWS
schlechter als „ausreichend“
Wiederholen der Prüfung 1x möglichBestehen der Prüfung
Wiederholen 1x möglich - auch zur
Notenverbesserung (§ 14 LPO I, § 15 LPO I)
zweimal nicht bestanden bedeutet:
endgültig nicht bestanden (§14 LPO I)
Frist zur Wiederholung: zum nächsten oder
übernächsten Termin (§ 14 LPO I, § 15 LPO I)Die Prüfung selbst…
Inhalte
§ 32 LPO I
Prüfung in:
Psychologie oder
Schulpädagogik oder
Allgemeine Pädagogik
(Sie entscheiden sich mit der Anmeldung zur
Prüfung für eines der drei Fächer!)Prüfungsteile 1 schriftliche Prüfung Bearbeitungszeit 4 Stunden Fach bei Meldung angeben 2 Aufgaben aus 2 versch. Teilgebieten
Prüfungsamt Außenstelle des Prüfungsamts des KM https://www.uni- wuerzburg.de/studium/pruefungsamt/staatsex amen/lehramt/ Josef-Martin-Weg 55 / EG rechts
Praktische Tipps
Stifte mit denen Sie gut, leserlich und
schnell schreiben können.
Lineal zum Hervorheben
Gegliedert und strukturiert schreiben
Schokolade macht glücklich!
Lore Koerber-Becker – Professional School of Education –
www.uni-wuerzburg.de/pseKEINE PANIK
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Tamara Ehmann (M.A.)
Inhalte im Fach Allgemeine Pädagogik
§ 32 (LPO1) Inhaltliche Prüfungsanforderungen
in der Erziehungswissenschaft:
a) Theoretische Grundlagen von Erziehung
b) Theoretische Grundlagen von Bildung
c) Empirische Bildungsforschung und
Lebenslanges Lernen
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 24Kerncurriculum a) Theoretische Grundlagen von Erziehung o Erziehungsbegriff und theoretische Ansätze o Werteerziehung und Wertewandel o Erziehungsziele: Reflexion und Begründung Inhaltliche Zuständigkeit: Lehrstuhl für Systematische Bildungswissenschaft Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 25
Kerncurriculum
b) Theoretische Grundlagen von Bildung
o Bildungsbegriff und theoretische Ansätze
o Bildungsziele und Bildungsstandards:
Reflexion und Begründung
Inhaltliche Zuständigkeit: Lehrstuhl für
Systematische Bildungswissenschaft
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 26Kerncurriculum
c) Empirische Bildungsforschung und
Lebenslanges Lernen
o Bildungsforschung zu pädagogischen
Institutionen und Arbeitsfeldern
o Begriff und Bedeutung Lebenslangen Lernens
Inhaltliche Zuständigkeit: Lehrstuhl Empirische
Bildungsforschung
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 27Prüfungsanforderungen
o Insgesamt werden 3 Aufgaben gestellt
(meist eine Aufgabe aus jedem Teilgebiet)
o Bearbeitung von 2 Aufgaben
o Bearbeitungszeit: 4 Stunden, d.h. 2 Stunden
pro Aufgabe
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 28Aufgaben für das Staatsexamen Herbst 2017 (Gymnasium) – Themenbereich: Theoretische Grundlagen von Bildung Erläutern Sie das Konzept nationaler Bildungsstandards! Diskutieren Sie anschließend Kritik und Chancen in Bezug auf Bildungsstandards! Zeigen Sie auf, welche Veränderungen Bildungsstandards in der Schulpraxis mit sich bringen können! Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 29
Aufgaben für das Staatsexamen Herbst 2017 (Sonderschule) – Themenbereich: Theoretische Grundlagen von Erziehung Nennen und erläutern Sie eine aktuelle Erziehungsdefinition inklusive ihres Vertreters! Stellen Sie Schwierigkeiten dar, die sich mit dem Versuch einer Definition des Erziehungsbegriffs ergeben! Üben Sie anschließend Kritik an dem von Ihnen genannten Erziehungsbegriff! Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 30
Aufgaben für das Staatsexamen Herbst 2017 (Gymnasium) – Themenbereich: Empirische Bildungsforschung Erläutern Sie die Unterschiede zwischen der qualitativen und quantitativen Forschung! Nennen Sie verschiedene qualitative Forschungsmethoden und stellen Sie eine exemplarisch vor! Erörtern Sie Vor- und Nachteile der von Ihnen dargestellten Methode im Hinblick auf die Pädagogik! Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 31
Generelle Hinweise für die Bearbeitung
Erwartet wird eine sachlich fundierte und
kenntnisreiche sowie kritisch-konstruktive und
selbstständige Auseinandersetzung mit den Themen.
Dazu müssen Sie …
o ein umfassendes Wissen über das gewählte Themenfeld
darlegen.
o Kenntnisse aus Fachliteratur und Studien belegen.
o die fachwissenschaftliche Terminologie beherrschen.
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 32Generelle Hinweise für die Bearbeitung
Dazu müssen Sie …
o das jeweilige Problemfeld differenziert strukturieren.
o in einer stringenten Argumentation, Hintergründe,
Bedingungen und Prämissen aufzeigen.
o Sachverhalte unter unterschiedlichen Blickwinkeln (z.B.
historischen, empirischen, systematischen,
pragmatischen) interpretieren und erörtern.
o Aussagen, wenn möglich, beispielhaft veranschaulichen.
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 33Generelle Hinweise für die Bearbeitung
Achten Sie auf …
o die Fragestellung und alle Aufgabenteile
o eine Gliederung, ggf. Stoffsammlung
o die Form und sprachliche Richtigkeit: Abschnitte,
Klarheit, Grammatik, Rechtschreibung, Fachbegriffe
o Systematik und Struktur, einen logischen und stringenten
Argumentationsgang
o das klassische Schema von Einleitung – Hauptteil –
Schluss
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 34Relevante Links
www.bildungswissenschaft.uni-wuerzburg.de
Rubrik: „Lehramt“ & „Modularisiert“
www.bildungsforschung.uni-wuerzburg.de
Rubrik: „Aktuelles“ sowie „Studieninfos Lehramt“ & „FAQ
Lehramt“ oder
Ansprechperson: tamara.ehmann@uni-wuerzburg.de
Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften: Allgemeine Pädagogik 35Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Tamara Ehmann (M.A.)
Psychologie für Lehramt
(Staatsexamen EWS)
Peter Marx
26.11.2019Peter Marx
Sprechstunde: Donnerstag, 9:30-10:30 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
Raum 02.131, Wittelsbacherplatz 1
marx@psychologie.uni-wuerzburg.dePrüfungstermin Um die Organisation der Klausur kümmert sich das Prüfungsamt als Außenstelle des Kultusministeriums. Wir (Lehrstuhl für Psychologie IV) können Ihnen leider keine Auskunft über das Prüfungsdatum geben, weil wir den Termin selbst nicht früher erfahren. Erfahrungsgemäß lag der Termin immer in der ersten Woche des schriftlichen Prüfungszeitraumes (eine Garantie können wir nicht geben…).
Literatur alte EWS-Prüfungsfragen auf unserer Homepage (Psychologie, Lehrstuhl IV) WueCampus2-Kursraum (ganz alte und neuere LPO!) mit Literatur unter semesterübergreifende Veranstaltungen“ – Zugangsschlüssel: EWS-Psycho
EWS-Psychologie: Teilgebiete
1) Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens („Lernpsychologie“)
Grundprozesse des Lernens [auch Motivation]; Gedächtnis, Wissenserwerb;
Denken, Problemlösen; Instruktion, Unterrichtsqualität. Teile aus Diff + Soz
2) Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters
Modelle und Bedingungen der Entwicklung; Entwicklung ausgewählter
Funktionsbereiche (Intelligenz, Gedächtnis, Wissen, Sprache und Sprechen,
Motivation, moralisches Denken und Handeln, Sozial- [Aggression?] und
Sexualverhalten, Identität und Selbstkonzept); Kindheit und Jugend;
Entwicklungsförderung. Teile aus Diff und Au
3) Pädagogisch-psychologische Diagnostik und Evaluation („Diagnostik“)
Psychologische Grundlagen und Gütekriterien; Schulleistungsmessung,
Zensurengebung und Lernerfolgskontrolle; Befragung, Beurteilung,
Beobachtung und Testverfahren [LRS? Dyskalkulie? Intelligenzmodelle];
Schulfähigkeitsdiagnostik für verschiedene Schularten; Methoden der
schulbezogenen Evaluation. Teile aus Diff und AuEWS-Psychologie: Teilgebiete 1) Psychologie des Lehrens und Lernens („Lernpsychologie“) Grundprozesse des Lernens: Lernen als Verhaltensänderung; Lernen als Wissenserwerb; Lernen als Problemlösen; Gedächtnis und Wissensformen; kognitive, motivationale und emotionale Voraussetzungen des Lernens; Selbstreguliertes Lernen; Lernen in Gruppen; Lernen mit digitalen und analogen Medien; Lehren und Lernumgebungen gestalten; Unterrichtsqualität; professionelle Kompetenzen von Lehrkräften.
EWS-Psychologie: Teilgebiete 2) Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Modelle und Bedingungen der Entwicklung. Entwicklung ausgewählter Funktionsbereiche: kognitive, motivationale, emotionale Entwicklung. Soziale Entwicklung. Entwicklung von Selbst und Identität. Entwicklungsauffälligkeiten. Entwicklungsförderung.
EWS-Psychologie: Teilgebiete 3) Pädagogisch-psychologische Diagnostik und Evaluation Psychologische Grundlagen (der Diagnostik) und Gütekriterien; Prinzipien der Standardisierung und Normierung; Bezugsnormen; Methoden der Diagnostik; Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften; Diagnostik von Bedingungen des Lernens; Diagnostik von Lernprozessen; Diagnostik von Lernergebnissen und Schulleistungen; Diagnostik von Lern- und Leistungsschwierigkeiten; Methoden der schulbezogenen Evaluation und Bildungsmonitoring.
EWS-Psychologie: Teilgebiete 1) Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 2) Entwicklungspsychologie 3) Diagnostik und Evaluation • Klausur mit je 1 Frage pro Themengebiet • zu beantworten: 2 der 3 Fragen • Zeit: 4 Stunden Angrenzende Bereiche aus Soz, Au, Diff einbezogen.
Vorbereitung? • Literatur • fast alle relevanten Inhalte aus den Pflichtmodulen bekannt – keine weiteren „Klausur-Coaching- Seminare“ • Belegung von Vorlesungen oder Seminaren (v.a. Ent, Lern) im SoSe 20 möglich • auch (erneute) Belegung von Diff / Dia über vhb.org ab 15. März – Aufnahme in Extra-Gruppe für reine Staatsexamens-Interessierte durch Mail an Peter Marx nach Anmeldung über vhb und Klick in Kursraum
Diese Literaturliste soll helfen, die zentral gestellten Themen der Prüfung im Fach Psychologie möglichst gut zu bearbeiten. Es handelt sich um eine subjektive Auswahl der Prüferinnen und Prüfer des Lehrstuhls für Psychologie IV, die keinen absoluten Verbindlichkeitscharakter haben kann. Generelle Empfehlung (von in Bayern Psychologie für Lehramt Lehrenden herausgegeben und weitgehend von Psychologie im Lehramt Lehrenden geschrieben): Urhahne, D., Dresel, M. & Fischer, F. (Hrsg.) (2019). Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Springer. Als E-Book erhältlich: Siehe Katalog der UB Würzburg.
1 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren. Stuttgart: Kohlhammer. Seidel, T. & Krapp, A. (Hrsg.) (2014). Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz. Urhahne, D., Dresel, M. & Fischer, F. (2019). Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Springer.
1 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Ergänzend vielleicht auch: Grundprozesse des Lernens Lefrancois, G. (2006). Psychologie des Lernens (4. Aufl.). Berlin: Springer. (Kap. 2, 3, 4, 6, 7, 11) neue Auflage 2015 auch ok Lukesch, H. (2001). Psychologie des Lernens und Lehrens. Regensburg: Roderer.
1 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Gedächtnis, Wissenserwerb, Denken, Problemlösen Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren. Stuttgart: Kohlhammer. (Kap. 1.3; 1.4; 2.1) Lukesch, H. (2001). Psychologie des Lernens und Lehrens. Regensburg: Roderer. (Kap. 5.4, 9)
1 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Instruktion, Unterrichtsqualität Weidenmann, B. (2006). Lernen mit Medien. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (5. Aufl.) (S. 423-476). Weinheim: Beltz. Brunstein, J. C. & Spörer, N. (2018). Selbstgesteuertes Lernen. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (5. Aufl.) (S. 742-749). Weinheim: Beltz. Mietzel, G. (2007). Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. (8. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. [Kap. 5.4: Übertragung von Gelerntem auf neue Situationen: Transfer. S. 331-342] Klauer, K. J. & Leutner, D. (2012). Lehren und Lernen. Einführung in die Instruktionspsycho- logie. Weinheim: Beltz. (Kap. 10) (als E-Book erhältlich: Siehe Katalog der UB Würzburg.) Rost, D. H. & Buch, S. R. (2018). Pädagogische Verhaltensmodifikation. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4. Aufl.) (S. 619-630). Weinheim: Beltz. Seidel, T. (2015). Klassenführung. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (S. 107-120). Berlin: Springer.
2 Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Lohhaus, A. (2018). Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Berlin: Springer. Schneider W. & Lindenberger U. (Hrsg.) (2018). Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz. Urhahne, D., Dresel, M. & Fischer, F. (2019). Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Springer.
2 Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Ergänzend vielleicht auch: Modelle und Bedingungen der Entwicklung Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. München: Elsevier. [Methoden; S. 19-31]
2 Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Entwicklung ausgewählter Funktionsbereiche: Intelligenz, Gedächtnis, Wissen, Sprache, Motivation Schneider, W. & Lockl, K. (2006). Entwicklung metakognitiver Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter. In W. Schneider & B. Sodian (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie, Serie V Entwicklungspsychologie, Band 2: Kognitive Entwicklung (S. 721- 767). Göttingen: Hogrefe. Schneider, W. (2007). Entwicklung der Intelligenz im Kindesalter. In M. Hasselhorn & W.Schneider (Hrsg.), Handbuch der Entwicklungspsychologie (S. 277-288). Göttingen: Hogrefe. Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. München: Elsevier. Kap. 4: Theorien der kognitiven Entwicklung. [S. 117-154].
2 Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Entwicklung ausgewählter Funktionsbereiche: Sozial- und Sexualverhalten, Identität und Selbstkonzept, Moral Holodynski, M. (2007). Entwicklung der Leistungsmotivation. In M. Hasselhorn & W.Schneider (Hrsg.), Handbuch der Entwicklungspsychologie (S. 299-311). Göttingen: Hogrefe. (v.a. Punkt 4 S. 306-309) Helmke, A. (1998) Vom Optimisten zum Realisten? Zur Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzeptes vom Kindergarten bis zur 6. Klassenstufe. In F. E. Weinert (Hrsg.), Entwicklung im Kindesalter (S. 115-132). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Montada, L. (2008). Moralische Entwicklung und Sozialisation. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 572-605). Weinheim: Beltz. Roebers, C. M. (2007). Entwicklung des Selbstkonzepts. In M. Hasselhorn & W.Schneider (Hrsg.), Handbuch der Entwicklungspsychologie (S. 381-391). Göttingen: Hogrefe. Oerter, R. & Dreher, E. (2008). Jugendalter. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 271-332). Weinheim: Beltz.
2 Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Förderung kognitiver Fähigkeiten Klauer, K. J. & Marx, E. (2010). Förderung kognitiver Fähigkeiten. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4. Aufl.) (S. 414-418). Weinheim: Beltz. Hasselhorn, M. & Mähler, C. (1990). Lernkompetenzförderung bei "lernbehinderten" Kindern: Grundlagen und praktische Beispiele metakognitiver Ansätze. Heilpädagogische Forschung, 16, 2-13.
3 Pädagogisch – psychologische Diagnostik und Evaluation Virtuelles Modul als Grundlage; als Alternative bzw. zum Gegenlesen finden Sie die relevanten Themen auch in folgender Literatur: Hesse, I. & Latzko, B. (2017). Diagnostik für Lehrkräfte. Opladen: Budrich. (E-Book) Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik. Weinheim: Beltz. Urhahne, D., Dresel, M. & Fischer, F. (2019). Psychologie für den Lehrberuf. Berlin: Springer.
3 Pädagogisch – psychologische Diagnostik und Evaluation Ergänzend vielleicht auch: Psychologische Grundlagen und Gütekriterien Lukesch, H. (1998). Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik (2. Aufl.). Regensburg: Roderer. (Kap. 2) Schulleistungsmessung, Zensurengebung und Lernerfolgskontrolle Lukesch, H. (1998). Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik. (2. Aufl.). Regensburg: Roderer. (Kap. 12, 13, 14) Befragung, Beurteilung, Beobachtung und Testverfahren Lukesch, H. (1998). Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik (2. Aufl.). Regensburg: Roderer. (Kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9)
3 Pädagogisch – psychologische Diagnostik und Evaluation Schulfähigkeitsdiagnostik für verschiedene Schularten Wild, K.-P. & Krapp, A. (2006). Pädagogisch-psychologische Diagnostik. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (5. Aufl.) (S. 525-574). Weinheim: Beltz. Methoden der schulbezogenen Evaluation Wottawa, H. (2006). Evaluation. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (5. Aufl.) (S. 659-687). Weinheim: Beltz.
Herbst 2011 - Gym; Thema Nr. 1 Beschreiben Sie die drei grundlegenden Lerntheorien und bringen Sie zu jeder Lerntheorie ein Beispiel für eine Verhaltensstörung, die mit der jeweiligen Lerntheorie abgebaut werden könnte! Frühjahr 2014 - RS, Thema Nr. 1 Stellen Sie die Sozial-Kognitive Lerntheorie von Bandura dar (zentrale Konzepte und empirische Befunde)! Erörtern Sie wesentliche Folgerungen aus dieser Theorie für eine Optimierung des Lehrerhandelns und der Lehr-Lern-Prozesse im Unterricht!
Frühjahr 2014 – Gym; Thema Nr. 2 Stellen Sie ausgehend von einem klassischen Modell der Informationsverarbeitung (Gedächtnismodell) und einem klassischen Modell zur Speicherung von Wissen im Langzeitgedächtnis dar, welche Komponenten zur Entwicklung der Gedächtnisleistung zwischen 5 und 15 Jahren beitragen! Erläutern Sie für jede Komponente, wie sich jüngere und ältere Schülerinnen und Schüler unterscheiden und belegen Sie ihre Ausführungen durch einschlägige empirische Befunde! Gehen Sie darauf ein, wie hiervon ausgehend die Gedächtnisleistung gefördert werden kann und skizzieren Sie dazu Vorgehensweisen im Unterricht!
Frühjahr 2014 – GS/HS; Thema Nr. 2 Kognitive Entwicklungstheorien Beschreiben Sie unter Einbezug einschlägiger empirischer Befunde die kognitive Entwicklung zwischen 5 und 15 Jahren, ausgehend von zwei unterschiedlichen kognitiven Entwicklungstheorien! Vergleichen und diskutieren Sie die beiden Ansätze und leiten Sie aus beiden theoretischen Ansätzen Empfehlungen für die kognitive Förderung in der Schule ab!
Frühjahr 2013 – GS/HS Thema Nr. 3 Intelligenz kann eine mögliche Ursache unterdurchschnittlicher Schulleistungen sein. Definieren Sie die Begriffe „Intelligenz“ und „Intelligenzquotient“! Beschreiben Sie ausführlich zwei Intelligenztests, die auf unterschiedlichen theoretischen Modellvorstellungen zur Intelligenz basieren! Gehen Sie dabei auf theoretische Konzeption, Zielsetzung, Durchführung, Messgüte und Ergebnisinterpretation ein! Diskutieren Sie, inwiefern Sie als Lehrkraft die Intelligenz von Schülerinnen und Schülern fördern können!
Frühjahr 2014 – SoPäd Thema Nr. 3 Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Modifikationsdiagnostik und Selektionsdiagnostik! Skizzieren Sie zudem die wesentlichen Gemeinsamkeiten! Zeigen Sie, inwieweit Schulleistungstests sowohl im Rahmen der Modifikations- als auch der Selektionsdiagnostik Verwendung finden können! Beschreiben Sie dabei auch die quantitative und die qualitative Auswertung von Schulleistungstests! Beziehen Sie zudem ein konkretes Anwendungsbeispiel aus dem Förderschulbereich ein!
Generelle Hinweise Aufgaben verlangen in der Regel • Begriffe • Modelle / theoretische Grundlagen • Bezug zu empirischen Befunden • Transfer • Förderung
Generelle Hinweise • gegliederte Antwort • gerne Zwischenüberschriften • erlaubt sind auch Unterstreichungen, Skizzen, Tabellen (nicht mit anderen Farben)
Psychologie komPAkt • Kurs der vhb (Passau und München) • „Kompaktseminar zur Vorbereitung auf das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften (Fachbereich: Psychologie)“
Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Schulpädagogik für Lehramt
(Staatsexamen EWS)
Matthias Erhardt
26.11.2019Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Inhaltliche Vorgaben (nach LPO I):
Teilgebiet A: Theoretische Grundlagen von
Unterricht
• theoretische Grundlagen von Unterricht: Aktuelle
didaktische Theorien;
• medienerzieherische und mediendidaktische
KonzepteFakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Inhaltliche Vorgaben (nach LPO I):
Teilgebiet B: Planung und Gestaltung von
Lernumgebungen
• Planung und Gestaltung von Lernumgebungen: Sach-,
fach- und adressatenbezogene Planung, Gestaltung und
Evaluierung von Lernsituationen;
• Gestaltung von Lernsituationen unter den Bedingungen
von Heterogenität und Inklusion; Förderung von
eigenverantwortlichem und kooperativem LernenFakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Inhaltliche Vorgaben (nach LPO I):
Teilgebiet C: Bilden und Erziehen in Schule und
Unterricht
• Bilden und Erziehen in Schule und Unterricht: Gestaltung
von Bildungs- und Erziehungsprozessen unter besonderer
Berücksichtigung der interkulturellen Dimension, der
ganztägigen Bildung und Erziehung sowie der Sucht- und
Gewaltprävention an SchulenFakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Bearbeitungszeit:
• zu jedem Teilgebiet (A, B, C) wird eine Aufgabe d.h.
insgesamt 3 Aufgaben gestellt - 2 Aufgaben müssen
ausgewählt werden
• die Bearbeitungszeit beträgt insgesamt 4 Stunden, also 2
Stunden pro Aufgabe (rechnen Sie Zeit für Gliederung,
Stoffsammlung, Nachdenken ein)Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Themenauswahl:
• alle gestellten Themen genau lesen und Überlegungen
anstellen
• Themen- und Fragestellung beachten
• bei mehreren Fragen jede beantworten, möglichst in
thematischer Reihenfolge (in Gliederung aufnehmen)Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Aufbau der Klausur:
• Stoffsammlung erstellen
• Gliederung anfertigen (auch im Text übernehmen)
• strukturieren Sie Ihre Bearbeitung!
• auf Systematik und das Wesentliche achten
• klassisches Schema von Einleitung-Hauptteil-Schluss
beachtenFakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Inhaltliche Kriterien:
• Erfassung und Darstellung des Themas
• Argumentationsgang, Logik und Stringenz
• Kenntnisse aus Fachliteratur und Studien
• Fachwissenschaftliche Terminologie
• Insgesamt ErörterungsstilFakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Formale Kriterien:
• Sprachliche Richtigkeit: Grammatik, Rechtschreibung,
Fachbegriffe, Klarheit im Ausdruck
• Saubere Ausführung und übersichtliche Platzeinteilung
(Abschnitte gliedern)
• Enddurchsicht ratsamFakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Themenbeispiele:
Thema Nr. 1
Grund- und Mittelschulen Herbst 2019
Das „Angebots-Nutzungsmodell der Unterrichtswirksamkeit“ von Helmke
(2007) definiert Unterricht als Angebot, für dessen Qualität die Lehrkräfte
verantwortlich sind.
1. Stellen Sie den Entstehungshintergrund sowie das Angebots-
Nutzungsmodell kurz in Bezug auf Struktur und Funktion vor!
2. Wählen Sie drei für Sie entscheidende Qualitätsmerkmale für
Unterricht aus, erläutern Sie diese auch im Hinblick auf das Angebots-
Nutzungsmodell, begründen Sie Ihre Wahl und zeigen Sie, wie diese
drei zur Wirksamkeit um Unterricht beitragen können!Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Themenbeispiele:
Thema Nr. 2
Sonderpädagogik Herbst 2019
1. Begründen Sie, warum die Eigenaktivität der Schülerinnen und
Schüler in besonderem Maße gefordert werden sollte!
2. Stellen Sie verschiedene Unterrichtsformen dar, die Eigenaktivität
ermöglichen!
3. Zeigen Sie anhand eines selbst gewählten unterrichtlichen Themas,
wie sich eine dieser Unterrichtsformen in der Förderschule umsetzen
lässt!Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Themenbeispiele:
Thema Nr. 3
Grund- und Mittelschulen Frühjahr 2019
Lehrerpersönlichkeit als ein Erziehungsfaktor
Erläutern Sie diese These, indem Sie themenbezogene
Forschungsergebnisse und Erkenntnisse aus der
Professionalisierungsdebatte in Ihre Überlegungen miteinbeziehen!Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Orientierungshilfe:
http://www.schulpaedagogik.uni-
wuerzburg.de/studium/pruefung/
Hier finden Sie detaillierte Informationen sowie Literatur-
Empfehlungen für die schriftliche Prüfung
Nutzen Sie zur Vorbereitung alte Themenstellungen (auf der
Homepage des Lehrstuhls unter „Prüfung“)Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Schulpädagogik, Dr. Matthias Erhardt
Viel Erfolg bei den Prüfungen
und bleiben Sie gelassen!Sie können auch lesen