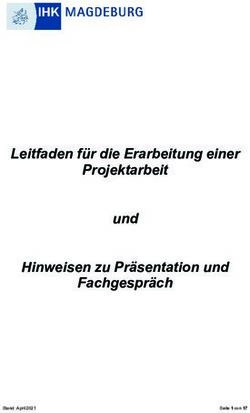Klagenfurter Geographische Schriften Heft 28 - Eine Zukunft für die Landschaften Europas und die Europäische Landschaftskonvention
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Klagenfurter
Geographische
Schriften Heft 28
Institut für Geographie und Regionalforschung
der Universität Klagenfurt 2012
Hans Peter JESCHKE und Peter MANDL (Hrsg.)
Eine Zukunft für die Landschaften Europas
und die Europäische LandschaftskonventionTitelblatt: „Unsere Umwelt beginnt in der Wohnung und endet in der Weite der Landschaft“
Aus: IVWSR (1973): Wiener Empfehlungen. Luxemburg. In: Jeschke, Hans Peter (Hrsg.)
(1982): Problem Umweltgestaltung. Ausgewählte Bestandsaufnahme, Probleme, Thesen
und Vorschläge zu Raumordnung, Orts- und Stadtgestaltung, Ortsbild- und
Denkmalschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz. Verlag Stocker, Graz.
(= Schriftenreihe für Agrarpolitik und Agrarsoziologie, Sonderband 1)
Medieninhaber (Herausgeber und Verleger):
Institut für Geographie und Regionalforschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67, A-9020 Klagenfurt
Herausgeber der Reihe: Ass.-Prof. Mag. Dr. Peter MANDL
Prof. Mag. Dr. Friedrich PALENCSAR
Schriftleitung: Prof. Mag. Dr. Friedrich PALENCSAR
Redaktionelle Betreuung: Dipl.-Ing. Stefan JÖBSTL, Bakk.
Webdesign und –handling: Natalie SCHÖTTL, Dipl.-Geogr. Philipp AUFENVENNE
ISBN 978-3-901259-10-4
Webadresse: http://geo.aau.at/kgs28Hans Peter Jeschke, Peter Mandl (Hrsg.) (2012): Eine Zukunft für die Landschaften Europas und
die Europäische Landschaftskonvention. Institut für Geographie und Regionalforschung an der
Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Klagenfurter Geographische Schriften, Heft 28.
FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG MIT ZWEIERLEI MAß – DAS BEISPIEL
MÜNSTERTAL IM SCHWARZWALD
Korinna THIEM
Einleitung
Das Münstertal zeigt im Kleinen die historischen Veränderungen an den Fließgewässern und
die daraus resultierenden Konflikte zwischen Wiederherstellung natürlicher Zustände und
dem Erhalt kulturhistorischer Werte. Die Überformung durch den Menschen bedeutet aus
ökologischer Sicht Verlust und Zerstörung - aus kulturhistorischer Sicht Gewinn und
Bereicherung. Fließgewässer sind ursprünglich natürliche Landschaftselemente. Sie
wandelten sich jedoch durch anthropogene Nutzung von einem rein natürlichen Element in
ein Kulturlandschaftselement. Sie sind Teil der Geschichte und spiegeln durch wasserbauliche
Elemente, wie Stauwehre, Mühlen oder Hangkanäle die wirtschaftliche Tätigkeit, aber auch
die historische Entwicklung von Landschaftsräumen wider. Fließgewässer besitzen
Zeugniswert und damit Denkmalqualität. Auf den ersten Blick erscheinen diese beiden
Standpunkte konträr und nicht miteinander vereinbar. Dass dem nicht so ist, zeigt das Beispiel
Münstertal. Der Artikel stellt eine Methodik vor, die die Interessen des Gewässerschutzes mit
denen der Denkmalpflege vereint.1
Die historische Landschaftsanalyse bildet dabei eine methodische Klammer. Sie schafft die
Grundlage für eine Spurensuche und einen Kulturlandschaftskataster. Für das Münstertal
konnten in einem Längsschnitt, vom 13. Jahrhundert bis 1929, zahlreiche kulturhistorische
Einflüsse auf die Fließgewässer ermittelt werden. Dies waren die Ausnutzung der Wasserkraft
im Bergbau und Kleingewerbe, Brennholztrift und Flößerei sowie Wiesenbewässerung. Auf
diesen Ergebnissen aufbauend, wurde ein Bewertungsverfahren entwickelt, das sowohl die
ökologische Wirkung als auch denkmalpflegerische Werte von Querbauwerken berücksichtigt.
Neu ist, dass Querbauwerke nicht nur als Wanderungshindernisse und Geschiebefallen
betrachtet werden, sondern auch als Elemente mit Biotopbildungspotenzialen.
Das Münstertal befindet sich ca. 20 km südlich von Freiburg und erstreckt sich von den
Berggipfeln Belchen und Schauinsland bis an den Rand der Oberrheinischen Tiefebene.
Hydrologisch gehört das Tal zum oberen Einzugsgebiet des Neumagens, dem
Hauptfließgewässer im Münstertal. Ein sehr dichtes Netz aus relativ kleinen, aber
gefällereichen Bächen zerteilt das Münstertal in verschiedene Seitentäler. Der
durchschnittliche Abfluss des Neumagens beträgt ca. 1,7 m³/s (MQ)2. Im Jahresverlauf
schwankt der Abfluss: Mit einem Maximum im April von 2,45 m³/s und einem Minimum im
September von 1,02 m³/s. 3
1
Der Artikel ist eine Zusammenfassung einer Dissertation, die am Institut für Landespflege an der Universität
Freiburg entstand (vgl. Thiem 2006).
2
LfU 2001
3
Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein 1998
593594 KORINNA THIEM ___________________________________________________________________________ Methoden der Rekonstruktion Für die Rekonstruktion der historischen Gewässernutzungen wurde die historische Landschaftsanalyse mit den Teilschritten landschaftsgeschichtliche Quellendokumentation und Inventarisation der Kulturlandschaftselemente angewendet (vgl. Abb. 1). Der Badische Wasserkraftkataster4 erwies sich dabei als sehr hilfreich. Er listet für das Jahr 1929 sämtliche Wassertriebwerke im Einzugsgebiet des Neumagens auf. Abb. 1: Arbeitsschritte der historischen Landschaftsanalyse Die vorhandenen Archivalien und Literaturquellen zur Siedlungsgeschichte und wirtschaftlichen Erschließung des Münstertals erlaubten eine qualitative Beschreibung der anthropogenen Eingriffe. Quantitative Aussagen waren lediglich für die Anzahl der Wassermühlen sowie Anzahl und Längen von Gräben und Kanälen zu bestimmten Stichjahren möglich. Hier ist allerdings stets von einer Minimalanzahl auszugehen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kann von gesicherten Zahlen ausgegangen werden, da Wasserkraftnutzungen ab dieser Zeit behördlich erfasst worden. Die Inhalte aus den verschiedenen Quellen wurden kartographisch als Landschaftszustands- und Landschaftswandelkarten5 aufgearbeitet und interpretiert. Als Kartengrundlage für die Generierung der Landschaftszustands- und Landschaftswandelkarten diente die Deutsche Grundkarte im Maßstab 1:5.000. In einem zweiten methodischen Schritt wurden die historischen Gewässernutzungen in einem Kulturlandschaftskataster6 beschrieben und der kulturhistorische Dokumentationswert bestimmt. Der Kataster beschreibt alle kleingewerblichen und bergbaulichen Standorte, die zwischen dem 13. Jahrhundert und 1929 Wasserkraft nutzten, aber auch Wiesenbewässerungssysteme und andere Wassernutzungen. Insgesamt wurden 135 Einzelelemente erfasst. Von den 135 Kulturlandschaftselementen sind 44 Elemente heute materiell nicht mehr vorhanden. Um sie in das kulturelle Gedächtnis des Münstertals zurückzuholen, wurden sie ohne Bewertung in den Kataster aufgenommen. 4 Badischer Wasserkraftkataster 1929 5 vgl. Burggraff; Kleefeld 1998 6 Hier dienten die Arbeiten von Gunzelmann (1987, 2001), Burggraaff und Kleefeld (1998) sowie Kistemann (2000) als Grundlage der Erfassung und Bewertung.
FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG MIT ZWEIERLEI MAß – DAS BEISPIEL MÜNSTERTAL IM
SCHWARZWALD 595
___________________________________________________________________________
Wasserkraftnutzung – ausgewählte Beispiele
Die Ausnutzung der Wasserkraft hatte im Münstertal zu jeder Zeit einen hohen Stellenwert.
Zwischen dem 13. Jahrhundert und 1929 sind insgesamt 44 Wassermühlen nachgewiesen.
Zum großen Teil waren dies Erzpochen und -schmelzen, Sägemühlen und Schmieden.
Daneben trieb die Wasserkraft auch Mahlmühlen und Elektrizitätswerke an. Die Sägemühle
des Klosters St. Trudpert gilt neben der Klostergetreidemühle als die älteste überlieferte
Wassermühle im Münstertal. Beide Mühlen wurden erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich
erwähnt7. Das Antriebswasser erhielten die Mühlen aus dem Neumagen, der über einen
Hangkanal die Wasserräder antrieb. Die Getreidemühle wurde Ende des 19. Jahrhunderts
abgerissen. Auch die Klostersäge existiert nicht mehr. Sie wurde 1897 abgerissen 8. An
gleicher Stelle entstand das Fabrikgebäude der Bürstenholzfabrik Mutterer, die bis heute das
Stauwehr und den Hangkanal der ehemaligen Mühlen für ihre Turbinen nutzt. (vgl. Abb. 2
und 3).
Abb. 2: Stauwehr der Bürstenholzfabrik Mutterer Abb. 3: Hangkanal der
Bürstenholzfabrik Mutterer
Silberbergbau ist im Münstertal ab dem 11. Jahrhundert historisch nachgewiesen und
erreichte zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert seinen Höhepunkt9. Nach einer
Unterbrechung von ca. 150 Jahren wurde mit Beginn des 18. Jahrhunderts der
Bergwerksbetrieb in verschiedenen Gruben wieder aufgenommen und hielt bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts an. In der zweiten Blütephase wurde hauptsächlich Blei, Zink und Kupfer
abgebaut10. In der Schmelze im Wildsbachtal wurden zum Beispiel Erze aus den umliegenden
Gruben verhüttet. Auch hier wurde Wasser aus dem Neumagen als Aufschlagwasser genutzt.
Der Hangkanal der Schmelze Wildsbach war der längste nachweisbare Hangkanal im
Münstertal. Wenige Reste des ehemals 500 m langen Kanals sind heute noch sichtbar (vgl.
Abb. 4). Nach der Stilllegung der Erzschmelze diente der Hangkanal von 1865 bis 1920 der
Seidenfabrik Mez zum Antrieb einer Turbine11.
7
Lange 1991
8
Lange 1991
9
Schlageter 1989; Goldenberg 1996
10
Schlageter 1989
11
Lange 1991596 KORINNA THIEM ___________________________________________________________________________ Abb. 4: Schmelze Wildbach: Reste des Hangkanals Abb. 5: Betonkanal des E-Werks Untermünstertal Mit Beginn des 20. Jahrhunderts war der Höhepunkt der Erschließung der Wasserkraft erreicht. Allein am Neumagen waren 20 Wassermühlen mit einer Gesamtleistung von ca. 182 kW/h gemeldet12. Nachdem die technischen Voraussetzungen zur Erzeugung von Elektroenergie geschaffen waren, tauschten viele Wasserkraftbetreiber das Wasserrad gegen Turbinen aus. Elektrische Energie wurde nicht nur für den Eigenbedarf produziert. Auch Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft profitierten von dieser technischen Entwicklung. Untermünstertal erhielt 1922 ein Elektrizitätswerk. Es war bis 1972 in Betrieb13. Ein 500 m langer Betonkanal (vgl. Abb. 5), der zum Teil auch als Hangkanal geführt, trieb die Turbinen des Elektrizitätswerks an. Das Biotop-Kulturwertverfahren Querbauwerke gelten per Definition als beträchtliche Eingriffe in das Gewässersystem und behindern damit die ökologische Funktionsfähigkeit. Abbildung 6 zeigt die 6 Hauptparameter der LAWA-Gewässerstrukturkartierung14: Laufentwicklung, Querprofil, Sohle, Ufer und Gewässerumfeld. Künstliche Querstrukturen werden ausschließlich mit Begradigung, Hindernis und Barrierewirkung, technisches Regelprofil, Verbauung der Sohle und des Ufers und schließlich mit Nutzung des Gewässerumfeldes in Verbindung gebracht. In den letzten Jahren sind auch natürliche Ursachen wie Totholzverklausung, Geländeschwellen und Biberdämme als wertvolle Querstrukturen wahrgenommen worden. Diese werden in der Gewässerökologie als Bereicherung der Fließgewässer geschätzt. Es steht außer Zweifel: 12 Badischer Wasserkraftkataster 1929 13 Lange 1991 14 LAWA 2000
FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG MIT ZWEIERLEI MAß – DAS BEISPIEL MÜNSTERTAL IM
SCHWARZWALD 597
___________________________________________________________________________
Künstliche Querstrukturen schränken die Durchgängigkeit von Fließgewässern ein. Stellt man
aber die als positiv bewerteten natürlichen Querstrukturen den Querbauwerken gegenüber,
wandeln sich die Assoziationen. Künstliche Querstrukturen können auch als:
Strukturelemente, als Sekundärbiotope, als kulturelle Werte und letztlich als Zeugen der
Wirtschaftsgeschichte gesehen werden (vgl. Abb. 6).
Abb. 6: verschiedene Sichtweisen: LAWA-Gewässerstrukturkartierung vs.
Biotop-Kulturwertverfahren
Um die ökologische Wirkung von Querbauwerken zu beschreiben, wurde exemplarisch am
Neumagen die Gewässerstruktur an den Querbauwerken qualitativ erfasst. Auf dem Wissen
der historischen Analyse aufgebaut, wurde ein Verfahren entwickelt, das die ökologischen
Wirkungen der Querbauwerke Wert gebenden Faktoren aus der Kulturlandschaftsgenese
gegenüberstellt, Biotop-Kulturwert-Verfahren genannt. Das Verfahren gliedert sich in drei
Teile: (1) Erfassung der ökomorphologischen Merkmale sowie der soziokulturellen Werte, (2)
Bewertung der ökologischen Funktionsfähigkeit und des kulturhistorischen
Dokumentationswertes, (3) Empfehlung von Maßnahmen
1. Ökomorphologische Ausstattungsmerkmale und soziokulturelle Werte
An den Vorgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser und Abfall und der
Gewässerstrukturkartierung von Bayern angelehnt15, wurde der strukturelle Gewässerzustand
am Querbauwerk durch 21 Einzelparameter mit definierten Parametermerkmalen erfasst (vgl.
Tab. 1). Diese Einzelparameter sind den vier Hauptparametern Gewässerbettdynamik,
Verlagerungspotenzial, Strukturausstattung und Entwicklungsanzeichen zugeordnet. Der
ökomorphologischen Erhebung folgt die Frage: Welche Wert bestimmenden Faktoren gibt es?
Diese sind in sieben Einzelparametern beschrieben (vgl. Tab 2).
15
LAWA 2000; BAYLW 2002598 KORINNA THIEM
___________________________________________________________________________
Tab. 1: Erfassungsparameter des Biotop-Kulturwertverfahrens: ökomorphologische Ausstattung
Gewässerbettdynamik Sohlmaterial7 Unbekannt
Laufkrümmung2 Gestreckt Steinschüttung
Verzweigt Holz
Gewunden, bogig Rasengittersteine
Künstlich bogig Steinsatz/Pflaster
Begradigt Beton
Verlagerungspotenzial Entwicklungsanzeichen
Querbauwerkstyp1 Sohlrampe Tiefenvariabilität1 Nicht bestimmbar
Sohlgleite Ausgeprägt
Absturz Mäßig
Absturz mit Rampe Keine
1
Stau -/Überfallwehr Tiefenerosion Nicht bestimmbar
3
Höhe Absturz [cm] < 30 Keine
30 bisFLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG MIT ZWEIERLEI MAß – DAS BEISPIEL MÜNSTERTAL IM
SCHWARZWALD 599
___________________________________________________________________________
Angedeutet Gering, n = 2
Keine Keine, n = 1
7 1
Sohlverbau Unbekannt Sonderstrukturen Ausgeprägt
Keine (Augenschein) Gering
Gering ( 100 Jahre
25 – 100 Jahre
< 25 Jahre
Nutzungshistorische Triebwerk
Bedeutung Energieerzeugung
Wiesenbewässerung
Teich
Unbekannt
5
Funktionsbereich Unbekannt
Siedlung
Handwerk/Gewerbe
Verkehr
Land-/Forstwirtschaft
Industrie/Bergbau
Feudale Anlage600 KORINNA THIEM
___________________________________________________________________________
Standort mit religiöser Bedeutung
6
Schutzstatus Kulturdenkmal
kein
4
Literatur aus Tab. 1 und 2 LfU (WABIS) 2003
1 5
BAYLFW 2002 (verändert) Gunzelmann 1987
2 6
Binder; Schneider-Ritter 2001 Kistemann 2000 (verändert)
3 7
Hütte 2000: 121f LAWA 2000
2. Bewertung
Eine Bewertung beschreibt immer ein Verhältnis, dass zwischen dem zu bewertenden Objekt
und der wertenden Person. Der Bewertungsprozess setzt aber auch ein Wissen um die
Eigenschaften einer Sache oder den Zustand (physikalisch, chemisch, biologisch) voraus, die
Sachinformation. Dem steht die Wertdimension gegenüber. Werte entsprechen gedanklichen
Bildern. Einem Element wird eine Bedeutung beigemessen. Dabei spielen Vorstellungen,
Erwartungen, Wissen und Erfahrung eine entscheidende Rolle.
In der Planungspraxis werden Fließgewässer ausschließlich als Teil der Natur und als
Lebensraum für Tiere und Pflanzen betrachtet. Daher orientieren sich die
Bewertungsverfahren an ökologischen und ästhetischen Kriterien16. Die Bewertung entspricht
einem Soll-Ist-Zustands-Vergleich. Der Ist-Zustand eines Gewässers wird in seinem
Abweichen vom Naturzustand beurteilt, von dem vorausgesetzt wird, dass er den höchsten
ökologischen Wert besitzt17. Als Referenz wird der natürliche, vom Menschen unbeeinflusste,
oder naturnahe Zustand des Gewässers herangezogen. Für die Bewertung der Querbauwerke
im Neumagen wurde auf den Soll-Ist-Zustands-Vergleich verzichtet und rein deskriptiv, dass
heißt verbal-argumentativ bewertet. Als Bewertungskriterien für die Ermittlung der
ökologischen Funktionsfähigkeit dienten: Das Verlagerungspotenzial, die Fähigkeit zur
eigendynamischen Entwicklung und die vorhandenen Strukturelemente. Für die
soziokulturellen Werte wurden Kriterien aus der Denkmalpflege wie Erlebbarkeit,
Erhaltungszustand (formal und funktional) und der kulturhistorische Dokumentationswert
herangezogen.
3. Empfehlung von Maßnahmen
Als letzter Schritt im Verfahren wurden Handlungsmaßnahmen empfohlen. Diese richteten
sich nach dem Leitbild des anthropogen beeinflussten, kulturhistorischen Gewässerzustandes.
Die Maßnahmen ordnen sich nach folgenden Kategorien: (1) ökologische Funktionsfähigkeit
gewährleisten (Bau einer Fischtreppe), (2) Rückbau des Elements, (3) Kennzeichnung als
Kulturlandschaftselement, (4) Unterschutzstellung als Kulturdenkmal im Sinne von §2
DSchG BW, (5) Ausweisung als Standort für eine mögliche Wasserkraftnutzung
(Positivkartierung Wasserkraft). Bezüglich der letzten Punkte gilt: Soll ein Querbauwerk
erhalten werden, dann ist in jedem Fall die Längsdurchgängigkeit für Fische und Arten des
Makrozoobenthos sowie für Sedimente herzustellen. Im Punkt 3 und 4 wurde eine Rangfolge
hinsichtlich der Schutzwürdigkeit bzw. -dringlichkeit der Elemente entwickelt. Im Fall: Als
Kulturdenkmal schützen, wird der höchste Schutzstatuts empfohlen. Die Kategorie: Als
Kulturlandschaftselement kennzeichnen, charakterisiert lediglich die relative Bedeutung des
Elements für die Kulturlandschaftsgenese eines abgeschlossenen Raums. Das bedeutet, dass
für alle weiteren Flachplanungen erneut über Rückbau oder Erhalt entschieden werden muss.
16
Leitl 1997; Jessel 1998; LAWA 2000; Paschkewitz 2001; BAYLFW 2002
17
Werth 1992; LAWA 2000FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG MIT ZWEIERLEI MAß – DAS BEISPIEL MÜNSTERTAL IM
SCHWARZWALD 601
___________________________________________________________________________
Ergebnisse der Aufnahmen
Gewässerstruktur und ökologische Funktionsfähigkeit
Die Ergebnisse zeigen, dass die Querbauwerke durch bauliche und strukturelle Eigenschaften
die ökologische Funktionsfähigkeit mäßig bis stark einschränken. Die Durchgängigkeit für
Fische und Arten des Makrozoobenthos ist an sechs Standorten nicht gegeben; die restlichen
neun Querbauwerke sind eingeschränkt für Fische durchgängig. Der Geschieberückhalt ist bei
der Mehrzahl der Querverbauungen mäßig bis gering, so dass Geschiebe und anderes Material
zu n, an neun Querbauwerken verlagert werden kann.
Der Neumagen verfügt zwar nicht über die ökomorphologischen Eigenschaften naturnaher
Gewässer, dennoch zeigen die Aufnahmen, dass Potenziale im ökomorphologischen Sinne zur
Strukturverbesserung und eigendynamischen Entwicklung gegeben sind. Auch wenn die
Lebensraumqualität für Pflanzen und Tiere momentan gering ist, Biotopbildungspotenziale
gegeben. Vor allem die Tosbereiche der Stauwehre besitzen zahlreiche Strukturelemente wie
Inselsteine, Treibholz, Uferbänke und Kolke.
Soziokulturelle Werte
Der Minderung der ökologischen Funktionsfähigkeit steht ein relativ hohes Maß an
wertvollen Merkmalen aus der Kulturlandschaftsgenese gegenüber. Acht Querbauwerke
besitzen einen sehr hohen kulturhistorischen Dokumentationswert, für zwei Querbauwerke
konnte ein hoher und für fünf ein mäßiger kulturhistorischer Dokumentationswert festgestellt
werden. Insgesamt wurde für sieben Querbauwerke die Empfehlung: Als
Kulturlandschaftselement kennzeichnen ausgesprochen. Zwei Querbauwerke wurden für eine
Unterschutzstellung als Kulturdenkmal vorgeschlagen. Neben der Einzelunterschutzstellung
als Kulturdenkmal bietet das Denkmalschutzgesetz von Baden-Württemberg das Instrument der
Sachgesamtheit Dadurch werden raumübergreifend Kulturlandschaftselemente unter Schutz zu
stellen. Übertragen auf die zwei Querbauwerke würde dies nicht nur den Schutz der
historischen Substanz der Einzelelemente bedeuten, sondern auch des funktionalen
Zusammenhang zwischen Stauwehr, Triebwerkskanal und Gebäude. Tabelle 3 sowie die
Abbildungen 7 und 8 geben Beispiele für die Bewertung der Querbauwerke wieder.
Tab. 3: Bewertungsbeispiele
Ökologische Erlebbarkeit Kulturhistor- Maßnahmen
Beeinträchtigung ischer Dokumen-
tationswert
Stauwehr stark sehr gut, sehr hoch, Schutz als
Bürstenholzfabrik Stauwehr und Standort hat Kulturdenkmal nach
Mutterer (vgl. Hangkanal sind historischen Bezug §2 DSchG BW,
Abb. 2) von einem zu den beiden Durchgängigkeit
Wanderweg Klostermühlen, durch Fischtreppe
aus älteste oder Umlaufgerinne
erlebbar nachweisbare herstellen,
Wasserkraftnutzung Stauwehr, Kanal und
im Münstertal Bürstenholzfabrik in
einen Themenpfad
„Wasserkraftnutzung
im Münstertal“
einbinden
ehemaliges mäßig mäßig, hoch, als Kulturland-
Stauwehr Absturz diente im 18. schaftselement602 KORINNA THIEM
___________________________________________________________________________
Schmelze Stauwehr Jahrhundert zur kennzeichnen,
Wildsbach (vgl. funktional Ausleitung von Durchgängigkeit
Abb. 7) nicht mehr Wasser für die gewährleisten,
vorhanden Erzschmelze Positivstandort für
Wildsbach, Wasserkraftnutzung,
Mitte des 19. Standort für
Jahrhunderts Themenpfad
kleingewerbliche „Wasserkraftnutzung
Nutzung. im Münstertal“
Stauwehr stark sehr gut, im 19. Jahrhundert als Kulturland-
Hofsäge (vgl. Stauwehr wird Ausleitung schaftselement
Abb. 8) im Sommer als Betriebswasser für kennzeichnen,
Badestelle die Hofsäge, Durchgängigkeit
genutzt Teil einer Kette von gewährleisten,
Sägemühlen entlang Positivstandort für
des Neumagens Wasserkraftnutzung.
Standort für
Themenpfad
„Wasserkraftnutzung
im Münstertal“
Abb.7: ehemalige Stauwehr der Erzschmelze Wildsbach Abb. 8: Hofsäge am Neumagen, im Sommer ein
beliebter Badeplatz
Literaturverzeichnis
BADISCHER WASSERKRAFTKATASTER (1929): KANDER, MÖHLIN MIT NEUMAGEN SOWIE FEUERBACH,
HOHLEBACH, KLEMMBACH UND SULZBACH. In: WASSER- UND STRAßENBAUDIREKTION DES GROß-
HERZOGTUMS Badens (Hrsg.) Heft 9/10; 40 S., Karlsruhe
BAYRISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT (BAYLFW) (Hrsg.) (2002): Kartier- und Be-
wertungsverfahren Gewässerstruktur. Erläuterungsbericht, Kartier und Bewertungsanleitung; 92 S., München
BINDER, E.; SCHNEIDER-RITTER, U. (2001): Gewässertypenkatalog für die Gewässerentwicklung in den
Landkreisen Ortenau und Emmendingen. Materialien Gewässer 3; 455 S. Offenburg
BURGGRAAFF, P.; KLEEFELD, K.-D. (1998): Historische Kulturlandschaft und Kulturlandschaftselemente.
Angewandte Landschaftsökologie 20; 320 S.FLIEßGEWÄSSERBEWERTUNG MIT ZWEIERLEI MAß – DAS BEISPIEL MÜNSTERTAL IM SCHWARZWALD 603 ___________________________________________________________________________ DENKMALSCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG (DSchG BW) (Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale) vom 6.12.1983, GBl. S. 797; zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895). GEWÄSSERDIREKTION SÜDLICHER OBERRHEIN/HOCHRHEIN (1998): Gewässerentwicklungskonzept für die Gewässer Neumagen und Möhlin, unveröffentl. Studie, Bearb.: Amann, S., Haferkorn, J.; Loritz, J., 89 S., Freiburg GOLDENBERG, G. (1996): Archäometallurgische Untersuchungen zur Entwicklung des Metallhüttenwesens im südlichen Schwarzwald (Blei-, Silber- und Kupfergewinnung von der Frühgeschichte bis ins 19. Jahrhundert) Archäologie und Geschichte 8, 274 S., Rahden GUNZELMANN, T. (1987): Die Erhaltung der historischen Kulturlandschaft. Angewandte Historische Geographie des ländlichen Raums mit Beispielen aus Franken. Bamberger Wirtschaftsgeographische Arbeiten 4; 319 S.; Bamberg GUNZELMANN, T. (2001): Die Erfassung der historischen Kulturlandschaft. In: BAYRI-SCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg.): Historische Kulturlandschaft, Materialien 39: 15-32 HÜTTE, M. (2000): Ökologie und Wasserbau. Ökologische Grundlagen von Gewässerverbauung und Wasserkraftnutzung; 280 S.; Berlin KISTEMANN, E. (2000): Gewerblich-industrielle Kulturlandschaft Bergisch-Gladbach 1820-1999; 377 S.; Essen LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER UND ABFALL (LAWA), (2000): Gewässerstrukturgütekartierung in der Bundesrepublik Deutschland. Verfahren für kleine bis mittelgroße Fließgewässer, 1. Aufl.; 145 S.; Schwerin LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LfU) (2001): Abflüsse Pegel Untermünstertal – Messperiode 1955 – 2001, unveröffentlicht LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (2003): Beschreibung der Erfassung von wasserbaulichen Objekten für die Bestandsaufnahme der WRRL bis 2004 (WAABIS); 5 S.; Karlsruhe LANGE, M. (1991): Äbte, Vögte, Bergleute. Gewerbechronik der Gemeinde Münstertal/ Schwarzwald; 158 S.; Freiburg LEITL G. (1997): Landschaftsbilderfassung und –bewertung in der Landschaftsplanung – dargestellt am Beispiel des Landschaftsplanes Breitungen-Wernshausen. – Naturschutz und Landschaftsplanung 7: 282-290 JESSEL, B. (1998): Das Landschaftsbild erfassen und darstellen. Vorschläge für ein pragmatisches Vorgehen. – Naturschutz und Landschaftsplanung 11: 356-360 PASCHKEWITZ, F. (2001): Schönheit als Kriterium zur Bewertung des Landschaftsbildes. Vorschläge für ein in der Praxis anwendbares Verfahren. – Naturschutz und Landschaftsplanung 9: 286-291 SCHLAGETER, A. (1989): Zur Geschichte des Bergbaus im Umkreis des Belchen. - In: LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) Der Belchen. Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges, Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Baden Württembergs 13: 127-309; Karlsruhe THIEM, K. (2006): Die Historische Landschaftsanalyse als Methode für die Fließgewässerbewertung am Beispiel des Münstertals im Schwarzwald. Culterra 46, 185 S.; Freiburg WERTH, W. (1992): Ökologische Gewässerzustandsbewertung in Oberösterreich. In: FRIEDRICH, G.; LACOMBE, J. (Hrsg.): Ökologische Bewertung von Fließgewässern, Limnologie aktuell 3: 205-218; Stuttgart, Jena, New York Dr. Korinna THIEM Büro text:feld Landschaft + Kommunikation + Medien Strehlener Str. 22 01069 Dresden k.thiem@text-feld.de
Sie können auch lesen