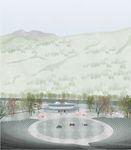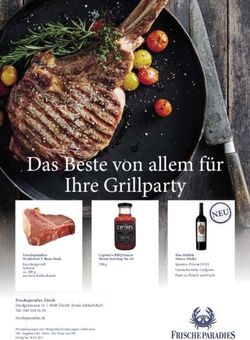KNORR & PÜRCKHAUER ARCHITEKTEN - Siedlung Herdernstrasse Zürich, 2.Preis
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
KNORR & PÜRCKHAUER ARCHITEKTEN
Siedlung Herdernstrasse
Zürich, 2.Preis
Datum: 2014
Bauherr: Stadt Zürich
Budget: CHF 28 Mio.
Fläche: 8.100 m2
Status: offener Wettbewerb
Das Grundstück für die neue Wohnsiedlung Herdernstrasse ist Teil eines speziellen
post-industriellen Kontexts, in dem sich die verschiedensten Typologien miteinan-
der vermischen. Dem strategisch gut gelegenen Eckgrundstück wohnt mit seiner
unmittelbaren Nachbarschaft zum Letzigrundstadion das grosse Potential inne ein
Stück Stadt weiterzubauen, das im Norden an die bestehende Blockrandtypolo-
gie anschliesst, im Westen und Süden städtische Strassenzüge begleitet und im
Osten von den Freiraumqualitäten der Klein- und Familiengärten profitiert. Ein neues
Gebäude an diesem Ort sollte eine figürliche Präsenz besitzen und eine dezente
Urbanität ausstrahlen. Über dem öffentlichen Erdgeschoss mit Atelier- und Lade-
neinheiten entwickeln sich drei Wohngeschosse und ein aus der Strassenflucht
zurückversetztes Wohn-Attikageschoss. Vertikale Erkermotive, die aus plastisch
ausformulierten Eingängen erwachsen, rhytmitisieren den massiven Baukörper
über alle Geschosse hinweg und sollen der Fassade eine gewisse Lebendigkeit
verleihen. Die Unterteilung des Grundrisses mit drei identischen Treppenhäusern
und einem besonderen Treppenhaus in der Ecksituation führt zu einer kompakten,
einfachen und selbstverständlichen Organisation und erlaubt es, die kollektiv ge-
nutzten Räume – die Eingangshallen und Dachgärten – grosszügig zu bemessen. Im
Regelgeschoss werden jeweils zwei grössere Familienwohnungen und eine kleinere
Wohnung für Singles, Paare oder ältere Menschen erschlossen. Alle Familienwoh-
nungen erstrecken sich über die gesamte Gebäudetiefe und sind um einen zentralen
Hauptraum organisiert, der sich zwischen Strasse und Hof aufspannt und über eine
02 03 04
zuschaltbare Küche abgetrennt werden kann. Eine tiefe Balkonschicht erweitert den
Hauptraum zum Hof hin und wird von den dezenten Vor- und Rückspringen der
Innenhoffassade selbstverständlich in das Fassadenbild eingebunden. Grosszügi-
ge Geschosshöhen von 2.70 m verleihen den Räumen eine gute Proportion und
transportieren das Licht bis in die Tiefe der Wohnungen. Das Gebäude greift mit
seiner Erscheinung bewusst Gestaltungselemente auf, die an Wohnhäuser aus dem
umliegenden städtischen Gewebe erinnern.Elemente wie die fassadengliedernden
Loggien und Erker, die schmalen Vorgärten und das abgesetzte Sockelgeschoss.
Die dezente Farbigkeit ergänzt das pastelline Kolorit der benachbarten Häuser auf
selbstverständliche Weise und unterstreicht gleichzeitig die Eigenständigkeit des
Hauses an der priveligierten Ecklage.
01 Situationsplan
02 Erdgeschossplan
03 Regelgeschoss
04 4.5 und 2.5 Zimmer Wohnung
05 Das Gebäude vom Stadion Letzigrund aus gesehen
01 05KNORR & PÜRCKHAUER ARCHITEKTEN Wohnquartier Leutschenbach Zürich, 9.Preis Datum: 2014 Bauherr: Stadt Zürich Budget: CHF 160 Mio. Fläche: 25.000 m2 Status: offener Wettbewerb Das Grundstück für die neue Wohnüberbauung in Leutschenbach Mitte liegt in einem typischen post-industriellen Kontext, in dem die Spuren der ehemaligen Produktions- und Lagerhallen seit geraumer Zeit von neuen Gewerbe- und Wohnge- bäuden überformt werden. Ein neues Gebäudeensemble in diesem Kontext sollte die Kraft besitzen, auf die verschiedenen Nachbarschaften spezifisch zu reagieren, und gleichzeitig als einheitliche Gesamtüberbauung eine eigenständige Identität für das Quartier auszustrahlen. Entlang der Leutschenbachstrasse definieren die Gebäude den Strassenraum mit einer klaren Front und begrenzen die Ausläufer des Leutschenparks mit einem selbstverständlichen Gegenüber. Auf selbstverständliche Weise gliedert das Gebäude die Grenzen des landschaftlich gestalteten Gartens in- dem es eine klare und leserliche Unterteilung zwischen öffentlichen und privaten Be- reichen definiert. Die grosszügigen Innenhöfe erlauben es trotz der hohen baulichen Dichte optimale Aussichts- und Belichtungsqualitäten aller Wohnungen sicherzustel- len und bilden als privater Rückzugsort der Bewohner einen natürlichen Gegensatz zu den angrenzenden öffentlichen Freiräumen der Umgebung. Die Erschliessung der Häuser erfolgt, wie bei klassischen innerstädtischen Blockrandtypologien, vom öffentlichen Stadtraum her, wodurch die Innenhöfe in ihrer Privatheit gestärkt werden und an Aufenthaltsqualität gewinnen. Die natürlich belichteten Treppenhäuser, wel- che über eine grosszügige Eingangshalle betreten werden, besitzen im Erdgeschoss einen direkten Ausgang zu den sorgfältig gestalteten Innenhöfen. Das Regelge- 02 schoss folgt einem einfachen System gleich grosser Zimmer und Hauptraumfiguren. Alle Wohnungen erstrecken sich entlang der Hauptraumfigur über die gesamte Gebäudetiefe und profitieren so von mindestens zwei verschiedenen Ausrichtungen. Wir stellen uns vor, dass die Aufwertung der Leutschenbachstrasse zu einer boule- vardähnlichen Flaniermeile mit einem öffentlichen Erdgeschossausdruck einhergeht. Die öffentlichen kleingewerblichen Nutzungen, welche hier anzutreffen sind, sollen auch den Riedgrabenweg begleiten und ihn im übergeordneten Massstab zu einer grösseren Präsenz als Quartiererschliessung zwischen Leutschenbachstrasse und Hagenholzstrasse verhelfen. 01 Situationsplan 02 Regelgeschoss 03 Das Ensemble vom Riedgraben aus gesehen 01 03
KNORR & PÜRCKHAUER ARCHITEKTEN Renovation, Anbau und Umnutzung Maison Gubler zu einer Kindertagesstätte Nyon, 2.Preis Datum: 2015 Bauherr: Stadt Nyon Budget: CHF 5 Mio. Fläche: 550 m2 Status: offener Wettbewerb, 2.Preis Das Maison Gubler markiert als ehemaliger Familiensitz den Abschluss eines reich bestückten Landschaftsgartens, der sich einst bis an die Uferkante des Genfer Sees erstreckte. Seit seinen Ursprüngen 1795 ist das Maison Gubler organisch gewachsen. Mit den wechselnden Eigentümerfamilien wandelnden sich auch die Raumansprüche an das Haus. Die räumlichen Erweiterungen auf der Westseite des Hauses aus dem Jahr 1909 haben das ursprüngliche Gebäude zu einem komple- xeren und repräsentativeren Ensemble erweitert. Mit der Umnutzung des Hauses zu einem Kinderhort ändern sich die Ansprüche an das Haus erneut. Die Hauptaufgabe besteht darin den Ort neu zu ordnen und dem Wunsch Rechnung zu tragen, ein offener und öffentlicher Ort zu werden und gleichzeitig den lebendigen Geist des Hauses zu bewahren, der dem Ensemble als ehemaligen Familiensitz innewohnt. Dies ist heutzutage nicht mehr der Fall. Die vielfach veränderte Raumaufteilung läuft einer einfachen räumlichen Organisation, zwischen den dienenden Nebenräumen auf der Strassenseite und den repräsentativeren Wohnräumen zum Garten hin zuwi- der. Wir schlagen vor, die bestehenden Wohnräume mit minimalen Eingriffen in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen und für die neue Nutzung zu ertüchtigen. Mit einem Ersatzneubau für den zweigeschossigen Anbau auf der zum Jura hin aus- gerichteten Seite des Hauses, soll das bestehende Raumangebot von in etwa gleich grossen Aufenthaltsräumen, um zwei grössere polyvalente Räume erweitert werden. Ein grosszügiger Garderobenraum auf der Nordseite des Hauses bildet den Auftakt für die Ankunft der Kinder, integriert auf selbstverständliche Weise die infrastruktu- rellen Bedürfnisse und bindet als Scharnier die bestehenden und neuen Räume des 02 03 Hauses zusammen. Die Aufteilung der Nutzungen auf die Geschosse folgt der ein- fachen Logik der Abläufe eines Kinderhorts. Während die ebenerdige Anlieferung im Untergeschoss die Lage von Küche, Speisekammer und Umkleiden begünstigt, sind die repräsentativeren Räume im ersten und zweiten Obergeschoss als polyvalente Aufenthaltsräume für die Kinder vorgesehen. Im Dachgeschoss, das dem Lärm der Kinder auf Grund seiner Lage auf natürliche Weise entrückt ist, sind die administrati- ven Nutzungen und die Personalräume angedacht. Der Garten gliedert sich in einen privateren Hausgarten, der die Villa unmittelbar umgibt und eine weitläufige Wiesen- und Waldfläche. Entsprechend der topografischen Charakteristik des Ortes sind die Aussenräume auf unterschiedlichen Terrassen organisiert. 01 Situationsplan 02 Erdgeschoss 03 Ansicht Süd 04 Maison Gubler vom Garten aus gesehen 01 04
KNORR & PÜRCKHAUER ARCHITEKTEN Wohn- und Gewerbeüberbauung Zollhaus Zürich, 8.Preis Datum: 2015 Bauherr: Kalkbreite Genossenschaft Budget: CHF 47 Mio. Fläche: 15.000 m2 Status: offener Wettbewerb, 8.Preis Das Baufeld für das Zollhaus ist Teil einer übergeordneten Arealentwicklung, die sich entlang der Zollstrasse vom Hauptbahnhof Zürich bis zur Langstrasse erstreckt. Während der westliche Ausläufer des Grundstücks an den belebten Strassenzug der Langstrasse grenzt und diesen mit seinen publikumsorientierten Nutzungen wei- ter auflädt, spannt das östliche Volumen im Zusammenspiel mit dem Brockenhaus einen kleinen Raum auf, der durch das neue Verkehrs- und Bepflanzungskonzept an Bedeutung gewinnt und die Abfolge der charakteristisch schmalen Fassadenfron- ten, welche die Zollstrasse prägen, fortführt. Wir schlagen vor, mit unserem Entwurf drei Gebäudekörper zu platzieren, die in ihrem Verlauf die Axialität der Zollstrasse aufnehmen und am östlichen und westlichen Ausläufer eine Art Vorplatzsituation schaffen, welche das Potential der hier angedachten öffentlichen Nutzungen intensi- vieren und auf selbstverständliche Weise die Treppenaufgänge zur Zollhaus Gleis- terrasse inszenieren. Einem industriellen Gebäudetypus ähnlich, besitzen die drei Gebäudevolumen einen klare Geometrie, die in ihrer Tiefe durch den Anstoss an das Gleisfeld begrenzt ist. Nach Süden hin spannen die 3 Gebäudekörper eine grosszü- gige Gleisterrasse auf, die als Aufenthalts-, Begegnungs- und Erschliessungsfläche dem faszinierenden Blick über das Gleisfeld stattgibt. Die Cafeteria, welche sich über die gesamte Tiefe des Baukörpers erstreckt und schon von der Zollstrasse aus den öffentlichen Charakter des Zollhauses andeutet, leitet die höher gelegene Gleisterrasse ein. Hier befindet sich die grosszügige Eingangshalle des Zollhauses mit ihrer nach Süden vorgelagerten Arkade, der Betriebs- und Waschraum, die flexibel anmietbaren Arbeitsplätze, sowie die Gartenküche und der gemeinschaft- 02 liche Veloraum. Die Konstruktion und der Charakter des neuen Gebäudes für die Kalbreite Genossenschaft sollten effizient und robust sein. Die einfache Struktur der Gebäude generiert dabei ein Höchstmass an Flexibilität, welches Gewerbe- und Wohnnutzungen gleichermassen ermöglicht. Wir schlagen ein abwechslungsreiches Wohnungsangebot vor, bei dem grosse und kleine Wohnungen unmittelbar nebenei- nander liegen. Während die kleineren Wohnungen etagenweise einen grosszügigen Gemeinschaftsraum teilen, kann den gösseren Wohnungen im Verlauf der Zeit ein zusätzliches Jokerzimmer zugeschaltet werden. Die gemeinschaftlich genutzten Dachgärten, welche auf allen Häusern anzutreffen sind und das Erscheinungsbild der Zollhäuser vom Gleisfeld her prägen, geben den Bewohnern einen grandiosen 01 Situationsplan 02 Regelgeschoss und Längsschnitt 03 Das Ensemble vom Gleisfeld aus gesehen 01 03
KNORR & PÜRCKHAUER ARCHITEKTEN Markthalle und Ringkuhkampfarena Raron Datum: 2015 Bauherr: Verein Goler Markthalle Budget: CHF 6 Mio. Fläche: 1600 m2 Status: offener Wettbewerb Der Bauplatz für den Neubau der Markthalle Goler und den Ersatzneubau der Ringk- uhkamparena Goler befindet sich in der flachen Ebene des Rhonetals auf halber Strecke zwischen Visp und Raron. Dieser Abschnitt, welcher sich im Querprofil zwischen dem Flusslauf der Rhone und der Kantonsstrasse aufspannt, folgt einem dispersen landwirtschaftlichen Bebauungsmuster, dass von einem feingliedrigen We- genetz durchzogen ist. Trotz der hohen Gebirgsketten, welche das Tal in Ost West Richtung begleiten, wirkt das Tal hier grosszügig und weit. Wir stellen uns vor, dass die neue Markthalle und Kuhkampfarena von dieser landschaftlichen Weite profitiert und von allen Seiten, wie eine Landmarke, als öffentliches Gebäude in Erscheinung tritt. Der kreisförmige Grundriss der Markthalle vermag es dabei nicht nur die vielen faszinierenden Ausblicke einzufangen die sich hier bieten, er hebt das Gebäude gleichzeitig auch von den pragmatischen Industriebauten der Nachbarschaft ab und zeichnet den Neubau als einfachen Sonderbau aus. Von der Basperstrasse aus ge- sehen, besetzt die Markthalle die prominenteste Ecke des Grundstücks und macht mit einem dezenten Schriftzug über dem Haupteingang leise auf sich aufmerksam. Von hier aus spannt sich über die Diagonale des Grundstücks eine Raumfolge auf, welche über die zentrale Markhalle hinaus weiter auf die Ringkuhkamparea zuführt. Wie bei einem griechischen Theater, grenzt sich die Arena dabei nicht gegen die Landschaft ab, sondern wendet sich dieser zu und bindet die Markthalle als erwei- terte Kulisse in die Szenerie mit ein. Wir glauben, dass die beiden Bauten im Zusam- menspiel ihrer Volumetrien räumlich und funktional voneinander profitieren können. So kann die Arena beispielsweise während der schönen Jahreszeiten als zusätzliche 02 Marktfläche genutzt werden und die Markthalle während der Ringkuhkämpfe mit einem einfachen Angebot an Speisen und Getränken und der nötigen Infrastruktur aufwarten. Dort, wo die Ringkuhkampfarena auf die Markthalle trifft, entsteht eine Art Zwischenraum, der als Platz für temporäre Zelte während grösserer Tierschauen dienen kann und während der Kuhkampfveranstaltungen die Plätze für Kommenta- toren und Jurymitglieder aufnimmt. Der vom öffentlichen Bereich des Grundstücks leicht abgesetzte Parzellenstreifen im Osten wird für die Anlieferung, Verteilung und Vorbereitung der Tiere vorgesehen. Wir stellen uns vor, dass die Markthalle, wie bei den amerikanischen balloon-frame Konstruktionen aus einfachen Holzrahmen auf- 01 Situationsplan 02 Erdgeschoss 03 Blick auf die Markthalle 04 Das Ensemble von der Tribüne aus gesehen 01 03 04
Sie können auch lesen