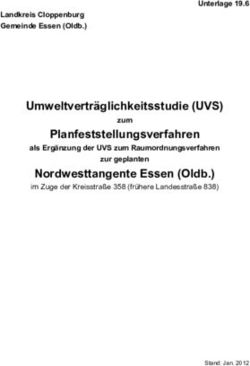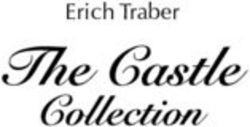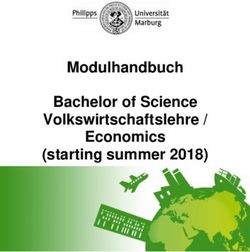Korridoruntersuchung Mattigtal - B147 - Abschnitt Süd - Schutzgemeinschaft ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Korridoruntersuchung Mattigtal
B147 – Abschnitt Süd
Gemeinde Lengau, Gemeinde Munderfing
Zusammenfassung der Bewertungen
Amt der Oö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung,
wirtschaftliche und ländliche
Entwicklung
Abteilung Raumordnung
Stand: Jänner 2018Inhaltsverzeichnis
1 Abschnitt Süd: Lengau – Munderfing ..........................................................................4
1 Raumuntersuchung ......................................................................................................5
1.1 Natur- und Landschaftsschutz ..................................................................................5
1.2 Waldschutz...............................................................................................................7
1.3 Wasser (Grund- und Trinkwasser, Oberflächengewässer) .......................................8
1.4 Mensch/Nutzungen ................................................................................................10
2 Variantenentwicklung .................................................................................................11
3 Variantenbewertung Raum & Umwelt ........................................................................13
3.1 Variante Le1 ...........................................................................................................13
3.2 Variante Le-1a........................................................................................................15
3.3 Variante Le-1b........................................................................................................17
3.4 Variante Le-1ab ......................................................................................................19
3.5 Variante Le-2..........................................................................................................21
4 Zielerreichung Verkehr & Technik..............................................................................23
5 Wirtschaftlichkeit ........................................................................................................24
6 Exkurs: Überprüfung der Grundlagendaten ..............................................................25
7 Vorzugsvariante ..........................................................................................................28
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Raumbewertung Naturschutz.............................................................................5
Abbildung 2: Raumbewertung Waldschutz .............................................................................7
Abbildung 3: Grundlagendaten Wasserschutzgebiete, Hochwasserabflussflächen ................8
Abbildung 4: Grundlagendaten Siedlung ..............................................................................10
Abbildung 5: Übersichtskarte, Verkehrsprognose, techn. Herausforderungen ......................12
Abbildung 6: Variante 1 ........................................................................................................13
Abbildung 8: Variante Le1a ..................................................................................................15
Abbildung 10: Variante Le-1b ...............................................................................................17
Abbildung 11: Variante Le-1ab .............................................................................................19
Abbildung 12: Variante Le2 ..................................................................................................21
Abbildung 13: Vorzugskorridor Lengau-1..............................................................................301 Abschnitt Süd: Lengau – Munderfing
Im Rahmen der Korridoruntersuchung Mattigtal wurde der Teilraum südlich der nunmehrigen
Umfahrung Mattighofen-Munderfing, das umfasst Gemeindegebiet von Lengau und
Munderfing, als „B147 Abschnitt Süd“ hinsichtlich möglicher Umfahrungskorridore betrachtet.
Die Korridoruntersuchung wurde im Jahr 2008 abgeschlossen. In einem ersten Schritt
wurden zwei fachliche Vorzugsvarianten identifiziert. Im Jahr 2016 wurden die
Grundlagendaten und ursprünglichen Bewertungen in Hinblick auf die angestrebte Flächen-
sicherung einer fachlichen Überprüfung unterzogen – siehe Kapitel Exkurs: Überprüfung der
Grundlagendaten im Jahr 2016 und eine fachliche Präferenz ermittelt.
Der vorliegende Planungsbericht umfasst die Ergebnisse der ursprünglichen
Korridoruntersuchung und gibt einen Überblick der durchgeführten Überprüfung der
Grundlagendaten im Jahr 2016 sowie die abschließend identifizierte Vorzugsvariante,
dargestellt am Ende dieses Berichts.
4 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20181 Raumuntersuchung
1.1 Natur- und Landschaftsschutz
Raumcharakteristik
Der Untersuchungsraum stellt sich als weitgehend ebener, breiter Talboden dar, dessen
Ausformung als breites und flaches eiszeitliches Trogtal durch den Einfluss des Salzach-
gletschers geprägt wurde. Es finden sich auch innerhalb des Talraumes, unter anderem im
Bereich südlich von Lengau / südlich von Friedburg, mehr oder weniger stark ausgeprägte
Flussterrassenkanten. Das Gebiet wird im Osten durch die Großwaldgebiete des Krenn-
bzw. Kobernaußerwaldes begrenzt. Der gesamte Landschaftsraum ist gekennzeichnet durch
• eine ausgeprägte landwirtschaftliche Intensivierung
• eine relativ hohe Siedlungsdichte und Streustruktur in Form von Kleinweilern
• eine intensive forstwirtschaftliche Nutzung
• eine hohe Dichte an Fließgewässern, die vielfach in Haupt- und mehrere
Nebengewässer aufgefächert sind
Abbildung 1: Raumbewertung Naturschutz
5 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Im Folgenden werden die wesentlichen wertprägenden Biotopflächen bzw. Strukturmerkmale
kurz charakterisiert.
• Randzone der Waldgebiete Krenwald und Kobernaußerwald
Die erhöhte Bedeutung dieser Großwaldgebiete als Lebensraum ist bereits aufgrund
der Ausdehnung der Waldgebiete gegeben. Der Bereich des Kobernaußerwaldes
weist überwiegend Fichtenreinbestände auf, die Randzone ist jedoch teilweise durch
Laubgehölzbestände bzw. einen Laubholzsaum durchsetzt. Die hohe Wertigkeit ist
vor allem durch die Raumausdehnung bestimmt.
• Schwemmbach und Nebengerinne bzw. Uferbegleitstrukturen zwischen
Teichstätt und Munderfing
Der Schwemmbach stellt, wenn auch abschnittsweise stark reguliert, aufgrund der
durchgehenden Uferbestockung und der Funktion als Fließgewässer eine
bedeutsame Verbindungsachse dar. Eine stark erhöhte Wertigkeit ist im Umfeld von
Teichstätt festzustellen. Die unterschiedlichen Regulierungsgrade des
Schwemmbaches innerhalb und außerhalb des Siedlungsgebietes bzw. nördlich und
südlich der Ortschaft Achenlohe rechtfertigen differenzierte Werteinstufungen.
• Terrassenkante südlich von Friedburg
Die mehrere Meter hohe Böschung weist teilweise Gehölzbestände, teilweise
nährstoffarme Wiesentypen auf und bildet ein raumprägendes Landschafts- und
Vernetzungselement.
• NATURA 2000-Gebiet Rückhaltebecken Teichstätt
Der Bereich des Rückhaltebeckens ist vor allem als Vogellebensraum von Bedeutung
und als NATURA 2000-Gebiet nominiert. Das Rückhaltebecken selbst ist mit dem
Bachverlauf des Schwemmbaches sowie Richtung Südosten mit größeren
Feuchtflächen vernetzt und als „Tabuzone“ zu bewerten.
• Rückhaltebecken nördlich von Lengau
Vermutlich als Relikt einer ehemaligen Kiesgewinnung entstanden, stellt sich dieses
Rückhaltebecken als Sukzessionsfläche und als Sonderlebensraum dar. Richtung
Süden schließt eine raumprägende Geländekante an, die teils mit standortgerechten
Laubgehölzen bestockt ist, teils eine Sukzessionfläche darstellt.
6 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20181.2 Waldschutz
Im Fachbereich Forstwirtschaft weisen folgende Bereiche im Untersuchungsraum erhöhte
Schutzinteressen auf:
• Randbereiche des Kobernaußerwaldes
Die Randbereiche des Kobernaußerwaldes werden zum größten Teil mit der
Sensibilitätsstufe 3 bewertet, da es sich um ein großes geschlossenes Waldgebiet
handelt und das Gelände als sehr schwierig zu bezeichnen ist (steil bis sehr steil).
Naturnah bestockte Bereiche bzw. ein Quellschutzgebiet und ein Brunnen-
schutzgebiet werden in die Kategorien 4 und 5 eingestuft.
• Größere Waldgebiete in Munderfing bzw. Jeging
Diese größeren, geschlossenen Waldflächen weisen bezogen auf ihre ökologische
Wertigkeit eine mäßige, teilweise eine hohe1 Sensibilität auf. Der Großteil der
Waldflächen hat laut Waldentwicklungsplan die Kennzahl 121 - die
Wohlfahrtsfunktion ist in diesem Bereich von erhöhtem öffentlichem Interesse.
Abbildung 2: Raumbewertung Waldschutz
1
außerhalb des Planausschnittes
7 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20181.3 Wasser (Grund- und Trinkwasser, Oberflächengewässer)
Abbildung 3: Grundlagendaten Wasserschutzgebiete, Hochwasserabflussflächen
Grundwasser
Wasserwirtschaftlich sensible Bereiche stellen dar:
• Ein Teilgebiet südwestlich von Munderfing ist Teil der wasserwirtschaftlichen
Vorrangfläche Lochen. Als potentieller Standortsbereich für künftige
Trinkwasserbrunnenanlagen ist dieser Bereich als Kernbereich eines möglichen
Grundwasserschongebietes nach Möglichkeit aus Gründen des vorsorglichen
Grundwasserschutzes grundsätzlich von größeren Trassen freizuhalten.
• Alle wasserrechtlich festgesetzten Schutzgebiete sind (gemeinsam mit den
Hochwasserabflussflächen) in der obigen Plandarstellung ausgewiesen. Die
Schutzgebiete bilden jeweils kleine Teilflächen der höchsten Bewertungsstufe.
(Hinweis: aktualisierte Karte, Stand 01/2018).
Im gesamten Planungsraum ist grundsätzlich der wasserwirtschaftliche Rahmenplan Mattig
zu beachten (Zielvorstellungen „der Sicherung der gegenwärtigen und zukünftigen Trink- und
Nutzwasserversorgung im Einzugsgebiet der Mattig“ und „Vorrang der Trinkwassernutzung
vor allen anderen Nutzungen“).
Hochwasserabfluss
Mit Entstehung des Rahmenplans Mattig wurden umfangreiche Retentions- und
Überflutungsberechnungen durchgeführt, die für das Gebiet sehr detaillierte Daten
wiedergeben. Für die jeweiligen Überflutungsbereiche im Mattig-Schwemmbach-Hainbach-
Einzugsgebiet ergeben sich in Bezug auf den Hochwasserschutz folgende Anforderungen:
• HQ10-Überflutungsbereich des Schwemm-, Mühlbergerbachs und der Mattig
Laut Planungsgrundsätzen des „Rahmenplan Mattig“ ist der HQ10-Überflutungs-
bereich von jeder abflussbehindernden Bebauung freizuhalten.
Die Einengung der Abflussräume würde zu weiteren Regulierungsmaßnahmen und
Abflussbeschleunigungen führen.
8 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018• Hochwasserretentions- und Versickerungsbecken für Hochwässer >HQ30
Die beiden Becken Teichstätt-Ost und -West gewährleisten mit ihrem
Gesamtvolumen von 1,4 Mio. m³ den Hochwasserschutz für das gesamte
flussabwärtige Schwemmbach-Mattigtal. Eine weitere Teilfläche umfasst das
Versickerungs- und Retentionsbecken Lengau des Hainbaches.
Ein Retentionsraumverlust durch Straßendämme etc. ist im Rückhaltebecken nicht
zulässig.
• Planungsraum für zukünftiges Retentionsbecken
(Überflutungsbereich für Hochwässer1.4 Mensch/Nutzungen
Für das Fachgebiet Mensch/Nutzungen (Raumordnung) wird keine detaillierte
Raumbewertung vorgenommen.
Als Grundlage für die Variantenentwicklung dienen die Baulandwidmungen und -funktionen
gemäß den rechtswirksamen Flächenwidmungsplänen und Örtlichen Entwicklungskonzepten
der Gemeinden (Hinweis: aktualisierte Plandarstellung, Stand 01/2018).
Bei der Entwicklung von Varianten ist auf einen entsprechenden Abstand zu
Siedlungsflächen zu achten, um die direkte Betroffenheit von Wohngebäuden bzw. den
vollständige Verlust von Bauland oder künftigen Baulanderweiterungsflächen wenn möglich
zu vermeiden.
Abbildung 4: Grundlagendaten Siedlung
10 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20182 Variantenentwicklung
Gemäß den im Rahmen der Verkehrsuntersuchung durchgeführten Zählungen und
Messungen beträgt die für das Jahr 2020 prognostizierte Verkehrsbelastung in der
Gemeinde Lengau
• rund 6.100 Kfz/Werktag auf der B 147 nördlich von Friedburg (Ri. Munderfing)
• rund 9.060 Kfz/Werktag auf der B 147 südlich von Friedburg (Ameisberg)
• rund 4.300 Kfz/Werktag auf der L 508 östlich von Friedburg (Ri. Schneegattern)
Entsprechend der Typisierung von Straßenkategorien (1 bis 5, wobei 1 die höchste bzw.
bedeutendste Kategorie darstellt) wird die B147 Braunauer Straße gemäß ihrer Funktion als
Verbindung zwischen Regionalzentren im gesamten Verlauf der Kategorie 3 zugeordnet.
Der Bestand der B 147 weist im Untersuchungsraum einen (zu) geringen Querschnitt von
5,9 - 6,9 m auf. Gemäß RVS 03.03.31 ist für Landesstraßen mit der im gegenständlichen
Bereich herrschenden Verkehrsbelastung eine Fahrbahnbreite von 8,00 - 8,50 m
erforderlich.
Entwickelte Varianten und Korridore
Unter Berücksichtigung der räumlichen Struktur (Lage der Siedlungsgebiete, Verlauf des
Schwemmbaches etc.) sowie der Ergebnisse der Raumuntersuchung wurden mehrere
Varianten in einem (1) bestandsnahen und (2) bahnparallelen (westlich der
Mattigtalbahn) Korridor ausgearbeitet2. Der Absprung von der bestehenden B147 erfolgt im
Süden auf Höhe der Ortschaft Ameisberg, wobei der exakte Absprungspunkt erst in einem
Detailprojekt im Rahmen der künftigen Verfahren festgelegt wird. Im Norden schließen beide
Korridore an die Umfahrung Mattighofen-Munderfing an (Brückenbauwerk).
Variante Länge Kurzbeschreibung
(in Km)
Le 1 8,924 Trasse umfährt Friedburg und Heiligenstatt im Westen, bestandsnaher
Verlauf zwischen Km 4,700 und Km 8,500
Anschluss im Norden an die Umfahrung Mattighofen-Munderfing –
niveaufreie Querung der Mattigtalbahn (Km 11,100)-
Lengau-1
Korridor
Le 1a 8,924 wie Le1, jedoch Ausbau am Bestand zwischen Km 6,800 und
Km 7,730 (Achtal)
Le 1b 8,818 wie Le1, Trasse zwischen Km 3,000 und Km 4,777 (Heiligenstatt)
jedoch näher am Bestand und weiter von Teichstätt und
Schwemmbach abgerückt
Le 1ab Mischvariante Lenau 1a + 1b
nach Absprung im Süden: Verlauf Richtung Westen, tangiert
Lengau-2
Rückhaltebecken Lengau, niveaufreie Querung der Mattigtalbahn
Korridor
südlich der Ortschaft Bach, bahnparalleler Trassenverlauf zwischen
Le 2 9,055 den Rückhaltebecken Teichstätt, ab Km 6,500 Fortführung über freie,
ebene, landwirtschaftliche Flächen zwischen den Ortschaften Ach und
Rödt bis zum Anschluss an die Umfahrung Mattighofen-Munderfing
2
Planausschnitte mit den detaillierten Verläufen finden sich im Kapitel „Variantenbewertungen“
11 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20181a,
1ab
1, 1b
Korridor
Lengau- 1
Korridor
Lengau-2
Siedlung: beengte
1b, 1, 1a Platzverhältnisse
1ab
1b,
1, 1a 1ab
Prognose 2020:
Rückhaltebecken 6.100 Kfz/Werktag
Teichstätt Ost/West L508 (Ri. Schneegattern)
Prognose 2020:
4.300 Kfz/Werktag
Prognose 2020:
9.060 Kfz/Werktag
Rückehaltebecken
Lengau
Abbildung 5: Übersichtskarte,
Verkehrsprognose, techn.
Herausforderungen
Besonderheiten / Herausforderungen Linienführung
Korridor Lengau-1
Im Bereich der Siedlungsflächen zwischen den Ortschaften Heiligenstatt und Teichstätt
herrschen beengte Platzverhältnisse. Die Varianten verlaufen zudem teilweise in Nahelage
zum Schwemmbach / Hochwasserabflussflächen.
Korridor Lengau-2
Die Trasse tangiert das Rückhaltebecken Lengau. Im Bereich der Engstelle zwischen den
beiden Rückhaltebecken in Teichstätt, am Rand der Hochwasser-Überströmbereiche ist
(auch in Kombination mit der Mattigtalbahn) mit einem entsprechenden technischen
Mehraufwand zu rechnen.
12 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20183 Variantenbewertung Raum & Umwelt
3.1 Variante Le1
Abbildung 6: Variante 1
Mensch/Nutzungen
Eingriffserheblichkeit: sehr hoch
Die sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird bedingt durch die massive Störung des
Wohnumfeldbereiches (0-75 m Entfernung zur Trasse) von den durch die Trassenführung
betroffenen Siedlungsflächen im Süden von Munderfing, nördlich von Heiligenstatt und bei
Ameisberg. Baulanderweiterungsflächen laut ÖEK sind nur indirekt betroffen und bleiben zur
Gänze erhalten.
Lärmschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Bei Realisierung der Variante werden trotz Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen
voraussichtlich 13 Wohngebäude über Grenzwert (45-50 dB, nachts) belastet. Bei 10 dieser
Gebäude treten bereits 2005 Grenzwertüberschreitungen auf, wobei es hier durch die
Errichtung von Lärmschutzwänden zu einer insgesamt geringeren Belastung kommen kann.
13 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Natur- und Landschaftsschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Durch die Beanspruchung einer Pufferfläche in Randlage zum Naturschutzgebiet Teichstätt,
die randliche Berührung eines Waldgebietes am Schwemmbach, die Parallellage zum
Bachlauf und die Abriegelung der Terrassenkante vom Talraum des Schwemmbaches, ist im
Teilabschnitt zwischen Km 5,0 und 2,2 von einer hohen Eingriffserheblichkeit auszugehen,
die auf die Gesamtbeurteilung durchschlägt.
Gewässerschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Grundwasser:
Die hohe Eingriffserheblichkeit ergibt sich durch die Lage im Bereich des wasserwirtschaft-
lichen Rahmenplanes Mattig (u.a. Zielvorstellung des vorrangigen Grundwasserschutzes)
bzw. aufgrund lokaler Einzelwasserversorgungsanlagen im gesamten Trassenbereich.
Oberflächengewässer – Hochwasser:
Die ggst. Variante befindet sich im lokalen Überflutungsbereich des Schwemmbaches bis ca.
HQ30. Die lt. Rahmenplan Mattig vorhandene Abfluss- und Retentionsräume sind zu erhalten,
abflussbehindernde Bebauungen hintanzuhalten und örtliche Retentionsraumverluste
gleichwertig zu kompensieren.
Waldschutz
Eingriffserheblichkeit: mittel
Direkter Flächenverlust Der direkte Flächenverbrauch bei der Variante Le-1 beträgt
0,2 Hektar. Die Waldflächenverluste konzentrieren sich zum
größten Teil auf eine Waldfläche bei Teichstätt. Außerdem wird
eine kleine Waldfläche randlich abgeschnitten. 83 % der
betroffenen Waldflächen weisen eine mäßige/mittlere
Sensibilität auf, 17 % der Flächen eine geringe.
Zerschneidung Die gesamte Waldzerschneidung beträgt 120 lfm.
Restflächen3.2 Variante Le-1a
Abbildung 7: Variante Le1a
Mensch/Nutzungen
Eingriffserheblichkeit: sehr hoch
Die sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird bedingt durch die massive Störung des
Wohnumfeldbereiches (0-75 m Entfernung zur Trasse) von den durch die Trassenführung
betroffenen Siedlungsflächen im Süden von Munderfing, nördlich von Heiligenstatt und bei
Ameisberg. Baulanderweiterungsflächen laut ÖEK sind nur indirekt betroffen und bleiben zur
Gänze erhalten.
Lärmschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Bei Realisierung der Variante werden trotz Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen
voraussichtlich 13 Wohngebäude über Grenzwert (45-50 dB, nachts) belastet. Bei 10 dieser
Gebäude treten bereits 2005 Grenzwertüberschreitungen auf, wobei es hier durch die
Errichtung von Lärmschutzwänden zu einer insgesamt geringeren Belastung kommen kann.
15 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Natur- und Landschaftsschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Durch die Weiterführung der Trasse am Bestand im Bereich der Ortschaften Ach/Achenlohe
(in Abänderung zur Variante Le-1) ergeben sich aus Naturschutzsicht positive Aspekte,
indem der Talboden des Schwemmbaches nicht zusätzlich durch eine Trasse belastet wird
und damit eine geringere Rauminanspruchnahme entsteht. Durch die Änderung ergeben
sich jedoch keine markanten Auswirkungen auf die Eingriffserheblichkeit. Die Erheblichkeits-
einstufung „hoch“ wird primär durch die Querung der Wiesenflächen südöstlich des
Rückhaltebeckens Teichstätt begründet und bleibt damit aufrecht.
Gewässerschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Grundwasser siehe Bewertung Le-1
Oberflächengewässer – Hochwasser siehe Bewertung Le-1
Waldschutz
Eingriffserheblichkeit: mittel
Es sind dieselben Waldflächen im gleichen Ausmaß wie bei Variante Le-1 betroffen.
16 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20183.3 Variante Le-1b
Abbildung 8: Variante Le-1b
Mensch/Nutzungen
Eingriffserheblichkeit: sehr hoch
Die sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird bedingt durch die massive Störung des
Wohnumfeldbereiches (0-75 m Entfernung zur Trasse) von den durch die Trassenführung
betroffenen Siedlungsflächen im Süden von Munderfing, nördlich von Heiligenstatt und bei
Ameisberg. Baulanderweiterungsflächen laut ÖEK sind nur indirekt betroffen und bleiben zur
Gänze erhalten.
Lärmschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Bei Realisierung der Variante werden trotz Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen
voraussichtlich 14 Wohngebäude über Grenzwert (45-50 dB, nachts) belastet. Bei 10 dieser
Gebäude treten bereits 2005 Grenzwertüberschreitungen auf, wobei es hier durch die
Errichtung von Lärmschutzwänden zu einer insgesamt geringeren Belastung kommen kann.
17 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Natur- und Landschaftsschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Die Linienführung entspricht weitgehend der Variante Lengau 1. Lediglich im Bereich
Teichstätt schwenkt die Trasse weniger weit in den Talraum des Schwemmbaches aus.
Dennoch werden im Vergleich mit Variante Lengau 1 höherwertige Flächenelemente eines
ehemaligen Feuchtwiesenkomplexes in annähernd gleichem Ausmaß betroffen. Trotz der
Vorteile einer geringeren Waldrandbeanspruchung zwischen Km 3,0 und Km 3,5, eines
deutlich stärkeren Abrückens vom Schwemmbach und des insgesamt geringeren
Landschaftsverbrauches durch eine bestandesnähere Lage ergibt sich im Summe dennoch
eine mit Variante Lengau 1 vergleichbare Eingriffserheblichkeit.
Gewässerschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Grundwasser siehe Bewertung Le-1
Oberflächengewässer - Hochwasser
Die beiden Becken Teichstätt-Ost und -West gewährleisten mit ihrem Gesamtvolumen von
1,4 Mio m3 den Hochwasserschutz für das gesamte flussabwärtige Schwemmbach-Mattigtal.
Eine Reduzierung des Retentionsvolumens durch Straßendämme etc. ist nicht zulässig.
Die Variante 1b verläuft bei Km 4,5 am Rand des Rückstaubereiches des Beckens. Es wäre
im Bereich des Retentions- und Versicherungsbeckens Teichstätt die östliche Variante (Le-1)
vorzuziehen.
Wenn durch die Variante Lengau 1b der Hochwasserretentionsraum < HQ30 beeinträchtigt
wird, wird aus fachlicher Sicht für die gesamte Subvariante Variante 1b mit der Bewertung
„sehr hoch“ zu beurteilen sein. Nur wenn in Absprache mit dem Gewässerbezirk Braunau die
Trassenführung hochwasserverträglich gestaltet werden kann, erscheint eine Abstufung in
die Bewertungsklasse „hoch“ aus fachlicher Sicht gerechtfertigt.
Waldschutz
Eingriffserheblichkeit: gering
Direkter Flächenverlust Der direkte Flächenverbrauch bei der Variante Le-1b beträgt
0,08 Hektar. Die Waldflächenverluste konzentrieren sich auf
eine Waldfläche bei Teichstätt, die am östlichen Rand tangiert
wird. Die betroffenen Waldflächen weisen eine mäßige/mittlere
Sensibilität auf.
Zerschneidung Die gesamte Waldzerschneidung beträgt 45 lfm.
Restflächen3.4 Variante Le-1ab
Abbildung 9: Variante Le-1ab
Mensch/Nutzungen
Eingriffserheblichkeit: sehr hoch
Die sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird bedingt durch die massive Störung des
Wohnumfeldbereiches (0-75 m Entfernung zur Trasse) von den durch die Trassenführung
betroffenen Siedlungsflächen im Süden von Munderfing, nördlich von Heiligenstatt und bei
Ameisberg. Baulanderweiterungsflächen laut ÖEK sind nur indirekt betroffen und bleiben zur
Gänze erhalten.
Lärmschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Bei Realisierung der Variante werden trotz Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen
voraussichtlich 14 Wohngebäude über Grenzwert (45-50 dB, nachts) belastet. Bei 10 dieser
Gebäude treten bereits 2005 Grenzwertüberschreitungen auf, wobei es hier durch die
Errichtung von Lärmschutzwänden zu einer insgesamt geringeren Belastung kommen kann.
19 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Natur- und Landschaftsschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Analog zur Beurteilung der Variante Lengau 1a ergeben sich durch die Weiterführung der
Trasse am Bestand im Bereich der Ortschaften Ach/Achenlohe keine markanten
Auswirkungen auf die Eingriffserheblichkeit, wenngleich die geringere Rauminanspruch-
nahme grundsätzlich positiv zu beurteilen ist.
Gewässerschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Grundwasser siehe Bewertung Le-1
Oberflächengewässer – Hochwasser siehe Bewertung Le-1b
Waldschutz
Eingriffserheblichkeit: gering
Es sind dieselben Waldflächen im gleichen Ausmaß wie bei Variante Le1b betroffen.
20 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20183.5 Variante Le-2
Abbildung 10: Variante Le2
Mensch/Nutzungen
Eingriffserheblichkeit: sehr hoch
Die sehr hohe Eingriffserheblichkeit ergibt sich aufgrund der massiven Störung des
Wohnumfeldbereiches (0 – 75 m Entfernung zur Trasse) von den durch die Trassenführung
betroffenen Siedlungsflächen bei Teichstätt bzw. Ameisberg. Baulanderweiterungsflächen
laut Örtlichem Entwicklungskonzept werden von dieser Trasse nicht berührt.
Lärmschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Bei Realisierung der Variante Le2 werden voraussichtlich 10 Wohngebäude über Grenzwert
(45-50 dB, nachts) belastet, die 2005 nicht von Grenzwertüberschreitungen betroffen waren.
Natur- und Landschaftsschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Als wesentlicher Problempunkt dieser Variante ist die Lage zwischen einem höchstwertigen
aquatischen Lebensraum und Vogellebensraum in Form des Naturschutzgebietes Teichstätt
und einem im Ausbau befindlichen, zusätzlichen Hochwasserbecken hervorzuheben.
21 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Zufolge der extensiven Nutzung ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass sich auch dieses
Hochwasserschutzprojekt nach Fertigstellung zu einem höchstwertigen Lebensraum
(periodische Flutung, zeitweiliges Trockenfallen) entwickeln wird und mit dem bestehenden
Rückhaltebecken einen Lebensraumverbund, insbesondere für Vögel, Amphibien und
Kleinsäuger, bilden wird. Die Einlagerung eines hochleistungsfähigen Verkehrsträgers mit
entsprechender Barrierewirkung ist unter diesen Voraussetzungen als problematisch zu
bewerten. Diese Beurteilung gilt grundsätzlich auch für die Lage der Trasse am
Hochwasserrückhaltebecken Lengau und dem auch hier vorgesehenen Erweiterungsbau.
Gewässerschutz
Eingriffserheblichkeit: hoch
Grundwasser
Die Bewertung entspricht jener der Raumuntersuchung und ist insbesondere durch die Lage
im Bereich des wasserwirtschaftlichen Rahmenplanes Mattig (u.a. Zielvorstellung des
vorrangigen Grundwasserschutzes) begründet. Lokal ist die Wertestufenzuordnung „hoch“
auch durch vorhandene Einzelwasserversorgungsanlagen begründet.
Oberflächengewässer - Hochwasser
Die Variante befindet sich sowohl im Hochwasserabflussbereich des Regenbeckens Lengau
(Hainbach) ab ca. HQ20 – HQ25 sowie im Hochwasserabflussbereich aus dem Hainbach-
gebiet bis HQ30 (bei dzt. Ausbauzustand). Die Bewertungsstufe „hoch“ leitet sich aus der
Wertestufenzuordnung in der Raumbewertung ab, womit darauf hingewiesen wird, dass lt.
Rahmenplan Mattig, vorhandene Abfluss- und Retentionsräume zu erhalten,
abflussbehindernde Bebauungen hintan zu halten sind und örtliche Retentionsraumverluste
gleichwertig zu kompensieren sind.
Waldschutz
Eingriffserheblichkeit: gering
Direkter Flächenverlust Der Waldflächenverbrauch beträgt 0,12 Hektar. Es handelt sich
dabei um eine Waldfläche südlich von Teichstätt, nordöstlich
des neuen Rückhaltebeckens, die in diesem Bereich eine
geringe und mäßige/mittlere Sensibilität aufweist.
Zerschneidung Die gesamte Waldzerschneidung beträgt 50 lfm (Querung
Trassenkante)
Restflächen4 Zielerreichung Verkehr & Technik
Verlagerungspotential
Anhand der Verkehrsspinnen des Verkehrsmodells (Prognose 2020) wurde das
Verlagerungspotential des Durchgangsverkehrs auf die beiden Korridore abgeschätzt.
Dabei wird angenommen, dass bei Realisierung einer Umfahrungsvariante die bestehende
Ortsdurchfahrt von Friedburg durch einen Rückbau in weiterer Folge an Attraktivität für den
Durchgangsverkehr verliert.
Korridor Lengau-1
Unter den Annahmen dass (1) die künftige Belastung am Bestandsnetz rund 500
Kfz/Werktag beträgt da (2) der restliche Verkehr inkl. die Verkehrsströme von Schneegattern
(L508) Richtung Munderfing unter Berücksichtigung verkehrslenkender Maßnahmen gänzlich
auf die Umfahrung verlagert werden können, beträgt das Verlagerungspotential rund 5.600
Kfz/Werktag (ca. 90 %, nördlich von Friedburg). Am Bestand verbleibt nur der Quell-Ziel-
Verkehr Friedburg und Heiligenstatt.
Korridor Lengau-2
Unter den Annahmen dass (1) der gesamte Durchgangsverkehr von Friedburg auf eine
Umfahrung verlagert werden kann und (2) die Verkehrsströme von Schneegattern (L508)
nach Munderfing auf der bestehenden B 147 verbleiben3, beträgt das
Verlagerungspotential rund 4.890 Kfz/Werktag (ca. 80 %, nördlich von Friedburg). Auf der
bestehenden B 147 verbleiben 1.220 Kfz.
Das offensichtlich höhere Verlagerungspotential der Variante Le-1 ist jedoch zu relativieren,
da die Differenz der Verlagerungspotentiale (4.890 zu 5.600 Kfz/Werktag) im Bereich der
Prognoseunschärfe liegt. Das tatsächliche Potential ist von mehreren Parametern abhängig,
wie dem Anschlusspunkt an die bestehende B147, künftigen Erschließungsstraßen,
etwaigen verkehrsleitenden Maßnahmen etc.
Technische Umsetzung
Die Überprüfung der Anlageverhältnisse zeigt, dass alle Trassenvarianten technisch
umsetzbar und in Lage sind, die anfallenden Verkehrsmengen abzuleiten.
Die Varianten im Korridor Lengau-1 können mehr lokalen Verkehr aus den Ortschaften
Friedburg und Heiligenstatt aufnehmen und ermöglichen es, Teichstätt optimal
anzuschließen.
Der Erschließungseffekt der Variante im Korridor Lengau-2 ist im Vergleich deutlich geringer.
Zusätzlich ist hier auf die Problematik (1) der Lage im Nahbereich zum Rückhaltebecken
Lengau in Verbindung mit der niveaufreien Querung der Mattigtalbahn sowie (2) den
beengten Platzverhältnissen zwischen den beiden Rückhaltebecken in Teichstätt entlang der
Mattigtalbahn hinzuweisen.
Die Möglichkeit eines etappenweisen Ausbaues und der damit verbunden sofortigen
Verkehrswirksamkeit der Varianten im Korridor Lengau-1 wird in Bezug auf die Realisierung
einer ca. 9 km langen Trasse als ein zusätzlicher Vorteil bewertet.
Aus verkehrlich-technischer Sicht besteht daher eine Präferenz für die Umsetzung
einer Variante im Korridor Lengau-1
3
abhängig von der Situierung des Absprungspunktes
23 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20185 Wirtschaftlichkeit
Die Korridoruntersuchung setzt in einem frühen Planungsstadium an, in dem die
Ausarbeitung von technischen Details nicht vorgesehen und die Erstellung einer genauen
und seriösen Kostenschätzung nicht möglich ist.
Seitens der Abteilung Straßenneubau und –erhaltung werden daher Grobkostenschätzungen
erstellt, die vor allem dem relativen Vergleich der Kosten dienen. Hiermit werden speziell
jene Positionen identifiziert, die deutliche Unterschiede der Gesamtkosten der einzelnen
Varianten zur Folge haben (z.B. Errichtung eines Tunnels, Ablöse mehrerer Wohngebäude
etc.).
Die tatsächlichen Baukosten können von den – zu einem sehr frühen Zeitpunkt erstellten –
Grobkostenschätzungen abweichen, da der Zeitpunkt der Umsetzung nicht bekannt ist. Die
Kosten sind abhängig von den dann geltenden Gesetzen, dem zukünftigen Stand der
Technik, der Grundpreisentwicklung, den Preisgleitungen, im Rahmen von
Behördenverfahren vorgeschriebene Maßnahmen etc. Diese künftigen Rahmenbedingungen
sind bei Durchführung der Korridoruntersuchung völlig unbekannt und können nur grob
geschätzt werden.
Für den Teilbereich „Mattighofen-Süd“ (Lengau) ist festzustellen, dass aufgrund der
einheitlichen Topographie des Planungsraumes und den nur gering voneinander
abweichenden Längen der Varianten (8,8 – 9,1 km) die Bauwerkskosten minimal variieren.
Sowohl eine bahnparallele als auch eine bestandsnahe Variante bedingen die Errichtung von
zumindest zwei großen Kunstbauwerken (Hainbach- bzw. Schwemmbachbrücke, Brücke
Mattigtalbahn) sowie technische Spezialmaßnahmen mit entsprechend hohem finanziellem
Mehraufwand in folgenden Bereichen:
Korridor Le1: Lage im Hochwasserabflussgebiet bei Teichstätt
Korridor Le2: Lage zwischen den beiden Rückhaltebecken Teichstätt
sowie im Randbereich des Rückhaltebeckens Lengau
Die Kosten für diese Kunstbauwerke bzw. technischen Maßnahmen bewegen sich gemäß
den fachlichen Schätzungen jedoch in einem ähnlichen Rahmen.
Zusammenfassend kann im Vergleich der Varianten anhand der grob geschätzten
Errichtungs- und Grundeinlösekosten auch unter Berücksichtigung der erforderlichen
Kunstbauwerke kein Vorzug abgeleitet werden.
In Hinblick auf die Realisierungswahrscheinlichkeit wird jedoch die Umsetzung einer
Variante im Korridor Lengau-1 aufgrund der Möglichkeit eines etappenweisen
Ausbaus präferiert.
24 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20186 Exkurs: Überprüfung der Grundlagendaten
In Hinblick auf die angestrebte Flächensicherung wurde seitens der beteiligten
Fachdienststellen im Jahr 2016 geprüft, ob sich seit Abschluss der Korridoruntersuchung im
Jahr 2008 solche Änderungen ergeben haben, die eine Adaptierung der vorliegenden
Untersuchungsergebnisse erfordern (Naturraum, Siedlungsentwicklung, rechtliche Vorgaben
etc.). Für das Fachgebiet Natur- und Landschaftsschutz wurden (weitere) ergänzende
Beurteilungen im Jahr 2017 vorgenommen.
Verkehrszahlen
Gemäß den aktuell vorliegenden Daten (2015/2016) beträgt das Verkehrsaufkommen
• auf der B 147 nördlich von Friedburg: rund 5.400 Kfz/Werktag mit einem Anteil von
16% LKW / LKW-ähnlichen Fahrzeugen
ursprüngliche Prognose 2020 (Analysejahr 2005): ca. 6.100 Kfz/Werktag
• auf der B 147 südlich von Friedburg: rund 8.800 Kfz/Werktag mit einem Anteil von
13% LKW / LKW-ähnlichen Fahrzeugen
ursprüngliche Prognose 2020 (Analysejahr 2005): ca. 9.000 Kfz/Werktag
• auf der L 508 östlich von Friedburg: rund 5.900 Kfz/Werktag mit einem Anteil von
11% LKW / LKW-ähnlichen Fahrzeugen
Prognose 2020 (Analysejahr 2005): ca. 4.300 Kfz/Werktag
Das Verlagerungspotential wird für beide Varianten weiterhin auf rund 80-90% geschätzt.
Siedlungsschutz
Seit Abschluss der Korridoruntersuchung 2008 haben
in den Siedlungsbereichen weitere Widmungs- und
Bautätigkeiten stattgefunden.
In der fachlichen Bewertung wurden beide Varianten
mit der (maximalen) Eingriffserheblichkeit „sehr hoch“
bewertet. Die fachliche Bewertung, wie auch die
Präferenz für die bahnparallele Trassenführung,
bleiben aufrecht.
Lärmschutz
Beide Korridore bzw. alle Varianten werden weiterhin mit der Eingriffserheblichkeit „hoch“
bewertet. Da insgesamt weniger Wohngebäude von den voraussichtlichen Grenzwert-
überschreitungen betroffen sind, bleibt auch die Präferenz für bahnparallele Variante Le2
bestehen.
Waldschutz
Keine relevanten Änderungen der rechtlichen oder fachlichen Grundlagen.
25 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Naturschutz
Im Zuge der Trassenplanung wurde darauf geachtet, die Trassen im Korridor Lengau-1
möglichst stark von dem Europaschutzgebiet abzurücken und möglichst lange am Bestand
bzw. bestandsnahe zu führen, um so die Raumbeanspruchung möglichst gering zu halten,
wenngleich auch dadurch maßgebliche Eingriffe nicht wegzudiskutieren sind. Bereits zum
Zeitpunkt der ersten Raumbewertung im Rahmen der Korridoruntersuchung war evident,
dass es sich bei dem östlich des Rückhaltebeckens bzw. Europaschutzgebietes Teichstätt
gelegenen Bereiches um einen hochwertigen, wenngleich teilweise infolge von
Bewirtschaftungsmaßnahmen (Aufforstung mit standortfremden Gehölzen, Anlage von
Fischteichen, Entwässerung) degradierten und durch die Siedlungsentwicklung beeinflussten
Feuchtwiesenkomplex handelt. Diesem Teilbereich wird in einem – von der Gemeinde
Lengau im Jahr 2017 eingebrachten – Fachgutachten der Biotoptyp „Feuchte bis nasse
Fettwiese“ (ausgenommen Teilfläche Streuwiesenbrache) zugeordnet, was vollinhaltlich der
ursprünglichen fachlichen Bewertung, welche sich auch in der Sensibilitätsbewertung
widerfindet, entspricht.
Dennoch wird in einer vergleichenden Betrachtung der beiden Korridore im Sinne der
erforderlichen gesamthaften Betrachtung der natur- und landschaftsschutzfachlichen
Belange die Auffassung vertreten, dass – eine optimierte Detailplanung und bauliche
Umsetzung wird vorausgesetzt – langfristig gesehen die Effekte der Anlage eines
hochleistungsfähigen Verkehrsträgers im Korridor Lengau-2 aufgrund folgender Aspekte als
erheblich nachteiliger zu bewerten sind:
• unmittelbare Randlage zum Europaschutzgebiet und zwangsläufig hohe indirekte
Beeinflussung des Schutzgebietes durch Immissionen
• hohe Trennwirkung zwischen Schutzgebiet und dem unmittelbar westlich gelegenen
Trockenbecken (mit einer sich abzeichnenden Lebensraumfunktion in Ergänzung
zum und in Verbindung mit dem Schutzgebiet stehend)
Die bewilligten und teils bereits erfolgten Erweiterungsmaßnahmen am Trockenbecken
bilden aus heutiger Sicht den Ausgangspunkt für die Entwicklung eines höchstwertigen
Lebensraumes. Die Errichtung einer hochrangigen Straße in diesem Bereich lässt trotz
Vorbelastungen (Mattigtalbahn) negative Auswirkungen auf den neu entstehenden
Lebensraum und das Europaschutzgebiet erwarten. Anders als bei Durchführung der
Korridoruntersuchung – zu diesem Zeitpunkt war lediglich die Absicht zur Erweiterung des
Trockenbeckens bekannt – ist daher inzwischen von der potentiellen Unverträglichkeit
einer Trassenführung im Korridor Le2 auszugehen. In einer vergleichenden Betrachtung der
beiden Korridore besteht aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes daher eine
eindeutige Präferenz für eine Variante im Korridor Lengau-1.
26 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Wasser
Bei einer neuerlichen Prüfung der Varianten in den beiden Korridoren konnten im Fachgebiet
Oberflächengewässer/Teilbereich Hochwasser einerseits durch den Ausbau der
Rückhaltebecken Teichstätt und andererseits durch das Vorliegen genauerer hydraulischer
Hochwasserabflussberechnungen, die im Zuge der Erstellung des Gefahrenzonenplanes für
das Mattigtal durchgeführt wurden, folgende Änderungen festgestellt werden:
• der Bereich nordwestlich des Regenbeckens Lengau (Korridor Lengau-2) liegt nicht mehr
im 100-jährlichen, sondern im 300-jährlichen Hochwasserabflussbereich
• der Bereich zwischen den Ortschaften Achenlohe und Baumgarten liegt nicht mehr im
30-jährlichen, sondern im 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich
• die südliche Querung des Schwemmbachs im Korridor Lengau-1 (Bereich Waldstampfl)
liegt im 10-jährlichen Überflutungsbereich des Schwemmbaches. Hier ist aus Sicht des
Hochwasserschutzes sicherzustellen, dass bei Ausführung dieser Trasse entsprechende
Maßnahmen (wie z.B. Aufständerung, Teilaufständerung, Flutbrücke) ausgeführt werden,
die sicherstellen, dass keine Verschlechterung der Hochwasserabflussverhältnisse für
Ober- und Unterlieger auftritt.
Somit ergibt sich gegenüber 2009 eine leichte Verbesserung der Variante im Korridor
Lengau-2 hinsichtlich der Lage in den einzelnen Hochwasserjährlichkeiten. Die Variante
verläuft allerdings auch weiterhin in langen Teilbereichen im 100- und 300-jährlichen
Hochwasserabflussbereich des Hainbachs. Als weitere sensible Bereiche sind hier die Lage
zwischen den Rückhaltebecken Teichstätt-Ost und -West, wo zwischen dem Damm des
Rückhaltebeckens und der Bahnlinie äußerst beengte Platzverhältnisse für die Errichtung
einer übergeordneten Straße samt Nebenwegen bestehen, sowie die Berührung des
Randbereichs des Regenrückhaltebeckens Lengau im ca. 20-25-jährlichen
Hochwasserabflussbereich anzuführen. In diesen Bereichen ist bei Realisierung einer Trasse
aller Voraussicht nach ein Eingriff an den schutzwasserbaulichen Anlagen notwendig.
Demgegenüber steht innerhalb des Korridors Lengau-1 die Querung des 10-jährlichen
Hochwasserabflussbereiches des Schwemmbaches im Bereich Waldstampfl. Ansonsten
verläuft diese Variante weitgehend außerhalb von Hochwasserabflussgebieten und
beansprucht bedeutend weniger Flächen im Hochwasserabflussbereich.
Da
(1) im Korridor Lengau-2 lange Teilbereiche im 100- und 300-jährlichen Hochwasser-
abflussbereich liegen und sensible Bereiche bei den Rückhaltebecken betroffen sind und
(2) im Korridor Lengau-1, trotz weitgehend hochwasserfreier Lage, die Querung des 10-
jährlichen Hochwasserabflussbereiches des Schwemmbaches erforderlich ist,
werden beide Variantenbündel - analog zur ursprünglichen Bewertung im Jahr 2008 -
weiterhin mit einer hohen Eingriffserheblichkeit bewertet.
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass mit Fertigstellung des Gefahrenzonenplans –
der voraussichtlich im Laufe des Jahres 2018 kommissioniert wird – dieser im Falle der
Realisierung der Varianten entsprechend berücksichtigt werden muss.
27 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20187 Vorzugsvariante
Die Vorzugsvariante resultiert aus der Zusammenführung der Bewertungen der
Fachbereiche (1) Raum und Umwelt, (2) Verkehr und Technik sowie (3) Wirtschaftlichkeit.
1) Raum und Umwelt
In der untenstehenden Tabelle werden die Eingriffserheblichkeiten der Fachgebiete
zusammengeführt. Da die Genehmigungsfähigkeit der Varianten ausschlaggebend ist,
fließen die agrarstrukturellen Bewertungen mangels rechtlicher Verankerung der
landwirtschaftlichen Interessen nicht direkt in die vergleichende Betrachtung ein, werden
aber mitberücksichtigt.
Korridor / Natur- und
Varianten Mensch/ Wasser-
Lärmschutz Landschafts Waldschutz
Nutzungen wirtschaft
schutz
LE-1 sehr hoch hoch hoch P hoch mittel
LE-1a sehr hoch hoch hoch P hoch mittel
LE1
LE-1b sehr hoch hoch hoch P hoch gering
LE-1ab sehr hoch hoch hoch P hoch gering
LE2 LE-2 sehr hoch P hoch P hoch hoch gering
P: Präferenz keine/sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
Eingriffserheblichkeiten inkl. Farbskala
Im Fachgebiet Mensch/Siedlung werden alle Varianten mit der Eingriffserheblichkeit „sehr
hoch“ bewertet, wobei eine Präferenz für den bahnparallelen Korridor besteht, da hier trotz
negativer räumlicher Effekte (Zerschneidungswirkung, Flächenverbrauch) ein größerer
Abstand zu den Hauptsiedlungsgebieten besteht.
Im Fachgebiet Lärm besteht eine Präferenz für den bahnparallelen Korridor, da trotz
geringer Vorbelastung insgesamt weniger Gebäude von Grenzwertüberschreitungen
betroffen sind.
Im Fachgebiet Natur- und Landschaftsschutz besteht eine eindeutige Präferenz für den
bestandsnahen Korridor bzw. wäre gemäß der ergänzenden fachlichen Bewertung aus dem
Jahr 2017 – die die nachteiligen Auswirkungen einer Trasse auf das als (künftig)
höchstwertigen Lebensraum einzustufende Rückhaltebecken beschreibt – die Variante LE2
inzwischen in einer höheren Erheblichkeitsstufe einzuordnen.
Im Fachgebiet Wasser (Grund-/Trinkwasser, Oberflächengewässer) werden aufgrund
mehrerer Querungen von bzw. Berührungspunkte mit Hochwasserabflussflächen (inkl.
Rückhaltebecken) alle Varianten mit der Eingriffserheblichkeit „hoch“ bewertet.
Die Eingriffserheblichkeiten im Fachgebiet Waldschutz sind insgesamt niedriger als in den
anderen Fachbereichen. Die Eingriffserheblichkeit „mittel“ (Varianten 1, 1a) ergibt sich aus
der Betroffenheit eines Waldstücks bei Teichstätt.
Aus agrarfachlicher Sicht wird grundsätzlich festgestellt, dass die Entstehung von Rest-
flächen mit Maßnahmen der Bodenordnung nicht verhindert werden kann, eine Milderung
der Beeinträchtigung aber in Bezug auf die Durchschneidungseffekte möglich ist.
Aufgrund derselben Anzahl an „hoch“ und „sehr hoch“-Bewertungen kann im Fachbereich
Raum & Umwelt keine Vorzugsvariante identifiziert werden. Es bestehen zwei Präferenzen
für den Korridor Le2 (Mensch-Nutzungen, Lärmschutz) und eine nunmehr sehr eindeutige
Präferenz für den Korridor Le1 (Natur- und Landschaftsschutz).
28 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/20182) Verkehr & Technik
Im Fachbereich Verkehr und Technik besteht eine Präferenz für den Korridor Lengau-1.
3) Wirtschaftlichkeit
Anhand des Vergleichs der Grobkostenschätzungen kann kein Vorzug abgeleitet werden.
Aufgrund der höheren Realisierungswahrscheinlichkeit durch die Möglichkeit der
etappenweisen Errichtung besteht eine Präferenz für den Korridor Lengau-1.
29 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Gesamtfachliche Empfehlung
Eine erneute Überprüfung der Ergebnisse im Jahr 2016 hat ergeben, dass keine
Adaptierung der fachlichen Bewertungen erforderlich ist und die im vorliegenden Bericht
beschriebenen Bewertungen und fachlichen Präferenzen weiterhin Gültigkeit besitzen. In der
Zusammenschau der Bewertungen der Fachbereiche Raum & Umwelt, Verkehr & Technik
und Wirtschaftlichkeit wird aus fachlicher Sicht
die Sicherung des bestandsnahen Korridors Lengau-1 für die Umsetzung einer der
möglichen Varianten (Le1, Le1a, Le1b, Le1ab) empfohlen.
Anschluss an Umfahrung
Mattighofen-Munderfing
(1. Bauabschnitt)
Abbildung 11: Vorzugskorridor Lengau-1
Mögliche Trassenvarianten und empfohlener Freihaltebereich (grün schraffiert)
Der exakte Verlauf der künftigen Variante inkl. Absprungspunkt von der bestehenden B147
wird zu einem späteren Zeitpunkt bzw. in den künftigen Verfahren festzustellen sein.
30 | Abschlussbericht KU - Abschnitt B147-Süd, 01/2018Sie können auch lesen