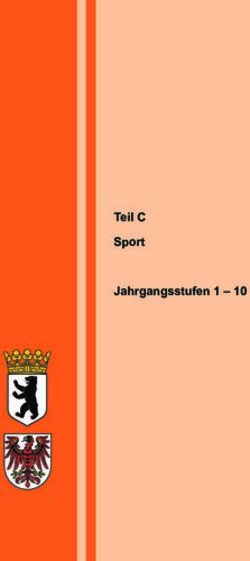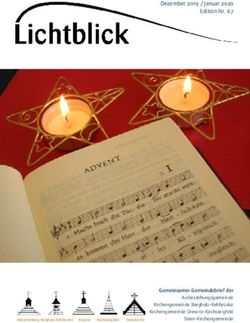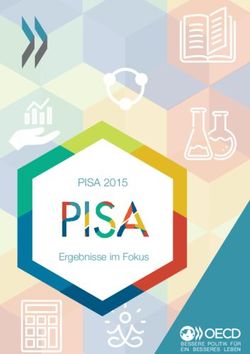Kurzbericht zum Ergebnis der Nachvisitation an der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kurzbericht zum Ergebnis der Nachvisitation an der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule
Friedrich Gesamtschule in Potsdam
Schulbesuch 17.09.-19.09.2013
Schulträger Stadt Potsdam
Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel
Kurzbericht
zbericht Schulvisitation von Schulvisitation Brandenburg steht unter einer
Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung
Namensnennung KeineBearbeitung 3.0 Unported Lizenz.
Lizenz
Herausgeber:
Schulvisitation des Landes Brandenburg beim
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg
Mail: geschäftsstelle@schulvisitation.brandenburg.de
http://www.bildungsserver.berlin
http://www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schulvisitation.html
Seite 2Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
1 Vorwort
Im Land Brandenburg werden alle Schulen in öffentlicher Trägerschaft innerhalb von vier bis
sechs Jahren extern evaluiert. Nachdem von 2005 bis 2010 die Schulen erstmalig visitiert
wurden, begannen 2011 die Zweitvisitationen. Damit treten die Schulen in einen Kreislauf
regelmäßiger externer Rechenschaftslegung ein, in dem über innerschulische Erfolge zu
verbindlichen landesweiten Qualitätserwartungen berichtet wird. Grundlage für die Ermittlung
der Schulqualität bilden Qualitätsmerkmale und -kriterien, die vom Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport im „Orientierungsrahmen Schulqualität in Brandenburg“ festgelegt worden
sind.1
Die Schulen haben in den vergangenen Jahren vielfach positive Rückmeldungen zu den
Visitationsbesuchen und Anregungen zu deren Weiterentwicklung gegeben. Nach
systematischer Auswertung erfolgten Modifizierungen einzelner Verfahrensschritte, die u. a.
den Schulen mehr Möglichkeiten eigener Schwerpunktsetzungen bieten.
Die Qualitätsanalyse der Schule erfolgt wie bisher auf der Grundlage eines standardisierten
Ablaufs und verlässlicher methodischer Instrumente. Einschätzungen und Bewertungen
wurden auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse sowie aus
Unterrichtsbeobachtungen, Befragungen und Interviews getroffen. Der Bericht bezieht die
Ergebnisse der Erstvisitation mit ein. Die Bewertungen des Berichts sind aufgrund
veränderter Wichtungen einiger Kriterien sowie neu hinzu genommener Profilmerkmale nur
eingeschränkt mit den Ergebnissen aus der ersten Visitationsrunde vergleichbar. Schule,
Schulbehörde und Schulträger haben die Möglichkeit, neue Impulse für die pädagogische
Schulentwicklung zu gewinnen.
Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse des Berichts von möglichst
vielen Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern zur Kenntnis
genommen und diskutiert werden. Die Langversion des Berichts zur Schulvisitation an der
Schule kann mit Zustimmung der Schulleitung in der Schule eingesehen werden. Die Schule
darf ihren jeweiligen Schulvisitationsbericht veröffentlichen. Die Entscheidung darüber trifft
die Schulkonferenz gemäß § 91 Absatz 1 Satz 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes im
Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter gewährleistet, dass durch die Veröffentlichung keine Persönlichkeitsrechte
verletzt werden. Bei der Veröffentlichung dürfen keine inhaltlichen Veränderungen an dem
Bericht vorgenommen werden. Kürzungen sind zulässig, wenn dadurch die Gesamtaussage
des Berichts nicht beeinflusst wird.2
In dem vorliegenden Kurzbericht werden das Qualitäts- und Unterrichtsprofil der Schule mit
Ausnahme der Profilmerkmale 15 und 16 dargestellt, es sei denn, die Schulleiterin oder der
Schulleiter erklären ihr Einvernehmen auch zur Veröffentlichung der wesentlichen
Ergebnisse der Profilmerkmale 15 und 16. Die Schulkonferenz hat die Möglichkeit, den
Bericht zu kommentieren.3
Auf der Grundlage des Nachvisitationsberichts sollen an der Schule weitere Aktivitäten zur
Sicherung und Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität erfolgen und deren
Wirksamkeit überprüft werden.
1
Der Orientierungsrahmen „Schulqualität in Brandenburg“ sowie das „Handbuch Schulvisitation“
können auf www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schulvisitation.html eingesehen werden.
2
VV-Schulvisitation – Abschnitt 6, Absatz 1.
3
VV-Schulvisitation – Abschnitt 6, Absatz 2.
Seite 3Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
2 Grundlagen der Schulvisitation
2.1 Methodische Instrumente
Die Qualitätsanalyse der Schule erfolgt auf der Grundlage standardisierter methodischer
Instrumente. Einschätzungen und Bewertungen werden auf der Basis von Erkenntnissen der
Dokumentenanalyse sowie Unterrichtsbeobachtungen, schriftlichen Befragungen und
Interviews getroffen. Das bedeutet, dass in der Regel mehrere Erkenntnisquellen in die
Ermittlung der Bewertung einfließen, um die Multiperspektivität bei den
Entscheidungsfindungen abzusichern. Für die Datenanalyse ist ein Kernbestand von
Dokumenten und Datenbeständen definiert, aus denen Schwerpunkte und Ergebnisse der
Arbeit der Schule ersichtlich werden. Während der Visitation werden halbstandardisierte
Interviews mit allen Beteiligten der Schule auf der Grundlage von Gesprächsleitfäden
geführt. Alle aus den benannten Quellen gewonnenen Erkenntnisse werden zueinander in
Beziehung gesetzt und führen zu der im Langprofil dargestellten Wertung.
Dokumentenanalyse
Zur inhaltlichen Vorbereitung der Visitation wurden neben dem Schulporträt unter
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de und der Homepage der Friedrich-Wilhelm-von-
Steuben-Gesamtschule unter www.steuben-gesamtschule.de die im Schulreport vorgelegten
Dokumente gesichtet. Außerdem erfolgte vor Ort die Einsichtnahme in weitere schulische
Unterlagen.
Standardisierte Befragungen der Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
Um die Sichtweisen aller Personengruppen der Schulgemeinschaft in die Einschätzungen
einfließen zu lassen, werden diese vor der Visitation anhand verschiedener Fragebogen
erfasst. Die Befragungsergebnisse sind für die Schülerinnen und Schüler sowie die
Lehrkräfte repräsentativ. Sie werden zur Bewertung der Schule herangezogen, da die
erforderlichen Rücklaufquoten vorliegen (Eltern mindestens 60 %, Lehrkräfte sowie
Schülerinnen und Schüler mindestens 80 %).
Angaben zu den Befragungen der Schule
Personengruppe Befragte absolut Rücklauf absolut Rücklauf in %
Schülerinnen und Schüler 221 185 84
Eltern 205 106 52
Lehrkräfte 54 51 94
Halbstandardisierte Befragungen der Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrkräfte und Schulleitung in den Interviews
Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden in Gruppen interviewt. Im
telefonischen Vorgespräch erfolgten mit dem Schulleiter Vereinbarungen zur
Zusammensetzung der Personengruppen.
Unterrichtsbeobachtungen
Die Unterrichtsbeobachtungen werden durch das Visitationsteam festgelegt. Sie umfassen
mindestens die Hälfte der unterrichtenden Lehrkräfte aus möglichst vielen Fachbereichen
und Jahrgangsstufen bzw. Klassen.
Daten zu den Unterrichtsbesuchen
Anzahl der 20-minütigen Unterrichtsbeobachtungen 46
Anzahl der beobachteten Lehrkräfte/von anwesenden Lehrkräften 46/52
Anzahl der beobachteten Unterrichtsfächer 18
Seite 4Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
Anfang der Unterrichtsstunde Mitte der Unterrichtsstunde Ende der Unterrichtsstunde
15 21 10
Größe der Lerngruppen in den beobachteten UnterrichtssequenzenKurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
3 Ausgangsposition der Schule
Die Stadt Potsdam ist Schulträger der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule. Sie
bietet für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 Ganztagsangebote in gebundener Form an. Neben
speziellen Förderangeboten und der Hausaufgabenbetreuung können die Schülerinnen und
Schüler verschiedene Arbeitsgemeinschaften nutzen. Seit 2009 trägt die Schule den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Im Rahmen dieser Verpflichtung finden
jährlich verschiedene Aktionen an der Gesamtschule statt, u. a. eine themengebundene
Projektwoche. Des Weiteren wird das Profil der Schule durch die Integration von
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache bestimmt. An der Schule lernen
insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in einer
Integrationsklasse. Damit wird die maximale aufzunehmende Anzahl von 14 Schülerinnen
und Schülern in dieser Klasse deutlich überschritten. Die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-
Gesamtschule erhielt im Jahr 2013 mit dem Projekt "Unterricht von Schülern mit
Migrationshintergrund in der Vorbereitungsgruppe zum Erlernen der deutschen Sprache und
der Vorbereitung auf die Teilnahme am Regelunterricht in weiterführenden Schulen" den
Integrationspreis der Stadt Potsdam.
Veränderungen seit der letzten Schulvisitation finden sich im Wesentlichen in der
Medienausstattung der Schule. Neben der Neuausstattung der Informatikräume erhielten die
einzelnen Fachbereiche Lerninseln und Beamer. Die Finanzierung erfolgte über das EFRE6-
Förderprogramm "Medienentwicklungsplanung an Schulen mit gymnasialer Oberstufe".
Darüber hinaus haben sich die Standortbedingungen an der Gesamtschule nicht verändert.
Der Schulträger schätzt den Zustand des Gebäudes nach wie vor als gut und den
Sanierungsbedarf als mittel ein. In den letzten fünf Jahren wurden laut Schulträgerauskunft7
keine Investitionen getätigt. In der mittelfristigen Investitionsplanung sollen für
Brandschutzmaßnahmen 250.000 € eingesetzt werden.
Gemäß der gültigen Schulentwicklungsplanung ist der Bestand der Schule für die nächsten
Jahre gesichert. Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung bezeichnet der Schulträger als
sachlich und beständig. Nach Aussage der Schulleitung ist das Einzugsgebiet teilweise ein
sozialer Brennpunkt.
Im Schuljahr 2013/2014 lernen 703 Schülerinnen und Schüler an der Schule. Die
Gesamtschülerzahl ist damit um ca. 10 % seit dem Schuljahr 2011/2012 gestiegen. In den
Jahrgangsstufen 8 und 10 wird die Schule fünfzügig, in den Jahrgangsstufen 7 und 9
sechszügig organisiert. Auf Grund der an der Schule geführten Integrationsklassen variiert
die Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse stark. Die Klassenfrequenzen
schwanken zwischen 16 Schülerinnen und Schülern in einer Klasse der Jahrgangsstufe 7 bis
30 in einer Klasse der Jahrgangsstufe 9. Es lernen insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten „emotionale und
soziale Entwicklung“, „körperliche und motorische Entwicklung“, „Lernen“, „Sehen“ und
„Hören“ im gemeinsamen Unterricht. Darüber hinaus werden Schülerinnen und Schüler im
Bereich „Autismus“ gefördert. Damit liegt der Anteil über dem Durchschnitt des Landes
Brandenburg für diese Schulform. Insgesamt werden an der Gesamtschule 37 Schülerinnen
und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache beschult.
Im Schuljahr 2013/2014 unterrichten 62 Stammlehrkräfte an der Schule, darunter eine
Sonderpädagogin und ein Sonderpädagoge. Eine Lehrkraft ist stundenweise an einer
anderen Schule tätig. Die Zusammensetzung des Kollegiums ist relativ instabil. Nach dem
Schuljahr 2012/2013 verließen insgesamt sieben Lehrkräfte die Schule, zwölf neue
Lehrkräfte kamen an die Schule. Es werden zurzeit fünf Lehramtskandidatinnen und -
kandidaten betreut.
Herr Brandt leitete die Gesamtschule seit dem Jahr 2002 zunächst kommissarisch, seit 2010
ist er in seinem Amt als Schulleiter bestätigt. Seit dem Jahr 2008 wird er in seiner Tätigkeit
6
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung.
7
Schulträgerauskunft vom 03.09.2013.
Seite 6Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
durch die stellvertretende Schulleiterin Frau Rintorf und seit 2002 durch die
Oberstufenkoordinatorin Frau Rau unterstützt. Zum weiteren Schulpersonal gehören eine
Schulsachbearbeiterin, ein Hausmeister und eine Schulsozialarbeiterin.
Seite 7Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
4 Beschreibung der Qualitätsbereiche
4.1 Qualitätsprofil (Kurzprofil)
Profilmerkmal (Kurzform) W ertung 4 3 2 1 Kriterium (Kurzform)
QB 1: Ergebnisse der Schule
1. Kom petenzen der Schüler/-innen 1.1 Ergebnis s e Vergleichs arbeiten
verbale W ertung 1.2 Ergebnis s e zentrale Prüfungen
1.3 Leis tungen in anderen Kom petenzfeldern
2. Bildungs weg und Schulabs chlüs s e 2.1 Bildungs gangem pfehlungen
verbale W ertung 2.2 Abs chlüs s e bzgl. Bildungs gangem pf.
2.3 Verzögertes Erreichen der Abs chlüs s e
3. Zufriedenheit 3.1 Schülerzufriedenheit
verbale W ertung 3.2 Elternzufriedenheit
3.3 Lehrkräftezufriedenheit
3.4 Zufriedenheit m it Ganztags angebot
QB 2: Lehren und Lernen – Unterricht
4. Schuleigene Lehrpläne 3 3 3 3 4.1 Erarbeitung von Lehrplänen
3 3 3 3 4.2 Abgebildete Kom petenzbereiche
2 2 2 2 2 4.3 Fächerverb./fachübergr. Elem ente
3 3 3 3 4.4 Trans parente Ziele
2 2 2 2 4.5 Medienkom petenz
UB FB
5. Klas s enführung 2,7 2,8 5.1 Effektive Nutzung der Unterrichts zeit
2,6 5.2 Angem es s enes Unterrichts tem po
3 2,6 2,8 5.3 Fes tes Regels ys tem etabliert
2,7 5.4 Überblick der Lehrkraft über S.-handeln
2,9 2,9 5.5 Angem es s ener Um gang m it Störungen
6. Aktivierung und Selbs tregulation 2,8 3,1 6.1 Anregungen zu aktiver Teilnahm e
2,4 6.2 Selbs torganis ierte Schülerarbeit
2,5
2 2,2 6.3 Selbs tges teuerte Schülerarbeit
2,4 2,9 6.4 Reflexion der Lernprozes s e
7. Strukturiertheit und Methodenvielfalt 2,7 3,0 7.1 Klare Struktur des Unterrichts
2,8 3,0 7.2 Deutliche Form ulierungen der Lehrkräfte
3 2,4 2,7 7.3 Klare Lernziele
2,9 2,7 7.4 Trans parenter Unterrichts ablauf
2,8 7.5 Angem . Eins atz Unterrichts m ethoden
3,2 7.6 Alltags -/Berufs bezug der Unterrichts inhalte
8. Klas s enklim a 2,7 2,7 8.1 Res pektvoller Um gang der Schüler/-innen
2,9 3,0 8.2 Werts chätz. Um gangs ton der Lehrkräfte
3 2,6 3,2 8.3 Pos itive Erwartungen an Schüler/-innen
2,4 2,9 8.4. Kons truktiver Um gang m it Schülerfehlern
9. Individ. Förderung und Differenzierung 1,6 9.1 Berücks . individueller Lernvoraus s etzungen
2,4
1,7 9.2 Förd. ents pr. individ. Lernvoraus s etzungen
2 2,2 3,0 9.3 Vers tärkung individueller Lernforts chritte
1,7 2,9 9.4 Differenzierte Leis tungs rückm eldungen
10. Förderung in der Schule 3 3 3 3 10.1 Vereinbarungen zur Förderung
2 2 2 2 10.2 Diagnos tikkom petenzen
2 2 2 2 2 10.3 Lernentwicklungs beobachtung
3 3 3 3 10.4 Individuelle Leis tungs rückm eldungen
3 3 3 3 10.5 Zus . s chul. Angebote zur Unters tützung
11. Leis tungs bewertung 3 3 3 3 11.1 Bes chlos s ene Grunds ätze der Bewertung
2 2 2 2 11.2 Um gang m it Haus aufgaben
3 3 3 3 3 11.3 Trans parenz gegenüber den Eltern
3 3 3 3 11.4 Trans parenz gegenüber Schüler/-innen
Die angegebenen Dezimalzahlen in den Profilmerkmalen 5 bis 9 stellen die arithmetischen Mittelwerte der Bewer-
tungen aller Unterrichtsbeobachtungen (UB) und der Ergebnisse der Schülerfragebögen (FB) dar.
Seite 8Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
Profilmerkmal (Kurzform) W ertung 4 3 2 1 Kriterium (Kurzform)
QB 3: Schulkultur
12. Berufs - und Studienorientierung 3 3 3 3 12.1 Konzept zur Berufs -/Studienorientierung
4 4 4 4 12.2 Entwicklung von Berufs wahlkom petenzen
4 3 3 3 3 12.3 Vorbereitung auf berufliche Übergänge
4 4 4 4 12.4 Vorbereitung auf ein Studium
4 4 4 4 12.5 Koop. m it Partnern Berufs -/Studienorient.
13. Schulleben 3 3 3 3 13.1 Trans parenz über s chul. Entwicklungen
2 2 2 2 13.2 Aktive Mitwirkung der Schüler/-innen
2 2 2 2 13.3 Aktive Mitwirkung der Eltern
2 3 3 3 3 13.4 Förderung der Beteiligungen
2 2 2 2 13.5 Einbeziehung bes onderer Kom petenzen
2 2 2 2 13.6 Aktivitäten zur Identifikation
0 0 0 0 13.7 Beteiligung beruflicher Partner (nur OSZ)
14. Kooperations beziehungen 2 2 2 2 14.1 Regionale Schulkooperationen
3 3 3 3 14.2 Koop. m it „aufnehm enden“ Einrichtungen
3 3 3 3 3 14.3 Koop. m it „abgebenden“ Einrichtungen
2 2 2 2 14.4 Überregionale Schulpartners chaften
4 4 4 4 14.5 Kooperation m it externen Partnern
QB 4: Führung/Schulmanagement
15. Führungs verantwortung Schulleiter/-in 15.1 Trans parenz eigener Ziele und Erwartung.
15.2 Rolle als Führungs kraft
15.3 Meinungs bildung und Beteiligungs rechte
15.4 Überzeugung, Unters tützg., Anerkennung
15.5 Förderung des Zus am m enwirkens
15.6 Handeln der Abteilungs leiter/-innen (OSZ)
16. Aufbau Qualitäts m anagem ent 16.1 Forts chreibung Schulprogram m
16.2 Qualitäts vers tändnis Unterricht
16.3 Sicherung der Unterrichts qualität
16.4 Kollegiale Unterrichts bes uche befördert
16.5 Netzwerkarbeit
16.6 Inners chulis che Dokum entenlage
17. Schul- und Unterrichts organis ation 3 3 3 3 17.1 Grunds ätze zur Organis ation
2 2 2 2 17.2 Beteiligung der Grem ien
3 3 3 3 3 17.3 Vertretungs organis ation
0 0 0 0 17.4 Berücks . Partner berufl. Bildung (OSZ)
QB 5: Professionalität der Lehrkräfte
18. Stärkung der Profes s . und Team arb. 3 3 3 3 18.1 Abges tim m tes Fortbildungs konzept
3 3 3 3 18.2 Nutzung externer Berater/-innen
2 3 3 3 3 18.3 Abs tim m ung zu fachl./didakt. Inhalten
2 2 2 2 18.4 Kollegiale Unterrichts bes uche
2 2 2 2 18.5 Team arbeit im Kollegium
3 3 3 3 18.6 Einarbeitung neuer Lehrkräfte
QB 6: Ziele und Strategien der Qualitätsentw icklung
19. Evaluation 1 1 1 1 19.1 Evaluation der Unterrichts qualität
2 2 2 2 19.2 Evaluation der außers chul. Angebote
2 3 3 3 3 19.3 Aus wertung von Lernergebnis s en
1 1 1 1 19.4 Feedbackkultur in der Schule
2 2 2 2 19.5 Interne Schlus s folg. und Maßnahm en
Seite 9Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
4.2 Ergebnisse der Schule
Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler (z. B. zentrale Prüfungen der Jahrgangsstufe
10, schriftliches Abitur, erreichter Schulabschluss, die Anzahl der Wiederholer und die
Teilnahme an Wettbewerben) sind im Schulporträt der Schule einsehbar. Unter folgendem
Link wird das Schulporträt der Schule geöffnet. In der „linken“ Menüzeile lassen sich unter
dem Stichwort Schülerleistungen die o. g. Daten aufrufen.
http://www.bildung-
brandenburg.de/schulportraets/index.php?id=stammdaten&schuljahr=2013&schulnr=113049
&cHash=4fc4ab192a93d1361112fc016fbedf71
Im folgenden Abschnitt werden Ausführungen zur Zufriedenheit der Schulgemeinschaft
mit den Bedingungen und Entwicklungen an der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-
Gesamtschule dargestellt. Diese Aussagen beziehen sich im Wesentlichen auf die
Ergebnisse der schriftlichen Befragung sowie die Aussagen in den Interviews.
Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind mit ihrer Schule weitgehend zufrieden.
Die Schülerinnen und Schüler hoben hervor, dass sie sich im Schulalltag akzeptiert und
wohl-fühlen. Sie werden von den Lehrkräften ernst genommen und erhalten Unterstützung
bei Problemen - auch von der Schulsozialarbeiterin. Die Zufriedenheit der Schülerinnen und
Schüler begründet sich darüber hinaus mit dem vielfältigen Ganztagsangebot und der gut
organisierten langfristigen Berufsvorbereitung. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
betonten, dass alle Jugendlichen hier an der Gesamtschule ihre - teilweise auch zweite und
dritte - Chance zum Lernen und zur Bildung erhalten. Schulische Angebote zur Fortbildung,
die Eltern für Eltern anbieten, werden von diesen begrüßt, wenngleich sie bedauern, dass
sich hier insgesamt wenige Eltern engagieren. Ähnlich wie die Schülerinnen und Schüler
beschrieben die Eltern, dass es einzelne, sehr engagierte, Lehrkräfte gibt, aber auch große
Unterschiede im Handeln der Lehrkräfte bestehen.
Die Lehrkräfte führen ihre Zufriedenheit u. a. darauf zurück, dass sie sich im Kollegium
wohlfühlen und die gegenseitige Unterstützung, insbesondere in den Jahrgangsstufenteams,
gegeben ist. Hier sehen die Lehrerinnen und Lehrer wesentliche Veränderungen seit der
letzten Schulvisitation, sodass eine kontinuierlichere Arbeit aus ihrer Sicht gegeben ist. Die
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern der eigenen Klasse macht die Lehrkräfte
zufrieden. Sie erhalten hier Dankbarkeit und Wertschätzung für ihre Arbeit. Kritisch äußerten
sich die Lehrerinnen und Lehrer, dass sich nicht alle Kolleginnen und Kollegen an
Vereinbarungen halten und damit die Voraussetzungen für ein einheitliches Handeln im
Kollegium nicht gegeben sind. Sie vermissen des Weiteren eine klare Struktur in der Schule,
wie bspw. die rechtzeitige Ausgabe des Terminplans. Weitere Schwierigkeiten in ihrer Arbeit
sehen die Lehrkräfte durch die massiven Kürzungen im Stundenbereich - gerade auch für
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Den Einsatz der
Sonderpädagogin bzw. des Sonderpädagogen als Klassenlehrkraft beschrieben die
Lehrkräfte als schwierig für die Wahrnehmung der eigentlichen und umfangreichen Aufgaben
der Sonderpädagogen an der Schule.
Seite 10Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
4.3 Lehren und Lernen – Unterricht
4.3.1 Quantitative Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen
Im Rahmen der Unterrichtsbeobachtungen werden die Ergebnisse zu den vorherrschenden
Unterrichts- und Sozialformen erfasst.
Verteilung der vorwiegenden Unterrichtsformen in den gesehenen Unterrichtsbeobachtungen in %
Lehrer- Unterrichts- Schüler- Schüler- Stationen-
Freiarbeit Planarbeit Projekt Experiment
vortrag gespräch arbeit vortrag lernen
9 35 50 0 0 0 0 0 6
Verteilung der vorwiegenden Sozialformen in den gesehenen Unterrichtsbeobachtungen in %
Frontalunterricht Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit
44 24 17 15
Für die Bewertung der Profilmerkmale 5 bis 9 werden die Ergebnisse aus den
Unterrichtsbeobachtungen und der Online-Befragung der Schülerinnen und Schüler
herangezogen. In den Fragebogen der Schülerinnen und Schüler werden zu den meisten
Kriterien der Profilmerkmale 5 bis 9 vergleichbare Fragen gestellt. Die Ergebnisse sind
teilweise in Gruppen zu den entsprechenden Kriterien zusammengefasst und im Kurzprofil
(vgl. S. 5f.) gesondert ausgewiesen. Die abschließende Wertung der Profilmerkmale 5 bis 9
ergibt sich aus einem festgelegten Verhältnis der im Unterricht getroffenen Bewertung der
beobachteten Kriterien und den Ergebnissen der entsprechenden Fragebogenergebnisse.
Die folgende Tabelle enthält die 23 bewerteten Kriterien in den Unterrichtsbeobachtungen
und erklärt die Angaben in den folgenden Diagrammen.
5. Der Unterricht ist zweckmäßig organisiert, die Lehr- und Lernzeit wird intensiv genutzt.
5.1 Die Unterrichtszeit wird effektiv genutzt.
5.2 Das Unterrichtstempo ist angemessen.
5.3 Der Unterricht erfolgt auf der Basis eines festen Regelsystems.
5.4 Die Lehrkraft behält den Überblick über unterrichtsbezogene und unterrichtsfremde Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler.
5.5 Mit Störungen wird angemessen und effektiv umgegangen.
6. Die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen im Unterricht einen aktiven Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.
6.1 Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt/angeleitet, den Unterricht aktiv mitzugestalten oder sie gestalten den Unterricht aktiv mit.
6.2 Die Schülerinnen und Schüler arbeiten (zeitweise) selbstorganisiert an vorgegebenen Aufgaben.
6.3 Die Schülerinnen und Schüler arbeiten (zeitweise) selbstgesteuert.
6.4 Die Reflexion eigener Lernprozesse ist Bestandteil des Unterrichtes.
7. Der Unterricht ist strukturiert und methodisch vielfältig.
7.1 Dem Unterricht liegt eine klare Struktur zugrunde.
7.2 Die Lehrkräfte formulieren die Arbeitsaufträge und Erklärungen klar, verständlich und präzise.
7.3 Die inhaltlichen und methodischen Lernziele der Unterrichtsstunde werden thematisiert oder sind den Schülerinnen und Schülern bekannt.
7.4 Die Schülerinnen und Schüler sind über den geplanten Unterrichtsablauf und die einzelnen Unterrichtsschritte informiert.
7.5 Die Unterrichtsmethoden werden angemessen eingesetzt.
7.6 Die Lehrkräfte stellen einen klaren Bezug zur Alltags- und/oder Berufswelt her.
8. Das pädagogische Verhalten der Lehrerinnen und Lehrer bildet die Grundlage für ein förderliches Klassen- und Arbeitsklima.
8.1 Die Schülerinnen und Schüler gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um.
8.2 Der Umgangston zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern ist wertschätzend und respektvoll.
8.3 Die Lehrkraft äußert positive Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler.
8.4 Mit Schülerfehlern wird konstruktiv umgegangen.
9. Das Handeln der Lehrkräfte ist auf individuelle Förderung und Differenzierung ausgerichtet
9.1 Individuelle Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler werden in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt.
9.2 Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen gefördert.
9.3 Die Lehrkräfte verstärken individuelle Lernfortschritte und/oder Verhaltensweisen durch Lob und Ermutigung.
9.4 Schülerinnen und Schüler erhalten differenzierte Leistungsrückmeldungen.
Seite 11Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
Das folgende Diagramm stellt die durchschnittlichen Wertungen aus den
Unterrichtsbeobachtungen der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule dar. Sie sind
ebenfalls im Qualitätsprofil ausgewiesen.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4
Durchschnittliche Wertungen der Unterrichtsbeobachtungen (Mittelwerte)
Diese Mittelwerte werden hier den Spannweiten8 der Ergebnisse aller Unterrichts-
beobachtungen seit Januar 2011 der Vergleichsgruppe (Gymnasien und Gesamtschulen) im
Land gegenüber gestellt.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4
BB - obere Grenze Mittelwerte BB - untere Grenze Mittelwerte Schule
Vergleich der Wertungen mit den Spannweiten aller Unterrichtsbeobachtungen der Vergleichsgruppe
8
Innerhalb der durch die obere und untere Grenze definierten Spannweite der Unterrichtskriterien
liegen die Ergebnisse von 80 % aller Unterrichtsbeobachtungen der Vergleichsgruppe (2065
Unterrichtsbeobachtungen – Stand Juli 2013).
Seite 12Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
4.3.2 Qualitative Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen
Die im Text folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die
Wahrnehmungen des Visitationsteams in den besuchten Unterrichtssequenzen.
Insgesamt kennzeichnete den Unterricht eine überwiegend positive und von gegenseitiger
Wertschätzung geprägte Atmosphäre zwischen Lehrenden und Lernenden. Zumeist zeigten
die Lehrkräfte sich ihrer Lerngruppe gegenüber zugewandt. In mehreren Fällen hatten sie die
Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler aber nicht ausreichend im Blick. In einigen
Sequenzen agierten die Schülerinnen und Schüler untereinander aggressiv, ließen einander
nicht ausreden, riefen dazwischen und waren in einzelnen Situationen nicht bereit, sich
gegenseitig zu unterstützen. Grundlegende Verhaltens- und Umgangsregeln waren in diesen
Sequenzen kaum erkennbar. Auf diese und andere Störungen reagierten Lehrkräfte
weitgehend professionell und angemessen. Ein solches Vorgehen gelang nicht allen
Lehrkräften in gleicher Ausprägung. Stellenweise fehlte es an der nötigen Konsequenz bei
Verhaltensverstößen und in der Umsetzung vereinbarter Festlegungen. Der
Unterrichtsablauf wurde dadurch wiederholt gestört und die Unterrichts- und die damit
verbundene Lernzeit verstrich ungenutzt. Insgesamt gelang es nicht allen Lehrkräften in
ihrem unterrichtlichen Vorgehen die zur Verfügung stehende Lehr- und Lernzeit effektiv für
den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler zu nutzen. Es kam zu Fällen von
Fehlorganisation, wie beispielsweise einem verspäteten Unterrichtsbeginn.
Oft motivierten die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler durch anschauliche, lebensnahe
Bezüge und herausfordernde Problemstellungen, ihren Lernprozess selbst zu bestimmen.
Arbeitsaufträge wurden durch die Lehrkräfte verständlich formuliert und orientierten sich im
überwiegenden Teil der Beobachtungen an der Alltags- bzw. Erfahrungswelt der
Schülerinnen und Schüler. Die Anwendung und Vertiefung bereits erworbenen Wissens war
möglich. In der Mehrzahl der beobachteten Sequenzen lag dem Unterricht eine klare Struktur
zugrunde. Vereinzelte Sequenzen waren erkennbar unvorbereitet. Während die inhaltlichen
Ziele zumeist klar artikuliert wurden, war die Angabe von Lernzielen weniger stark
ausgeprägt, teilweise erfolgten sie gar nicht. Die im Unterricht eingesetzten Methoden waren
den Schülerinnen und Schülern weitgehend bekannt, Übergänge gestalteten sich meist
fließend. Die Schülerinnen und Schüler erhielten die Möglichkeit - wenn auch in begrenztem
Umfang - selbstständig tätig zu werden, indem sie eigene Ideen verwirklichten, Aufgaben
selbst wählten oder recherchierten. Insgesamt bekamen die Schülerinnen und Schüler selten
die Gelegenheit, ihren Lernprozess und die damit verbundenen Lernziele selbst zu gestalten,
die Inhalte eigenständig zu planen und Fehler als Lernchance wahrzunehmen. Neben
Stundenteilen mit einem hohen Maß an Professionalität der Lehrkräfte wurden in der
Mehrheit Unterrichtssequenzen beobachtet, die von Kleinschrittigkeit und starker
Lehrerzentriertheit geprägt waren. Lehrkräfte unterbanden beispielsweise die selbstständige
Arbeit der Schülerinnen und Schüler, indem sie sehr enge Vorgaben zu Arbeits- und
Lernwegen machten, Arbeitsprozesse wiederholt durch Einwände unterbrachen oder stark
zentriert alle Arbeitsschritte lenkten. Auffällig war in diesem Zusammenhang, dass es
Sequenzen gab, in denen ausschließlich das Unterrichtsgespräch, geprägt von Fragen und
Antworten, im Vordergrund stand. Andererseits wurden auch Situationen beobachtet, in
denen die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge ohne nähere Erläuterungen und
Zielsetzungen erfüllen sollten. Insgesamt waren die Möglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler, ihre Aktivitäten selbst zu organisieren und zu steuern, jedoch stark eingeschränkt.
Oft überwog das Abarbeiten vorgegebener Aufgabenstellungen mit eindeutigen, vorher
feststehenden Ergebnissen. Ergebnispräsentationen waren in der Hälfte der beobachteten
Sequenzen so angelegt, dass sie sich in erster Linie auf die Angabe der Lösungen
beschränkten und die Reflexion der Lernwege eher keine Rolle spielte. Alternative
Lösungswege wurden wenig thematisiert.
Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden durch eine
geplante individualisierte Binnendifferenzierung war keine wahrnehmbare Praxis an der
Gesamtschule. Die Anforderungen im Unterricht richteten sich fast ausschließlich auf ein
einheitliches Anspruchsniveau. Damit entstanden für einige Schülerinnen und Schüler
deutliche Leerlaufzeiten. Teilweise war das Lerntempo für die Lerngruppe deutlich zu
Seite 13Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
langsam und einzelne Schülerinnen und Schüler waren in ihrem Lernprozess unterfordert.
Nur in Einzelfällen konnten die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihres
Leistungsvermögens ihre Lernzeit oder die Anzahl der zu bearbeiteten Aufgaben
selbstständig planen. Eine differenzierte Leistungsrückmeldung an die Lernenden mit
fundierter Begründung erfolgte kaum. Individuelle Lernfortschritte wurden durch die
Lehrkräfte gelegentlich gewürdigt. In Ansätzen nutzten die Lehrkräfte spontanes und
authentisches Lob für gute Leistungen als Basis der Stärkung des Selbstbewusstseins der
Schülerinnen und Schüler.
4.3.3 Arbeitsgrundlagen und Konzepte für den Unterricht
Zur Abstimmung der Unterrichtsinhalte haben die Fachkonferenzen der Friedrich-Wilhelm-
von-Steuben-Gesamtschule schuleigene Lehrpläne9 entwickelt, die nachweislich in
Beratungen thematisiert wurden. Aufgrund fehlender Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung
bzw. zum Inkrafttreten war teilweise nicht erkennbar, inwieweit die Pläne seit der letzten
Schulvisitation fortgeschrieben wurden und nach welchen Plänen derzeit gearbeitet wird.
Einige der eingesehenen Pläne haben innerhalb eines Faches eine unterschiedliche Form
und Aussagekraft und differieren sowohl quantitativ als auch qualitativ. Die von den
Schülerinnen und Schülern zu entwickelnden Kompetenzen sind durchgehend, jedoch in
unterschiedlicher Qualität abgebildet. Einige Pläne weisen zu erwerbende Standards bzw.
Methoden- und fachspezifische Kompetenzen detailliert aus. Fachübergreifende und
fächerverbindende Aspekte sind in den eingesehenen schuleigenen Lehrplänen kaum
gekennzeichnet. Vereinzelt gibt es Verweise, mit welchen Fächern sich eine Kooperation
anbieten würde. Eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung ist nicht erkennbar.
Fachübergreifende Projekte bzw. Aspekte, wie bspw. das Methodentraining der
Jahrgangsstufe 7, finden statt bzw. werden in den Unterricht integriert. Eine systematische
Planung für regelmäßig stattfindende Projekte liegt nicht vor. Die schuleigenen Lehrpläne
enthalten des Weiteren nur sehr vereinzelt Ausführungen zum Einsatz von Medien im
Unterricht. An der Gesamtschule existiert ein Medienentwicklungsplan, der die Grundsätze
der Medienbildung und deren Einsatz in allen Fächern an der Schule ausweist. Darüber
hinaus bildet der schuleigene Lehrplan für das Wahlpflichtfach Informatik neben dem
fachbezogenen Kompetenzerwerb und den notwendigen Eingangsvoraussetzungen auch die
abschlussorientierten Standards ab. Eine verbindliche Festlegung zur systematischen
Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit modernen Medien, insbesondere mit
Computertechnik und -software, ist nicht ersichtlich.
Ein stetiges Fordern und Fördern kennzeichnet u. a. das auf der Homepage beschriebene
Profil der Schule. Festlegungen zur Förderung der Schülerinnen und Schüler sind im
überarbeiteten Ganztagskonzept dokumentiert, das durch die Schulkonferenz verabschiedet
wurde. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler der Sekundarstufe I nimmt dabei verpflichtend am
Mittagsband teil. Dieses dient sowohl der Förderung von leistungsschwachen wie auch
leistungsstarken Schülerinnen und Schülern. Die Feststellung des Förderbedarfs für die
einzelnen Fächer erfolgt durch die Klassen- oder Fachlehrkraft. Des Weiteren bietet die
Schule für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 eine systematische
Prüfungsvorbereitung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch an. Im Rahmen des
Ganztags steht den Schülerinnen und Schülern neben den Fördermöglichkeiten auch ein
vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften auf naturwissenschaftlichem, musischem
oder sportlichem Gebiet (z. B. Töpfern, Fitness) zur Verfügung, die auch der Förderung von
besonderen Begabungen dienen. Die Arbeitsstunden, die jede Klasse einmal in der Woche
im Rahmen des Ganztags wahrnimmt, werden sowohl für ein differenziertes
Methodentraining als auch für die Förderung der sozialen Kompetenzen genutzt. Dabei
unterstützen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig und bilden auch
Lernpatenschaften. Gleichzeitig dienen die Arbeitsstunden für die Anfertigung der
Hausaufgaben. Zur Erteilung und zum Umgang mit vergessenen Hausaufgaben gibt es
mündliche Verabredungen, deren Umsetzung erfolgt lehrkräfteabhängig.
9
Deutsch, Mathematik, Englisch, Wirtschaft-Arbeit-Technik (W-A-T), Informatik, Seminarkurs Berufs-
und Studienorientierung, Migration.
Seite 14Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
Für die Integration der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
besteht an der Schule ein Konzept „Gemeinsamer Unterricht/Integration/Inklusion“ vom
August 2011. Dieses Konzept ist seit der letzten Schulvisitation nicht fortgeschrieben
worden. Dennoch werden Schülerinnen und Schüler erfolgreich in den Unterricht integriert.
Dazu führen die Lehrkräfte am Beginn des Schuljahres und bei Notwendigkeit
Klassenkonferenzen durch, um konkrete Fördermaßnahmen und den Nachteilsausgleich für
diese Schülerinnen und Schüler zu vereinbaren. Die vorliegenden Förderplanungen für
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellen sich sehr
differenziert dar. Aus ihnen gehen u. a. die jeweiligen Zielsetzungen, durchgeführte
Fördermaßnahmen sowie eine regelmäßige Fortschreibung nicht deutlich hervor. Teilweise
fehlen für einige Schülerinnen und Schüler, für die der entsprechende Beschluss des
Förderausschusses vorliegt, die Förderpläne komplett, bzw. wurden nur zu Beginn ihrer
Schullaufbahn an dieser Schule angefertigt. Die Erarbeitung der Förderpläne liegt in der
Verantwortung der jeweiligen Klassenlehrkraft unter Beteiligung der Sonderpädagogen.
Neben den beiden Sonderpädagogen gibt es im Lehrkräftekollegium keine ausreichenden
Kompetenzen für Lerndiagnostik und Schülerbeobachtung. Einige Lehrkräfte, die sich auf
diesen Gebieten fortgebildet haben, verließen die Schule. Derzeit nutzen die Lehrkräfte die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, um der großen Heterogenität der Schülerinnen
und Schüler Rechnung zu tragen. Für die Lehrkräfte erweist sich als problematisch, dass
Schülerinnen und Schüler, die umfangreiche Unterstützung benötigen, nicht
sonderpädagogisch diagnostiziert wurden.
Die Kommunikationskultur an der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule umfasst
neben der Information zu den Zielen und Inhalten des Unterrichts auch die zu den
Grundsätzen der Leistungsbewertung. Eltern wie auch Schülerinnen und Schüler bestätigen
die Kenntnis der Festlegungen, die lehrkräfteabhängig durch entsprechende Informationen
über Versetzungs- und Abschlussregelungen ergänzt werden. Die Beschlusslagen der
Konferenz der Lehrkräfte und der Fachkonferenzen weisen Grundsätze zur
Leistungsbewertung auf der Basis der geltenden Verwaltungsvorschrift aus. Hier sind
verbindliche Absprachen getroffen, die sich u. a. auf die Leistungsermittlung,
Leistungsbeurteilung und die Mitteilung der Ergebnisse an Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler beziehen. Weitere Festlegungen betreffen die Mindestanzahl von Zensuren pro
Schulhalbjahr und Termine zum regelmäßigen Eintragen der Noten, um den Schülerinnen
und Schülern durch Zwischenzeugnisse vor den Elternsprechtagen eine Übersicht zu ihren
Leistungen zu geben. Die zweimal im Jahr stattfindenden Elterngespräche dienen der
Beratung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern zum aktuellen Leistungsstand und
zur Lernentwicklung. Bestandteil dieser Gespräche sind teilweise auch die Ergebnisse der
Lernausgangslage, wenngleich es an der Gesamtschule keine verbindlichen Regelungen
gibt, um dieses Testverfahren anzuwenden. Die Lehrkräfte bestimmen selbst, inwieweit sie
dieses Material einsetzen, um den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler in der
Jahrgangsstufe 7 zu analysieren.
4.4 Schulkultur
Die individuelle Berufsorientierung ist eine der Stärken der Gesamtschule und fester
Bestandteil der schulischen Ausbildung. Ein breit angelegtes Informationssystem sowie die
Nutzung der verschiedensten praktischen Angebote von Studien- und Wirtschafts-
einrichtungen gehören zu der langfristigen Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf
eine berufliche oder weiterführende Ausbildung nach Verlassen der Gesamtschule. Für jede
Jahrgangsstufe schreibt das schuleigene Konzept verbindlich Aktivitäten fest, die den
Schuljahresablauf prägen und die Schülerinnen und Schüler bei der Ermittlung ihrer
persönlichen Stärken und Schwächen unterstützen. Dabei stehen neben beratenden
Angeboten das Praxislernen in der Jahrgangsstufe 7 und die Praktika in den
Jahrgangsstufen 9 und 10 im Fokus dieser pädagogischen Querschnittsaufgabe. Zur
unmittelbaren Vorbereitung auf einen möglichen Beruf gehören u. a. auch
Betriebsbesichtigungen und betriebliche Eignungstests. Darüber hinaus haben die
Seite 15Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
Schülerinnen und Schüler durch den Berufswahlordner und die Zusammenarbeit mit dem
BIZ10 bzw. den Besuch des Ausbildungszentrums in Götz die Möglichkeit der individuellen
Beratung und Orientierung. Die kontinuierliche Vorbereitung auf einen Beruf bzw. auf ein
Studium setzt sich in der Sekundarstufe II der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule
fort. Durch die Teilnahme am Programm „Studium lohnt“ und die individuelle Beratung durch
die Agentur für Arbeit erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen über
wissenschaftliche Bereiche und Berufsgruppen. Zu den Maßnahmen der Studienberatung
gehören neben den Besuchen der Universität in Potsdam auch die angebotenen Seminare
der AOK11 (z. B. „Jobstart – Das AOK – Bewerbungstraining“, „Stressfrei in die Uni“) und die
Projektwoche, an der sich auch ehemalige Schülerinnen und Schüler beteiligen. Im
Seminarkurs zur Studien- und Berufsorientierung lernen die Schülerinnen und Schüler u. a.
die Anforderungen an ein Studium kennen. Unterstützend wirken darüber Exkursionen in
wissenschaftliche Einrichtungen (z. B. Gläsernes Labor in Berlin-Buch), Besuche
verschiedener Schülermessen sowie die Studienfahrten. Hier nutzt die Gesamtschule u. a.
die Kontakte und die Kooperationen mit außerschulischen Partnern – teilweise auf der Basis
von Kooperationsverträgen (z. B. Urania Schulhaus, BTU12 Cottbus-Senftenberg, Johanniter
Unfallhilfe). Sie unterstützen die Schule sowohl bei der Berufs- und Studienorientierung als
auch bei der Realisierung der vielfältigen Ganztagsangebote. Darüber hinaus trifft sich die
Gesamtschule mit anderen Gesamtschulen in der Region (z. B. Maxim-Gorki-Gesamtschule-
Kleinmachnow) und in Potsdam in unregelmäßigen Abständen zum Erfahrungsaustausch im
Rahmen des Ganztags. Gegenstand der Zusammenarbeit mit dem Hermann-von-Helmholtz-
Gymnasium in Potsdam sind Absprachen auf der Ebene der gymnasialen Oberstufe sowie
der Prüfungsausschüsse. Diese basieren nicht auf konkreten Verabredungen und erfolgen
damit nicht zielgerichtet und systematisch. Mehrere überregionale bzw. internationale
Schulpartnerschaften bestehen nach mehreren Jahren aktiven Austauschs nicht mehr. Die
Schule versucht derzeit, neue Kontakte herzustellen. Demgegenüber steht die
Zusammenarbeit mit den abgebenden Einrichtungen. Die Gesamtschule bietet sowohl den
Schülerinnen und Schülern der Grundschule „Albert Einstein“ in Caputh als auch der
Oberschule in Wilhelmshorst mit Primarstufe in Michendorf die Möglichkeit an, den Unterricht
zu besuchen und die Schule am „Tag der offenen Tür“ kennen zu lernen. Hier nutzt die
Gesamtschule gezielt die Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler, die ihre Schule bei
Rundgängen präsentieren. Darüber hinaus engagieren sich die Schülerinnen und Schüler
bei der Schulhaus- und Raumgestaltung sowie bei der Organisation und der Mitgestaltung
einzelner Veranstaltungen, wie bspw. dem Hoffest. Trotz des beschriebenen Engagements
sind die aktive Gestaltung des Schullebens und die damit verbundene Identifikation durch die
Mehrheit der Schülerschaft an der Gesamtschule nicht gegeben. Identifikationsfördernde
Aktivitäten, an denen alle Personengruppen teilnehmen, gibt es nur wenige. Neben dem
Steuben-Ball, der von der Jahrgangsstufe 13 zur Finanzierung ihres Abi-Balls organisiert
wird, gibt es u. a. Theaterveranstaltungen und das Weihnachtssingen. Die Resonanz ist
steigend. Eltern werden in die Gestaltung von Schule vorrangig auf Klassenebene
einbezogen. Sie unterstützen die Lehrkräfte bei Wandertagen oder Projekten. Die Eltern
schätzten selbstkritisch im Interview ein, dass sie für die Elternschaft in diesem Bereich
Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Mit Bedauern führten sie aus, dass es eine Reihe von
Elternhäusern gibt, die wenig Interesse am schulischen Alltag zeigen. Nur wenige Eltern sind
in den Gremien aktiv oder wirken bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Schule mit.
Informationen über schulische Veranstaltungen, Termine und Regelungen erhalten die
Eltern, Schülerinnen und Schüler überwiegend durch die Lehrkräfte bspw. auf den
Elternversammlungen, teilweise auch durch Informationsbriefe der Schulleitung und
Aushänge im Schulgebäude. Des Weiteren werden die schuleigene Homepage und die
Steuben-News, die durch das Team Öffentlichkeitsarbeit heraus gegeben werden, genutzt.
10
Berufsinformationszentrum.
11
Allgemeine Ortskrankenkasse.
12
Brandenburgische Technische Universität.
Seite 16Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
4.5 Führung und Schulmanagement
Die Ergebnisse der Profilmerkmale 15 und 16 in diesem Bereich werden nicht veröffentlicht.
Die Einbeziehung der Schulkonferenz und der Konferenz der Lehrkräfte in die konkrete
Planung der Schul- und Unterrichtsorganisation war nicht umfassend erkennbar. Protokolle
der Schulkonferenz lagen nicht vor. In den eingesehenen Protokollen der Konferenz der
Lehrkräfte war die Beschlusslage beispielsweise zur Stundenplangestaltung, zur Verteilung
der Anrechnungsstunden oder zu zusätzlichen Unterrichtsangeboten nicht vollständig
gegeben. Das Vertretungskonzept erläutert die Reihenfolge aller Maßnahmen, die zur
Vermeidung von Unterrichtsausfall beschlossen wurden. Dazu gehört bspw., dass
Klassenfahrten, Exkursionen und Wandertage zeitgleich in allen Jahrgangsstufen
durchgeführt werden. Dennoch liegt der Anteil der an der Schule ersatzlos ausgefallenen
Unterrichtsstunden im Schuljahr 2012/2013 über dem Landesdurchschnitt. In den
vorangegangenen Schuljahren ist dieser Anteil im Vergleich zum Land teilweise deutlich
geringer trotz des prozentual hohen Anteils von Unterrichtsstunden, die zur Vertretung
anfallen.
4.6 Professionalität der Lehrkräfte
Ein Fortbildungskonzept bzw. eine Übersicht zu den durchgeführten schulinternen
Lehrkräftefortbildungen (SchiLF) gibt es an der Schule nicht. Generell ist diese Aufgabe an
die Fachkonferenzen übertragen worden, die intern ein Konzept erarbeiten. Dennoch wird in
der Konferenz der Lehrkräfte in regelmäßigen Abständen besprochen, welche gemeinsamen
Fortbildungen im Schuljahr durchgeführt werden. Eine Abstimmung des Kollegiums zu
geplanten Fortbildungsthemen ist aus den Protokollen der Fachkonferenzen und der
Konferenz der Lehrkräfte ersichtlich. Im Mittelpunkt standen in den letzten beiden
Schuljahren Fortbildungen zu Sozialformen im Unterricht und zur Drogenprävention. Hierfür
zogen die Lehrkräfte externe Beraterinnen und Berater (z. B. vom Studienseminar Potsdam)
und die Kompetenzen des eigenen Kollegiums heran.
Die Fachkonferenzen der Gesamtschule tagen laut Protokolllage regelmäßig. Lehrkräfte und
Schulleitung schätzen die täglich praktizierte Arbeits- und Kommunikationskultur an der
Schule mehrheitlich als erfolgreich ein. Die Fachkonferenzen bieten u. a. die Möglichkeit des
Austauschs von fachlichen Erfahrungen, der Diskussion konzeptioneller Festlegungen oder
der Abstimmung von Unterrichts- und Projektinhalten. Der Erfahrungsaustausch durch
kollegiale Unterrichtsbesuche, über Jahrgangsstufen und Fächer hinweg, ist nicht regulärer
Bestandteil der Professionalisierung. Vereinzelt gibt es in den Fachkonferenzen konkrete
Vereinbarungen zu gegenseitigen Unterrichtsbesuchen. Dagegen stellt sich die Arbeit der
verschiedenen Teams sehr unterschiedlich dar. Zu weiteren Arbeitsgruppen, die an aktuellen
Schwerpunktaufgaben arbeiten, gehören das Team der Öffentlichkeitsarbeit, die
Steuergruppe und das Team Schulprogramm. Hier wurde nicht deutlich, dass diese Gruppen
kontinuierlich an der Entwicklung der Schulqualität arbeiten.
Die Schulleitung führt mit den neu an die Schule kommenden Lehrkräften ein persönliches
Gespräch. Mit der Doppelbesetzung der Klassenleiterfunktion aus einer erfahrenen und einer
neuen Lehrkraft berücksichtigt die Schulleitung die Einarbeitung der neuen Kolleginnen bzw.
Kollegen. Des Weiteren finden mit diesen Lehrkräften regelmäßige Gespräche statt, in
denen die Schulleitung auch eventuell auftretende Probleme während der
Einarbeitungsphase thematisiert.
4.7 Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung
In Auswertung der Schulvisitation aus dem Schuljahr 2011/2012 wurde mit dem zuständigen
Schulrat u. a. eine entsprechende Zielvereinbarung zur Verbesserung der Qualität des
Unterrichts und des Lernens getroffen. Neben der stärkeren Umsetzung unterschiedlicher
Sozialformen im Unterricht steht die zielorientierte Evaluation des Unterrichts im Mittelpunkt
dieser Vereinbarung. Dennoch gab es bislang keine schwerpunktorientierte Evaluation des
Unterrichts an der Gesamtschule. Lehrkräfte holen sich Rückmeldungen zur Qualität ihres
Unterrichts im Rahmen der Elternsprechtage und Elternversammlungen sowie in
Seite 17Kurzbericht – Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule in Potsdam
persönlichen Gesprächen oder vereinzelt auch durch Schülerfragebogen in anonymisierter
Form ein. Eine regelmäßige und systematische Evaluation der außerunterrichtlichen
Angebote durch gezieltes Einholen von Schülerrückmeldungen ist an der Gesamtschule
nicht gegeben. Rückmeldungen zur Organisation des Ganztags und zu den Wünschen der
Schülerinnen und Schülern holten die Lehrkräfte ausschließlich mündlich ein. Weitere
schulische Evaluationsmaßnahmen bspw. zu schulischen Entwicklungsprozessen gab es in
den letzten beiden Schuljahren nicht. Demgegenüber ist die Auswertung der Ergebnisse der
zentralen Prüfungen und der Vergleichsarbeiten regelmäßig Gegenstand in der Konferenz
der Lehrkräfte und der Fachkonferenzen.
Seite 18Sie können auch lesen