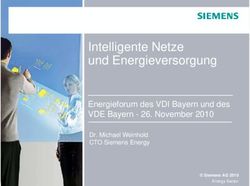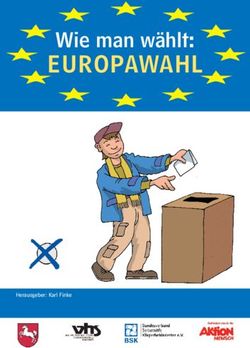Landes-Rahmen-Vertrag für Schleswig-Holstein - nach Paragraf 79 Absatz 1 Sozial-Gesetz-Buch 12 - Eine Erklärung in Leichter Sprache - Die ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Landes-Rahmen-Vertrag für Schleswig-Holstein nach Paragraf 79 Absatz 1 Sozial-Gesetz-Buch 12 - Eine Erklärung in Leichter Sprache -
Text:
Nicole Richter
Der PARITÄTSCHE Schleswig-Holstein
Zum Brook 4
24143 Kiel
Karin Boltendahl
Mürwiker Werkstätten GmbH
Raiffeisenstraße 12 – 14
24941 Flensburg
Seite 2 von 17Inhalts-Verzeichnis
Seite 4 1. Was ist ein Landes-Rahmen-Vertrag (LRV)?
Seite 4 2. Wer macht den Landes-Rahmen-Vertrag?
Seite 6 3. Warum braucht man den Landes-Rahmen-
Vertrag?
Seite 8 4. Was wird allgemein im Landes-Rahmen-Vertrag
geregelt?
Seite 9 5. Was steht im Landes-Rahmen-Vertrag?
Seite 15 6. Was gehört noch zum Landes-Rahmen-Vertrag?
Seite 3 von 171. Was ist ein Landes-Rahmen-Vertrag?
Der Begriff Land steht für ein Bundesland, zum
Beispiel Schleswig-Holstein.
Der Begriff Rahmen steht für eine Grundlage oder
Eingrenzung.
Der Begriff Vertrag steht für ein Übereinkommen
oder eine schriftliche Vereinbarung.
Der Begriff Rahmen-Vertrag steht für eine
schriftliche Vereinbarung über eine Grundlage für
nachfolgende Einzelverträge.
Er enthält Regelungen, wie diese Einzelverträge
abgeschlossen werden sollen.
Er soll die Einzelverträge beschleunigen und
vereinfachen.
2. Wer macht den Landes-Rahmen-Vertrag?
Am Landesrahmenvertrag haben viele Menschen
mitgearbeitet.
Die Menschen haben sehr lange verhandelt.
Die Menschen kommen aus ganz verschiedenen
Organisationen.
Der Vertrag gilt für alle diese Organisationen.
Die Organisationen heißen Vertrags-Parteien.
Seite 4 von 17Das sind die Vertrags-Parteien:
1. der überörtliche Träger der Sozialhilfe
Er gibt den Städten und Kreisen das Geld für ihre
Arbeit.
2. die kommunalen Spitzenverbände auf
Landesebene
Sie sind die Vertreter aller Gemeinden, Dörfer,
Städte und Kreise in Schleswig-Holstein.
3. die Vereinigungen der Träger der Einrichtungen
Sie sind die Vertreter der großen Vereine und
Verbände von Menschen mit Behinderung. Sie
sprechen für die Einrichtungen und Dienste.
1. Vertrags-Partei:
der überörtliche Träger der Sozialhilfe
Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein
2. Vertrags-Partei:
die kommunalen Spitzenverbände auf
Landesebene
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag e. V.
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag e. V.
Städtebund Schleswig-Holstein e. V.
Städtetag Schleswig-Holstein
Seite 5 von 173. Vertrags-Partei:
die Vereinigungen der Träger der Einrichtungen
Arbeiterwohlfahrt
Arbeitsgemeinschaft Privater Heime
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste
Caritasverband
Deutsches Rotes Kreuz
Diakonisches Werk
Forum Sozial
Landesverband der Fachkliniken
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe
3. Warum braucht man einen Landes-Rahmen-
Vertrag?
Die Einrichtungen betreuen die Menschen mit
Behinderung. Dafür bekommen sie Geld von den
örtlichen Trägern der Sozialhilfe. Das sind in
Schleswig-Holstein die Kreise und kreisfreien Städte.
Man nennt sie auch Kostenträger.
Seite 6 von 17Jede Einrichtung setzt sich mindestens 1 Mal im Jahr
mit dem Kostenträger zusammen.
Sie verhandeln über das Geld, das die Einrichtung im
nächsten Jahr bekommen soll, damit sie ihre Arbeit
(gut) machen kann.
Die Einrichtung und der Kostenträger verhandeln
nach den Regeln, die im Landes-Rahmen-Vertrag
stehen.
Nach diesen Regeln machen die Einrichtungen in
Schleswig-Holstein ihre Einzelverträge.
Ohne diese Regeln würden die Verhandlungen sehr
lange dauern. Und die Ergebnisse wären überall
anders.
Der Landes-Rahmen-Vertrag ist also eine Hilfe, damit
die Verhandlungen zwischen Einrichtung und
Kostenträger schneller und einfacher gehen.
Der Landes-Rahmen-Vertrag sorgt auch dafür, dass
die Verhandlungen in ganz Schleswig-Holstein auf
der gleichen Grundlage geführt werden.
Das heißt, dass das Geld für die Einrichtungen im
ganzen Land nach den gleichen Regeln berechnet
wird.
So wird sichergestellt, dass in allen Kreisen und
= Städten gleich verhandelt wird.
Es steht im Gesetz (Paragraf 79 im Sozial-Gesetz-
Buch 12), dass es den Rahmenvertrag geben soll.
Seite 7 von 174. Was wird allgemein im Landes-Rahmen-Vertrag
geregelt?
Viele Menschen mit Behinderung bekommen
Sozialhilfe.
Die Sozialhilfe will sicherstellen, dass jeder Mensch
ein menschenwürdiges Leben führen kann.
Wer das nicht (oder nicht mehr oder noch nicht
wieder) selbständig kann, bekommt Hilfe.
Zur Sozialhilfe gehört zum Beispiel auch die
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.
Die Aufgaben der Sozialhilfe werden von
Einrichtungen und Diensten übernommen.
Man nennt sie auch Leistungs-Erbringer.
Leistungs-Erbringer sind zum Beispiel Werkstätten,
Wohnheime und ambulante Betreuung.
Damit sie diese Arbeit (gut) machen können,
bekommen die Einrichtungen und Dienste Geld.
Der Landes-Rahmen-Vertrag regelt,
• wofür es das Geld gibt,
• wie man das Geld berechnet und
• wie die Arbeit der Einrichtungen
überprüft wird.
Seite 8 von 175. Was steht im Landes-Rahmen-Vertrag?
Der Landes-Rahmen-Vertrag besteht aus einem
Vorwort und 14 Abschnitten.
Das Vorwort nennt man auch Präambel. Die
Abschnitte nennt man auch Paragrafen. Das Zeichen
für Paragraf ist §.
Das ist das Ziel des Landes-Rahmen-Vertrages:
Die Einrichtung und der Kostenträger, also die Stadt
oder der Kreis, schließen 3 Vereinbarungen ab:
1. Leistungs-Vereinbarung
2. Vergütungs-Vereinbarung
3. Prüfungs-Vereinbarung
Vorwort:
Die Vertragsparteien versprechen, dass sie gut
zusammenarbeiten und Probleme gemeinsam lösen
wollen.
Die Vertragsparteien wollen Menschen mit
Behinderungen helfen.
Die Sozialleistungen sollen dem Menschen mit
Behinderung helfen.
Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein
können.
Menschen mit Behinderung sollen sich durch die
Unterstützung so weit wie möglich selbst helfen.
Dabei sind die Vorschriften aus der UN-Behinderten-
Rechts-Konvention sehr wichtig!
Seite 9 von 17Paragraf 1:
Der Landes-Rahmen-Vertrag gilt für
• stationäre Einrichtungen
(z. B. Wohneinrichtungen für Menschen mit
Behinderung/ mit besonderem Hilfebedarf/
mit seelischer Behinderung/ Suchterkrankung,
Lebens- und Arbeitsgemeinschaften)
• teilstationäre Einrichtungen
(z. B. Werkstätten für Menschen mit
Behinderung, Tagesförderstätten,
Wohngemeinschaften/ -gruppen für
Menschen mit seelischer Behinderung /
Suchterkrankung)
• ambulante Dienste
(z. B. Betreutes Wohnen für geistig und/oder
körperlich behinderte Menschen, Menschen
mit seelischer Behinderung/ Suchterkrankung)
Paragraf 2:
Die Einrichtung sagt dem Kostenträger Bescheid,
dass sie Geld für ihre Arbeit braucht und darüber
verhandeln will. Damit der Kostenträger gut über das
Geld entscheiden kann, muss die Einrichtung viele
Unterlagen vorbereiten und mitbringen.
Das steht in den Unterlagen:
• wie die Hilfe genau aussieht (Konzeption)
• in welcher Stadt (welchem Ort) und in welchen
Räumen die Hilfe durchgeführt wird
• welche neuen Dinge benötigt werden (zum
Beispiel ein Haus, ein Computer oder Möbel)
und wie viel diese kosten
Seite 10 von 17• wie viele Betreuer für die Hilfe notwendig sind,
welche Berufe sie haben, was ihre Arbeit kostet
?
• und was die Hilfe insgesamt kostet
So finden Einrichtung und Kostenträger zusammen
heraus, wie viel Geld die Einrichtung vom
Kostenträger braucht bzw. bekommen soll.
Paragraf 3:
Es gibt einen Einrichtungstypen-Katalog. Das ist eine
Liste zur Berechnung der Kosten für Betreuung,
Beratung, Begleitung, Erziehung und Förderung.
Dieses Geld nennt man auch Maßnahmen-
Pauschale.
Für die Berechnung der Kosten für diese Hilfen
werden die Menschen mit Behinderung in Gruppen
eingeteilt.
Die Gruppen ergeben sich daraus, in welcher
Einrichtung die Hilfe erbracht wird (vollstationär,
teilstationär, ambulant).
Für Menschen, die viel Hilfe brauchen, bekommen
die Einrichtungen mehr Geld.
Für Menschen, die weniger Hilfe brauchen,
bekommen die Einrichtungen weniger Geld.
Paragrafen 4 + 5 + 6 + 7:
Die Einrichtung macht einen Vorschlag über ihre
Leistungen, die sie erbringen will.
Also wie sie den Menschen mit Behinderung helfen
will. Und was sie dafür braucht.
Seite 11 von 17Die Einrichtung schreibt ihre Leistungen für den
Kostenträger ganz genau auf und verhandelt mit ihm
darüber.
Diese Leistungen beschreibt die Einrichtung:
• was sie macht, wo sie das macht und was sie
dafür braucht (Plan, Grundleistung,
Maßnahmen, Anlagen und Ausstattung,
Personalbedarf)
• dass die Leistungen an den Bedarf der
Menschen angepasst sind (nicht zu viel, nicht
zu wenig, nicht zu teuer, zielgerichtet, Hilfe zur
Selbsthilfe)
• ihren Plan, wie sie die Arbeit gut machen kann
(Qualität und Überprüfung) und
• was alles zusammen kostet
Wenn der Kostenträger mit dem Vorschlag
einverstanden ist, schließt er die Leistungs-
Vereinbarung mit der Einrichtung ab.
In dieser Leistungs-Vereinbarung steht auch, wie
viele Menschen von der Einrichtung Hilfe
bekommen.
Das gilt nur für die Leistungen der Eingliederungs-
Hilfe (nicht Krankenkasse, Bundesagentur für Arbeit,
Rentenversicherung, Unfallversicherung).
Der Leistungserbringer meldet der Stadt oder dem
Kreis zweimal im Jahr, wie vielen Menschen mit
Behinderung er geholfen hat.
Dies macht er 2 Mal im Jahr.
Zum 30. Juni und zum 31. Dezember.
Soll die Platzzahl verändert werden, müssen die
beiden das miteinander besprechen.
Seite 12 von 17Paragraf 8:
Die Einrichtung und der Kostenträger einigen sich,
!
wie viel Geld die Einrichtung für ihre Leistungen
bekommt. Dieses Geld nennt man Vergütung.
Sie schließen gemeinsam eine Vergütungs-
Vereinbarung.
In der Vergütungs-Vereinbarung steht:
• wofür die Einrichtung Geld bekommt. Sie
bekommt Geld für Personal, die Grundleistung
(zum Beispiel Wohnung und Essen), die
Maßnahmen (zum Beispiel Betreuung und
Begleitung) und die Bereitstellung der
notwendigen Dinge (zum Beispiel Haus,
Computer und Möbel).
• wie viel Geld die Einrichtung bekommt und
• wie lange die Einrichtung Geld bekommt
In der Vergütungs-Vereinbarung steht auch die
Anzahl der Menschen, für die die Einrichtung Geld
bekommt. Diese Zahl nennt man Auslastungs-Quote.
Wenn in der Leistungs-Vereinbarung eine andere
Zahl steht als in der Vergütungs-Vereinbarung, gilt
die höhere.
Paragraf 9:
Der Kostenträger prüft, ob die Einrichtung ihre
Arbeit gut macht und gut mit dem Geld umgeht.
Dafür schließen sie eine Prüfungs-Vereinbarung ab.
Die Einrichtung muss immer genau aufschreiben, wie
sie den Menschen mit Behinderung hilft.
Der Kostenträger, also die Stadt oder der Kreis, darf
bei der Prüfung viele Unterlagen lesen.
Seite 13 von 17Paragraf 10
Es gibt eine Gruppe, die regelmäßig über den
Landes-Rahmen-Vertrag spricht.
Die Gruppe prüft, ob der Landes-Rahmen-Vertrag
noch gut ist. Damit sich nicht immer wieder alle
Menschen aus den Vertrags-Parteien treffen
müssen, werden 10 von ihnen ausgesucht.
Diese 10 Menschen heißen Vertrags-Kommission.
Wenn die Vertrags-Kommission Fragen hat, kann sie
Experten mit oder ohne Behinderung fragen.
Was die Vertrags-Kommission bestimmt, gilt für alle
Vertrags-Parteien.
Paragraf 11:
Wenn eine Einrichtung eine neue Idee für eine Hilfe
hat, kann sie sie ausprobieren.
Sie bespricht ihre Idee mit der Stadt oder dem Kreis.
Paragraf 12
Die Vertragsparteien wollen alle Hilfe-Arten
bekannt machen.
Hierfür wird extra ein Computer-Programm
gemacht.
Wenn es fertig ist, können die Einrichtungen ihre
Angebote darin beschreiben.
Alle Menschen können später darin lesen und sich
über die Angebote informieren.
Seite 14 von 17Paragraf 13
Wenn ein Paragraf des Landes-Rahmen-Vertrages
nicht mehr gilt, gelten alle anderen trotzdem noch.
Paragraf 14
Seit
Der Landes-Rahmen-Vertrag gilt seit dem
1.1.13 01.01.2013.
Jede Vertragspartei kann den Landes-Rahmen-
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss
aufgeschrieben werden.
Bis
31.12.17 Er gilt mindestens bis zum 31.12.2015 (3 Jahre) und
höchstens bis zum 31.12.2017 (5 Jahre).
6. Was gehört noch zum Landes-Rahmen-Vertrag?
Der Landes-Rahmen-Vertrag besteht aus mehreren
Papieren.
Neben dem Vertrags-Text sind dies:
• die allgemeine Verfahrens-Vereinbarung (AVV)
• der Einrichtungstypen-Katalog
• der Formular-Satz
• der Investitions- und Finanzierungs-Plan
In der allgemeinen Verfahrens-Vereinbarung (AVV)
steht, für welche Leistungen die Einrichtung Geld
bekommt.
Seite 15 von 17Sie bekommt Geld für die Personalkosten, die
Sachkosten und die Investitionskosten. Kosten für
die Beförderung und die Verpflegung von Menschen
mit Behinderung können auch bezahlt werden.
Das Geld kann als täglicher Vergütungs-Satz oder
Fach-Leistungs-Stunde bezahlt werden.
Bei einem täglichen Vergütungs-Satz bekommt die
Einrichtung jeden Tag für jeden Menschen, der in der
Einrichtung betreut wird, Geld.
Bei der Bezahlung nach Fachleistungs-Stunden
bekommt die Einrichtung Geld für die Stunden, die
sie den einzelnen Menschen mit Behinderung in der
Woche betreut.
Der Einrichtungstypen-Katalog ist eine Liste.
In dieser Liste sind alle Einrichtungen nach ihren
Leistungs-Arten eingeteilt.
Die Leistungs-Arten sind vollstationär, teilstationär
und ambulant.
Der Formular-Satz besteht aus vielen einzelnen
Tabellen. Hier trägt die Einrichtung alle ihre Kosten
ein. Mit diesen Tabellen wird die Vergütung
verhandelt.
Im Investitions- und Finanzierungs-Plan schreibt die
Einrichtung auf, was sie noch braucht oder
verändern muss, damit sie ihre Arbeit gut machen
kann (z. B. Gebäude, Grundstücke, Umbau, Ausbau,
Mietkosten). Sie schreibt auch auf, wie viel Geld sie
für ihre Pläne braucht.
Seite 16 von 17Die Einrichtung rechnet aus, wie viel Geld sie selbst
dafür ausgeben kann und wie viel Geld sie noch von
der Stadt oder dem Kreis braucht.
? Der Kostenträger prüft den Plan und beide
verhandeln über das Geld.
Bilder:
Picto Selector programm, Freeware - MC van der Kooij www.pictoselector.eu;
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/be/deed.de;
Sclera.be symbool Library, Creative Commons;
Mulberry symbool Library from straight-street.com, Creative Commons;
ARASAAC Symbol Set from http://catedu.es/arasaac, Creative Commons;
Pictogenda Symbol Set from http://pictogenda.nl, free for non commercial use
© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
Seite 17 von 17Sie können auch lesen