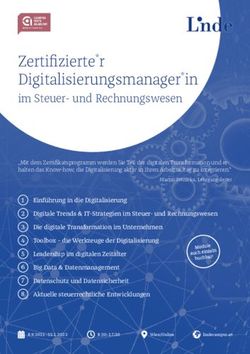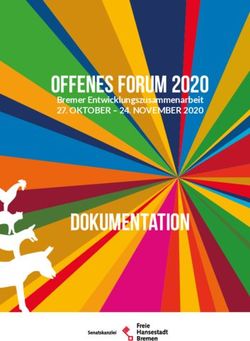Lernen in zwei Praxen - Praktiken und Qualität(en) Schul- und Berufspraktischer Studien - Internationaler Kongress der IGSP - PH Zürich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Lernen in zwei Praxen
Praktiken und Qualität(en) Schul- und Berufspraktischer Studien
5. Internationaler Kongress der IGSP
21.-23. Juni 2023 in Muttenz bei Basel, Schweiz
1/10Konzeption der Tagung
Der 5. Internationale Kongress der IGSP, der gemeinsam von der Pädagogischen Hochschule
FHNW und der Pädagogischen Hochschule Zürich ausgerichtet wird, fokussiert thematisch
auf die Felder und Institutionen, in denen Professionalisierungsprozesse von (zukünftigen Leh-
rer:innen stattfinden sowie auf die dort jeweils gestalteten und zu beobachtenden Praktiken
und Qualität(en). Diese beinhalten grundständige Studiengänge ebenso wie Quer- und Sei-
teneinsteigenden-Programme und grundsätzlich alle Phasen der Lehrer:innenbildung.
Der ursprüngliche Haupttitel des internationalen Kongresses «Lernen in der Praxis» wird
auch beim 5. Kongress inhaltlich sukzessive erweitert, um die Weitung des theoretischen und
empirischen Horizonts des Gegenstandsbereichs Schul- und Berufspraktischer Studien zu
markieren.
Angesprochen sind damit sowohl Forschende zum Gegenstandsbereich als auch alle Betei-
ligten am Studienbereich und Personen, die von der ersten über eine zweite Phase bzw. in
den inzwischen diversifizierten Formen des Zugangs zu pädagogischen Berufen arbeiten,
gleich welcher Praxis sie sich primär zugehörig fühlen.
Die Tagungsthematik beinhaltet drei zentrale Aspekte:
1. Mit der Figur zweier Praxen (Hackl, 2014; Leonhard et al., 2016; Schrittesser & Hofer,
2012) werden die je eigenen Praxen an den Hochschulen und im Berufsfeld, die sich
vor Ort ereignen und Gegenstand der Beobachtung werden können, hervorgehoben
und differenziert. Dabei wird angenommen, dass in beiden Praxen jeweils auf eine
Fülle differenter Theorien Bezug genommen wird, die zu explizieren ertragreich er-
scheint.
2. Der Begriff der Praktiken (Alkemeyer, 2013; Hillebrandt, 2014; Idel & Schütz, 2017;
Reckwitz, 2003; Reh, Fritzsche, Idel, & Rabenstein, 2015; Schatzki, 2002) verweist auf
die Ebene konkreten Tuns in den verschiedenen Feldern der Lehrer:innenbildung, also
die Vollzugswirklichkeit, in der an den jeweiligen Orten Menschen berufsbezogen mit-
einander in Beziehung treten. Hier finden wechselseitige Adressierungen z.B. in Bezug
auf Ansprüche an das Gegenüber statt, zu denen dieses sich dann situativ verhält.
Dies hinterlässt bei den Beteiligten «Spuren», die Gegenstand der Untersuchung wer-
den können. Der Begriff der Praktiken verweist zugleich auf jenes implizite Wissen, das
– familiär, schul- und berufsbiographisch angelegt – Wahrnehmungen, Deutungen (des
Schulischen, des Fachlichen, der Interaktionsdynamiken) und Handlungen
IGSP-Kongress 2023 2 / 10hervorbringt und konstitutiv für Passungsverhältnisse und Aushandlungsprozesse mit
den studentischen und beruflichen Anforderungen ist.
3. «Qualität(en)» beziehen sich nicht nur auf Qualität im Sinne normativer Vorstellungen
des «guten Praktikums» oder der «guten Mentorin», sondern auch auf die deskriptive
Unterscheidung der Beschaffenheit unterschiedlicher Kontexte, in denen Professiona-
lisierungsprozesse von Lehrer:innen und pädagogischen Fachpersonen stattfinden.
Damit verbunden sind neben der Untersuchung von Rahmenbedingungen wie Zeiträu-
men, Unterstützungssystemen und Anforderungslogiken von Professionalisierung im
Studienbereich auch Fragen der Qualifizierung der verschiedenen Akteur:innen. Ein
solcher Fragehorizont verweist auch auf die politische Dimension, die die Lehrer:in-
nenbildung massgeblich beeinflusst. Auswirkungen derartiger Einflussnahmen sind auf
Ebene der Praktiken konkret beobachtbar und verweisen nicht selten auf bemerkens-
werte Differenzen zwischen der programmatischen Absicht und dem beobachtbaren
‘impact’.
Mit dem Fokus des Kongresses auf Praktiken und Qualitäten kann und soll z.B. sichtbar ge-
macht werden,
− wie sich konzeptionelle Überlegungen zur engeren Kooperation zwischen den Institu-
tionen in Form eines «hybriden» oder «dritten Raums» (Fraefel, 2018; Zeichner 2010)
der Lehrer:innenbildung realisieren,
− wie in alternativen Wegen in den Lehrberuf (z.B. Quer- oder Seiteneinstieg) berufs-
praktische Bewährung, gar Professionalisierung angebahnt wird,
− wie sich die intensivierte Zusammenarbeit verschiedener Akteursgruppen konstituiert,
− welche Qualität(en) diese kennzeichnen und wie sie als konkretes Ausbildungsmilieu
oder als Professionalisierungsorientierungen beschreibbar werden, die je nach Situa-
tion explizit oder implizit zum Gegenstand der Aushandlung werden, miteinander kon-
fligieren, oder in ihrer Differenz unerkannt koexistieren.
Diese Praktiken und impliziten Wissensstrukturen in den verschiedenen Feldern der Lehrer:in-
nenbildung und in den diversifizierten Zugängen zum Beruf zu beleuchten, hat sich seit Jahren
die Professionalisierungsforschung zur Aufgabe gemacht, die als eine der Kerndisziplinen der
fachgesellschaftlichen Arbeit für den geplanten Kongress herangezogen werden soll, um z.B.
− den Status Quo von Konzeptionen und deren Umsetzung und Ausführung zu prüfen;
− Interaktionsdynamiken zu de- und rekonstruieren und in ihrer Wirkmächtigkeit (als
«Spuren») präzisieren zu können;
IGSP-Kongress 2023 3 / 10− ein differenziertes Verständnis der Vielfältigkeit der Prozesse und Einflussvariablen
auf das zu erzielen, was als «Professionalisierung» gekennzeichnet wird, auch, um
mittelfristig zur Grundlage konzeptioneller Weiterentwicklungen werden zu können;
− auf empirischer Basis Richtlinien und Standards Schul- und Berufspraktischer Studien
bezüglich notwendiger Rahmenbedingungen, konzeptioneller Ansprüche und Kompe-
tenzen der beteiligten Akteur:innen entwickeln zu können.
Um die verschiedenen an den Berufspraktischen Studien beteiligten Akteursgruppen zu einem
dreitägigen Diskurs über Konzeptionen, Positionen und aktuelle Erkenntnisse zusammenzu-
bringen, setzen wir auf bewährte Formate der bisherigen IGSP-Kongresse und ergänzen das
Format des ‘Workshops’:
− Keynotes von einschlägigen Kolleg:innen aus dem In- und Ausland
− Wissenschaftliche Symposien
− Workshops
− Forschungsforen
− Poster Slam
− Pre-Conference der Emerging Researchers
Der besonders engen Kooperation zwischen den Schulen der Deutschschweiz und den aus-
richtenden Pädagogischen Hochschulen Zürich und FHNW wird insofern Rechnung getragen,
als Angebote für Praxislehrpersonen und Ausbildungslehrpersonen im Tagungsprogramm ex-
plizit ausgewiesen und als Fortbildungsteilnahme bescheinigt werden.
Damit folgen wir dem Programm der Fachgesellschaft IGSP, die Vernetzung von Akteur:innen
und Forschenden im Kontext Schul- und Berufspraktischer Studien und die Entwicklung eines
eigenen Gegenstandsbereichs im Kontext von Professionsentwicklung und Professionalisie-
rungsforschung weiter zu befördern. Fachdidaktiker:innen, Erziehungswissenschaftler:innen,
Fachleute aller Phasen der Lehrer:innenbildung sowie Akteur:innen der Bildungsverwaltung
diskutieren dabei aus internationaler sowie inter- und transdisziplinärer Perspektive.
IGSP-Kongress 2023 4 / 10Call for Papers
Der Vorstand der IGSP und das lokale Organisationskomitee der PHZH und der PH FHNW
rufen dazu auf, Beiträge zum Kongress in folgenden Formaten vorzuschlagen:
1. Symposien (120 Min.)
In diesem Format werden drei bis vier wissenschaftliche Beiträge, davon mind. ein Bei-
trag einer Wissenschaftlerin/eines Wissenschaftlers in Qualifizierungsphase
(Emerging Researcher) in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht, präsentiert und
diskutiert. Ein Bezug zum thematischen Schwerpunkt der Tagung ist erwünscht, aber
nicht zwingend. Wird ein:e Diskutant:in beigezogen, sollten nicht mehr als drei Beiträge
vorgestellt werden. Ein Symposium setzt eine intensive vorgängige Abstimmung der
inhaltlichen Perspektivierung voraus und beinhaltet theoretische und/oder empirische
Beiträge zu einem thematischen Schwerpunkt.
2. Workshops (120 Min.)
In diesem Format werden Beiträge aufgerufen, in denen die (wissenschaftliche) Praxis
der Hochschule (z.B. hochschuldidaktische Verfahren der Analyse von Unterricht,
Übungs-/Trainingsformate zur Vorbereitung auf die berufliche Praxis) ebenso in einem
interaktiven Modus gezeigt und erlebbar gemacht werden kann, wie die Arbeit der be-
ruflichen Praxis im Zusammenhang mit den Schul- und Berufspraktischen Studien (z.B.
mit Verfahren kooperativer Unterrichtsplanung in Praktika).
Eine Bezugnahme auf das Tagungsthema ist gewünscht, insbesondere bezüglich der
Sichtbarmachung und Dokumentation von Praktiken der Berufspraktischen Studien.
Dieses Format eröffnet grosse Gestaltungsspielräume bezüglich der inhaltlichen Aus-
richtung (Konzeption und Entwicklung, Diskussion, Werkstattcharakter) und der Betei-
ligten (Praxislehrpersonen, Hochschulmitarbeitende, Studierende).
3. Forschungsforen (120 Min.)
In Forschungsforen werden Projekte zu bzw. mit aktuellen Forschungsfragen aus dem
Kontext Schul- und Berufspraktischer Studien vorgestellt. In Differenz zum Symposium
liegt der Schwerpunkt auf der gemeinsamen Diskussion bezüglich theoretischer, me-
thodologischer und methodischer Fragen der Vorhaben, die aus unterschiedlichen
Phasen des Forschungsprozesses stammen können. Forschungsforen haben insofern
kurze Vortrags- und längere Diskussionsphasen, sind thematisch idealerweise auf den
IGSP-Kongress 2023 5 / 10Tagungsschwerpunkt ausgerichtet und beziehen Emerging Researchers systematisch
ein. Der Einbezug von Diskutant:innen ist vorgesehen.
4. Einzelbeiträge (30 Min.)
Einzelbeiträge stellen Forschungs-, Konzeptions- und Evaluationsvorhaben aus den
Schul- und Berufspraktischen Studien vor. Die Präsentationszeit sollte 20 Minuten nicht
überschreiten, um Rückfragen und Diskussionen zu ermöglichen. Einzelbeiträge wer-
den vom Kongresskomitee thematisch gruppiert.
5. Poster
Auf Postern werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit ihren theoretischen
Grundannahmen, methodischen Vorgehensweisen und (Zwischen)ergebnissen struk-
turiert und graphisch attraktiv dargestellt. In einem Poster Slam werden angenommene
Poster in 2 Minuten vorgestellt, um im Anschluss daran in einer Postersession disku-
tiert zu werden.
IGSP-Kongress 2023 6 / 10Zeitplan Beitragseinreichung
Publikation des Call for Papers 20. April 2022
Beitragseingaben in Converia 1. Juli – 30. September 2022
Eingabe von Posterideen (Converia) 1. Juli – 31. Dezember 2022
Begutachtung der Beiträge 15. Oktober – 30. November 2022
Definitiver Entscheid über Annahme durch 5. – 9. Dezember 2022
Kongressleitung
Information der Autor:innen über Annahme/Ab- 15. Dezember 2022
lehnung
Ggf. Überarbeitung der Abstracts 15. Dezember 2022 – 15. Januar 2023
(in Converia möglich)
Begutachtung der Posterbeiträge durch Kon- 1. – 31. Januar 2023
gressleitung, Rückmeldung an Einreichende
Erstellung Tagungsprogramm 1. Februar bis 15. Februar 2023
Publikation Tagungsprogramm 15. Februar 2023
Organisatorische Hinweise
Anmeldung
• Die Anmeldung der Beiträge und der Teilnahme wird über das Konferenzverwaltungssys-
tem Converia gestaltet.
• Eine Tagungswebseite wird ab 1. Juli 2022 über www.ig-sp.org erreichbar sein.
• Formale Informationen zur Beitragseinreichung stehen ab dem 1. Juli 2022 auf der Ta-
gungswebseite zur Verfügung.
IGSP-Kongress 2023 7 / 10Konditionen
• Die Tagung findet vom 21.-23. Juni 2023 am Campus der Fachhochschule Nordwest-
schweiz in Muttenz (Schweiz) statt.
• Sie wird als Präsenztagung am in Muttenz geplant. Keynotes werden aufgezeichnet und
auf der Tagungshomepage für ein Jahr zur Verfügung gestellt, hybride Settings sind nicht
geplant.
• Die Tagung wird über Teilnahmebeiträge finanziert. Die Teilnahme ist daher kostenpflich-
tig, auch für Beitragende.
• Die Kongressgebühren sind nach Anmeldezeitraum gestaffelt:
o Frühbucher (bis 28.02.2023)
o Normalpreis (bis 07.05.2023)
o Spätbucher (ab 08.05.2023)
• Tagungsgebühren (inkl. Pausenverpflegung)
Early Bird Normalpreis Last Minute
(16.01. – (01.03. – Preise (ab
28.02.2023) 07.05.2023) 08.05.2023)
Normalpreis (Nicht-IGSP-Mitglie- 160,00 CHF 200,00 CHF 220,00 CHF
der )
Mitglieder der IGSP 130,00 CHF 180,00 CHF 190,00 CHF
Ermäßigt 80,00 CHF 100,00 CHF 110,00 CHF
(Wissenschaftliche Mitarbeitende
mit einer max. 65%-Stelle)
Praxislehrpersonen Tagesticket 45,00 CHF
Gesellschaftsabend (22. Juni 2023): 75,00 CHF
• Innerhalb der jeweiligen Zeiträume richten sich die Beiträge nach Zugehörigkeit zu be-
stimmten Gruppen. Neben Rabatten für Mitglieder der IGSP gibt es einen weiteren Ra-
batt für wissenschaftliche Mitarbeitende mit einer max. 65%-Stelle.
• Die Anmeldung zur Teilnahme ist verbindlich (mit der Anmeldung zur Tagung geht eine
Zahlungspflicht einher).
• Die Anmeldegebühr wird sofort mit der Anmeldung fällig und ist innerhalb von 14 Tagen
nach Absenden des Anmeldeformulars zu bezahlen.
• Ein Anspruch auf Teilnahme besteht erst nach Eingang des gesamten Teilnahmebei-
trags.
• Eine Erstattung der Gebühren ist ausgeschlossen. In Ausnahmefällen kann die Teil-
nahme auf eine andere Person übertragen werden.
IGSP-Kongress 2023 8 / 10• Geht eine verspätete Zahlung nicht vor Ablauf eines Rabattzeitraums ein, wird automa-
tisch der unrabattierte Betrag fällig.
• Änderungen des Kongressprogramms sind vorbehalten.
• Sofern die Veranstaltung aus Gründen der höheren Gewalt abgesagt werden muss, wer-
den die Gebühren erstattet. Es bestehen keine weiteren Verpflichtungen der Organisa-
tor:innen gegenüber der/m Teilnehmer:in. Die Anmeldungen bleiben hingegen gültig, falls
die Veranstaltung verschoben werden muss.
• Während des Kongresses werden Fotos gemacht und ggf. veröffentlicht. Wir bitten alle
Fotograf:innen die Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer:innen zu beachten und keine Por-
trait- oder Kleingruppenfotos ohne das ausdrückliche Einverständnis der abgebildeten Per-
son/en anzufertigen. Nach 21:00 Uhr ist Fotografieren auf den Kongressveranstaltungen
nicht gestattet.
IGSP-Kongress 2023 9 / 10Literatur
Alkemeyer, T. (2013). Subjektivierung in sozialen Praktiken. Umrisse einer praxeologischen Analytik. In
T. Alkemeyer, G. Budde, & D. Freist (Eds.), Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle Praktiken
der Subjektivierung (pp. 33-68). Bielefeld: transcript.
Fraefel, U. (2018). Hybride Räume an der Schnittstelle von Hochschule und Schulfeld: Ein
zukunftsweisendes Konzept der Professionalisierung von Lehrpersonen. In L. Pilypaityte & H.-
S. Siller (Eds.), Schulpraktische Lehrerprofessionalisierung als Ort der Zusammenarbeit (pp.
13-43). Wiesbaden: Springer VS.
Hackl, B. (2014). Praxis der Theorie und Theorie der Praxis. Die Rekonstruktion von Unterrichtsszenen
als Medium der Vermittlung von Wissenschaft und didaktischem Handeln. In I. Schrittesser, I.
Malmberg, R. Mateus-Berr, & M. Steger (Eds.), Zauberformel Praxis. Zu den Möglichkeiten und
Grenzen von Praxiserfahrungen in der Lehrerbildung (pp. 51-68). Wien: new academic press.
Hillebrandt, F. (2014). Soziologische Praxistheorien: Eine Einführung. Wiesbaden: Springer
Fachmedien Wiesbaden.
Idel, T.-S., & Schütz, A. (2017). Praktiken der Reflexion in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
Praxistheoretische Überlegungen zur Routinisierung professioneller Reflexivität am Beispiel
studentischer Portfolioarbeit. In C. Berndt, T. Häcker, & T. Leonhard (Eds.), Reflexive
Lehrerbildung revisited: Traditionen - Zugänge - Perspektiven (pp. 201-213). Bad Heilbrunn:
Klinkhardt.
Leonhard, T., Fraefel, U., Jünger, S., Kosinar, J., Reintjes, C., & Richiger, B. (2016). Zwischen
Wissenschafts- und Berufspraxis. Berufspraktische Studien als dritter Raum der
Professionalisierung von Lehrpersonen. Zeitschrift für Hochschulentwicklung. doi:10.3217/zfhe-
11-01/05
Reckwitz, A. (2003). Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken: Eine sozialtheoretische
Perspektive. Zeitschrift für Soziologie, 32(4), 20.
Reh, S., Fritzsche, B., Idel, T.-S., & Rabenstein, K. (Eds.). (2015). Lernkulturen: Rekonstruktion
pädagogischer Praktiken an Ganztagsschulen. Wiesbaden: Springer VS.
Schatzki, T. R. (2002). The site of the social: a philosophical account of the constitution of social life and
change. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
Schrittesser, I., & Hofer, M. (2012). Lehrerbildung als kulturelle Praxis? Wie Pierre Bourdieus
Habitusbegriff die Kulturen der Lehrerbildung und der Schulpraxis einander näher bringen
könnte …. In C. Kraler, H. Schnabel-Schüle, M. Schratz, & B. Weyand (Eds.), Kulturen der
Lehrerbildung: Professionalisierung eines Berufsstands im Wandel (pp. 141-154). Münster:
Waxmann.
Zeichner, K. (2010). Rethinking the Connections Between Campus Courses and Field Experiences in
College- and University-Based Teacher Education. Journal of Teacher Education, 61(1–2), 89–
99.
IGSP-Kongress 2023 10 / 10Sie können auch lesen