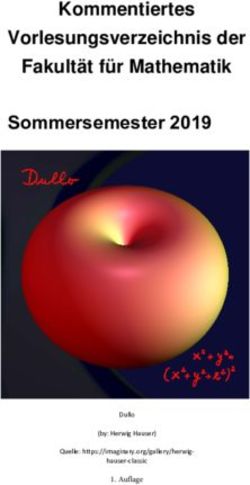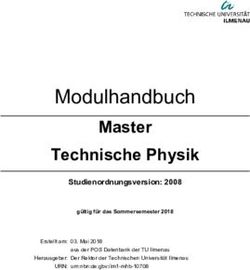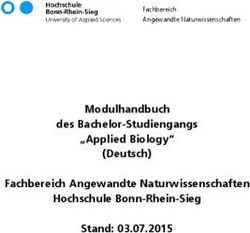Modulhandbuch B. Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit (PPPG) (berufsbegleitend und fachweiterbildungsintegrierend) Studiengangsleitung: ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Modulhandbuch B. Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit (PPPG) (berufsbegleitend und fachweiterbildungsintegrierend) Studiengangsleitung: Prof. Dr. Marcellus Bonato Prof. Dr. Andrea Zielke-Nadkarni Stand: 06.03.2019
2
Präambel
Das nachfolgend beschriebene Modulhandbuch konkretisiert die inhaltlichen Grundla-
gen, Kompetenzen und Zieldimensionen der Module des berufsbegleitenden und fach-
weiterbildungsintegrierenden Studiengangs B. Sc. Psychiatrische Pflege / Psychische
Gesundheit (PPPG). Die Module der FH sind mit (FH) gekennzeichnet, die Module der
Fachweiterbildung sind mit (WB) gekennzeichnet. Letztere werden in Form der Aner-
kennung in das Studium integriert und entsprechen in ihrer Stundenzahl der Weiterbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe (WBVO-Pflege-NRW) der Fachwei-
terbildung Psychiatrie. Eine Ausnahme von diesen Anerkennungen bilden die 3 Mo-
dule „Pflege in der Allgemeinpsychiatrie“, „Pflege akut psychisch erkrankter Menschen
und psychiatrische Interventionen in Krisen“ sowie „Pflegerische Versorgung chronisch
psychisch kranker Menschen“. Diese werden gemeinsam von der FH und der WB ver-
antwortet und sind im Titel mit (FH & WB) gekennzeichnet.
Modulhandbuch B.Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit (PPPG) Stand: 06.03.20191 1.1 Modulbezeichnung (dt. / engl. 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 01: Grundlagen der Psychologie und der psy-
chiatrischen Versorgung im Gesundheitswesen (FH)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit Pflicht 1. Fachsemester
3. Fachsemester
BB PPPG vom 22.01.19 Anlage 2
Zusammenlegung von LV
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkte
Lehrform Semester je in Std. (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Seminaristischer Unterricht
Kontaktzeit 01a Grundlagen der Psychologie 2 30
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer und Gesundheitspsychologie
Unterricht, Projekt-/ 01b: Psychische Gesundheit / 2 30
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes Tutorium)
Krankheit und psychiatrische
(weitere Zeilen möglich) Versorgung im
Gesundheitswesen
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in 150 5 CP
Std. 60
Selbststudium Vorbereitung und Nachbereitung 45
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, Vorbereitung und Nachbereitung 45
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 90
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz
Die Studierenden erwerben die Kompetenz, den Untersuchungsgegenstand der Psychologie insbesondere der
Gesundheitspsychologie zu definieren, ihre Prinzipien zu beschreiben und zusammenzufassen.
Sie erkennen die Auswirkungen von Modellen von Gesundheit u. Krankheit verschiedener Bevölkerungsgruppen und
von Determinanten psychischer Gesundheit. Sie skizzieren Arbeitsfelder psychiatrischer Versorgung /
Organisationsstrukturen und Behandlungsansätze psychiatrischer Einrichtungen und Dienste. Die Studierenden
wissen um die Bedeutung von Gesundheits- und Pflegeberichterstattung.
Methodenkompetenz
Die Studierenden werden befähigt, psychologische Theorien, Ansätze und Instrumente der Psychologie,
Gesundheitspsychologie für konkrete Situationen in stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen
Settings angemessen auszuwählen und den Übertrag der theoretischen Begrifflichkeiten und Implikationen zu
leisten.
Sie nutzen Modelle von Gesundheit und Krankheit verschiedener Bevölkerungsgruppen und von Determinanten
psychischer Gesundheit als Entscheidungshilfen.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.0Sozialkompetenz
Die Studierenden werden in die Lage versetzt, grundlegende (gesundheits-) psychologische Theorien klar und
adressatengerecht vermitteln zu können. Durch den Austausch im Plenum werden zudem die Dialog- und
Kritikfähigkeit ausgebildet und/oder gefördert.
Selbstkompetenz
Den Studierenden wird ermöglicht, die eigene Lebenswelt im Kontext der Inhalte der in der Lehrveranstaltung
behandelten Teildisziplinen zu reflektieren und zu nutzen sowie eigene Grenzen wahrzunehmen und eigene Motive
klären zu können.
5.2 Lerninhalte
Einführung in die Psychologie
Untersuchungsgegenstand der Psychologie
Theorien und Modelle der Lernpsychologie, Motivationspsychologie, Gesundheitspsychologie
Psychische Gesundheit / Krankheit und psychiatrische Versorgung im Gesundheitswesen:
Psychische Gesundheit und Krankheit von Bevölkerungsgruppen
Definitionen, Abgrenzungen, Modelle von Gesundheit u. Krankheit
Determinanten psychischer Gesundheit
Epidemiologischer Wandel und psychische Gesundheit
Einführung in die deutsche Gesundheitspolitik
Gesundheitsberichterstattung/Pflegeberichterstattung
Arbeitsfelder psychiatrischer Versorgung / Organisationsstrukturen und Behandlungsansätze psychiatrischer
Einrichtungen und Dienste
→ zu den Details: siehe Vorlesungsverzeichnis, Lehrveranstaltungsplan etc.
6 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten). Die
jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
Keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/-en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc. entnommen
werden).
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01 1.1 Modulbezeichnung (dt. / engl.) 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 2: Beziehungsgestaltung und
Fallverantwortung (WB)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit Pflicht 1. Fachsemester
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkt
Lehrform Semester je in Std. e (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Seminaristischer Unterricht
Kontaktzeit 2: Beziehungsgestaltung und 40
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer Fallverantwortung
Unterricht, Projekt-/
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes
Tutorium) (weitere Zeilen
möglich)
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in
Std. 40
300 Std. 10 CP
Selbststudium Angeleitetes Selbststudium; 10
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, (Angeleitete) Praktische 250
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von Weiterbildung
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 260
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz:
• (psychologische) Modelle der Beziehungsgestaltung beschreiben und vergleichen
• wichtige Begriffe der allgemeinen Ethik prägnant beschreiben und Bedeutungen ableiten
• Fragen und Themengebiete der Ethik in Pflege und ethische Prinzipien beschreiben und transferieren
• Konzepte der Beratung und Anleitung beschreiben (z.B. Experten- und Prozessberatung, Psychoedukation
u.a.) und individuell übertragen
• Prozess der Interaktionsgestaltung beschreiben und in versch. Kontexten wiedererkennen
• Organisationsformen der Pflege, die sich förderlich auf den Beziehungsprozess auswirken, beschreiben und
kritisch einordnen
Methodenkompetenz
• Prozessschritte der Interaktionsgestaltung anwenden, um eine auf Vertrauen basierende Beziehung zu
realisieren (Klienten und Angehörige)
• Beziehungen als ein zentrales Element der psychiatrischen Pflege nutzen
• pflegerisches Handeln auf der Grundlage ethischer Prinzipien analysieren
• unterschiedliche Kommunikationsformen fach- und situationsgerecht einsetzen
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.0• die Organisationsform Bezugspflege in der Orientierung an diversen Organisationsmodellen (z.B. Primary-
nursing) gestalten
• situationsgerecht Anleitungs- und Beratungskonzepte anwenden (z. B. Psychoedukation u. a.)
Sozialkompetenz:
• pflegerisch-psychiatrisches Handeln im Dialog mit anderen Berufsgruppen auf der Grundlage
pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse und auf der Basis des evidence based nursing, sowie solchen aus
entsprechenden Bezugswissenschaften, begründen
• Klienten und deren Bezugspersonen beraten
Selbstkompetenz
• das Expertentum der Klienten anerkennen und diese Erkenntnis für ihre persönliche und damit auch
berufliche Entwicklung nutzen
• Sensibilisierung für Selbstwahrnehmungsprozesse, um sie bei Klienten, Angehörigen und Kollegen zur
Wahrnehmungsvervollständigung sowie zur Evaluation und Weiterentwicklung der Beziehungsarbeit zu
nutzen und kritisch zu reflektieren
5.2 Lerninhalte
1. Menschenbild und Werte, Grund- und Arbeitshaltung
2. Beziehungsarbeit in der psychiatrischen Pflege
- Grundlagen des Wahrnehmungsprozesses (Wahrnehmen-Interpretieren-Fühlen-Handeln)
- Prozess sozialer Interaktion als zentrale Methode einer personenzentrierten Beziehungsgestaltung
- Beziehungsdynamiken (z. B. Übertragung-Gegenübertragung, Helfersyndrom)
- Soziale Konzepte und Rollenhandeln als Prozess
3. Komponenten gelingender zwischenmenschlicher Beziehung (z. B. nach J. Bauer)
Drei-Phasen-Modell des Vertrauensaufbaus (z. B. nach Petermann)
4. Moralische und ethische Aspekte in der Beziehungsgestaltung
5. Modelle der Beratung und Anleitung
6 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten).
Die jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich
festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/ -en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc.) entnommen
werden.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01 1.1 Modulbezeichnung (dt. / engl.) 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 3: Eigene Lernwege gestalten (WB)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit Pflicht 1. Fachsemester
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkt
Lehrform Semester je in Std. e (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Seminaristischer Unterricht
Kontaktzeit 3: Eigene Lernwege gestalten 60
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer
Unterricht, Projekt-/
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes
Tutorium) (weitere Zeilen
möglich)
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in
Std. 60
150 Std. 5 CP
Selbststudium Angeleitetes Selbststudium; 10
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, (Angeleitete) Praktische 80
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von Weiterbildung
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 90
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz
• Lernformen nebst der neurobiologischen Grundlagen beschreiben und einordnen
• Besonderheiten im Lernen Erwachsener erkennen und berücksichtigen
• Lerntypen und Lernmethoden gegenüberstellen
• Modelle des Zeitmanagements kennen und in ihrer Auswirkung einordnen
• Recherchemethoden auswählen
• Methode des Rollenspiels erläutern
• Merkmale wissenschaftlich orientiertes Arbeitens erläutern und beurteilen
Methodenkompetenz
• Lerninhalte adressatengerecht aufarbeiten
• lernförderliche Milieus gestalten
• mit Klienten passgenaue Zeitmanagementmethoden identifizieren
• fachspezifische Literatur recherchieren, auch aus dem angloamerikanischen Raum, auf der Grundlage div.
Recherchemethoden
• das Rollenspiel und Videotraining als Methode des sozialen Lernens in verschiedenen Settings beherrschen
• wissenschaftlich orientiert arbeiten (einschl. Schreiben eines wissenschaftlich orientierten Textes)
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.0• fachspezifische Literatur beurteilen hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit im fachspezifischen Kontext, um zu
einer Evidenzbasierung im Arbeitsfeld beizutragen
Sozialkompetenz
• aus dem Pool von Zeitmanagementmethoden zielgruppenadäquate und situationsgerechte Methoden
vermitteln und im beruflichen Handlungsfeld anwenden
• Personen mit Pflegebedarf bei der Analyse des eigenen Lerntyps und bei der Auswahl geeigneter
Lernmaterialien unterstützen
• Lernprozesse gemeinsam mit anderen initiieren und sie zielgerichtet gestalten
• fachkundigen Dritten das professionelle Handeln begründend darstellen, im kritischen Diskurs argumentativ
verteidigen und wenn erforderlich ggf. Veränderungen vornehmen
Selbstkompetenz
• eigene Lernkompetenz und Reflexionsfähigkeit weiterentwickeln
• unterschiedliche Lerntechniken und moderne Informationsmedien zur Selbststeuerung des eigenen Lernens
nutzen
• eigenen Lernbedarf eruieren und Lernprozesse für sich initiieren
• kriterienorientiert Ergebnisse aus Evaluationsstudien zur Reflexion ihrer eigenen Tätigkeit nutzen
• auf Basis der Lehrinhalte den eigenen Umgang mit unterschiedlichen Informationsquellen reflektieren
• individuellen Wissensstand für das eigene Handlungsfeld bewerten, den Lernbedarf erkennen und
Lernkontrakte definieren
5.2 Lerninhalte
• Modelle und Theorien zum Lernen als Änderung im Verhalten, Denken und Fühlen
• Besonderheiten im Lernen Erwachsener
• Lerntypen, Effektivität und Erfolg des Lernens mit kritischer Auseinandersetzung zu Möglichkeiten und
Grenzen
• Lernstile, Lernmethoden, Zeitmanagement sowie Arbeitsmethodik
• Pflegeforschung
• Wissenschaftlich orientiertes Arbeiten
o wissenschaftlich orientiertes Arbeiten und Schreiben von wissenschaftlich orientierten Texten
o Schritte und Methoden des evidence based nursing (EBN)
o Recherche und Verarbeitung von Literatur (Nutzung elektronischer Medien)
• Englische Fachbegriffe
→ zu den Details: siehe Vorlesungsverzeichnis, Lehrveranstaltungsplan etc.
6 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten).
Die jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich
festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/-en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc.)
entnommen werden.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01 1.1 Modulbezeichnung (dt. / engl.) 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 4: Pflege in der Allgemeinpsychiatrie (WPM)
(FH & WB)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege / Psychische Gesundheit Wahlpflichtmodul 1. Fachsemester
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkt
Lehrform Semester je in Std. e (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Seminaristischer Unterricht
Kontaktzeit 4: Pflege in der 70
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer Allgemeinpsychiatrie
Unterricht, Projekt-/
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes
Tutorium) (weitere Zeilen
möglich)
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in
Std. 70
300 Std. 10 CP
Selbststudium Angeleitetes Selbststudium; 10
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, (Angeleitete) Praktische 220
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von Weiterbildung
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 230
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz
• die aktuellen, medizinischen, psychologischen und sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätze über
Entwicklung von Entstehung und Verlauf von psychiatrischen Krankheitsbildern / Störungsbildern
beschreiben und vergleichen
• Erscheinungsformen (Symptome) der unterschiedlichen Krankheitsbilder / Störungsbilder beschreiben und
abgrenzen
• Grundprinzipien der Psychopharmakatherapie und anderer Therapieformen (z.B. Psychotherapie,
Verhaltenstherapie, Soziotherapie, Milieutherapie…) erläutern und vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Settings einordnen
• Wirkung und Nebenwirkung der Therapieverfahren erklären
• Grundprinzipien der therapeutisch wirksamen Milieugestaltung beschreiben und Anwendungsbezüge
herstellen
• Auswirkungen der Erkrankungen auf die selbständige Alltagsgestaltung identifizieren
• die mit unterschiedlichen Störungsbildern verbundenen Pflegediagnosen und die dazugehörigen Konzepte
identifizieren und erläutern (z. B. Entstehungsbedingungen von und Umgang mit Aggression und Gewalt im
Rahmen akuter und chronisch verlaufender Störungsbilder)
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.0• die zum Aufbau einer tragfähigen therapeutisch wirksamen Beziehung notwendigen Schritte /
Vorgehensweisen ableiten und adaptieren
• Struktur des pflegerischen Beitrags zur Therapiekonferenz aufbauen
• Merkmale einer pflegerisch-psychiatrischen Gruppe transferieren
• Struktur (Aufbau + Ablauf) einer pflegerischen Gruppe entwickeln, begründen und argumentieren (z. B.
Phasen einer Gruppenstunde und welche Ziele mit Hilfe welcher Maßnahmen in den jeweiligen Phasen
angestrebt werden)
• Stadien der Gruppenentwicklung (im Längsschnitt) kritisch hinterfragen und aufzeigen, welche Aufgaben
sich für die Gruppenleitung ergeben
Methodenkompetenz
• ein auf die Grunderkrankung abgestimmtes therapeutisch wirksames Milieu gestalten
• Instrumente zur Erhebung des Pflegebedarfs fallspezifisch einsetzen, Pflegeerfordernisse bedarfs- und
bedürfnisorientiert ableiten und daraus resultierende Pflegerfordernisse zielgerichtet planen
• Evaluationsinstrumente auf ihre Eignung hin beurteilen und diese eigenverantwortlich und fallspezifisch
anwenden
• gemeinsam mit Patienten und Klienten sowie anderen Berufsgruppen Wirkungen und Nebenwirkungen von
Therapieverfahren einschätzen und Personen mit Pflegebedarf dazu bedarfsorientiert beraten
• pflegerisch-psychiatrische Gruppen (z. B. Angehörigengruppen / Psychoedukation / Metakognitives Training
/ Gruppen im Rahmen der Adherence-Therapie / im Rahmen der Soziotherapie) konzipieren, planen,
durchführen, evaluieren und dokumentieren
• Personen mit Pflegebedarf und deren Angehörige auf der Grundlage von Beratungskonzepten beraten
• tragfähige Beziehungen auf der Grundlage von spezifischen Konzepten aufbauen und gestalten
• Methoden der Deeskalation adaptieren
• Modelle zur Motivation (z. B. Rubikon-Modell, Motivational Interviewing) transferieren
Sozialkompetenz
• Patienten / Klienten bei der Entwicklung individueller Bewältigungsstrategien im Umgang mit ihrer
Erkrankung unterstützen und gemeinsam mit ihnen und ihren Angehörigen Strategien entwickeln, um eine
optimale Versorgung nach der klinischen Behandlung sicherzustellen
• in der Interaktion mit allen Beteiligten die Interessen der Klienten / Patienten vertreten und sie in
Auseinandersetzungen mit den Angehörigen des multiprofessionellen Teams unterstützen
• in Konfliktsituationen unterschiedliche Standpunkte kritisch einordnen, Begründungszusammen-hänge
herstellen und Alternativen aushandeln; ggf. da wo notwendig eigenen Standpunkt (differenziert und
adressatengerecht) begründend und wertschätzend durchsetzen
• im kritischen Diskurs den pflegerischen Beitrag zur Therapiekonferenz argumentativ vertreten
• die Interessen von Patienten und Klienten im komplexen Netzwerk gemeindepsychiatrischer Hilfen vertreten
• zwischen Klinik, Patient / Klient und gemeindepsychiatrischem Verbund vermitteln
• mit Individuen und Gruppen anderer Kulturen erfolgreich und angemessen interagieren
Selbstkompetenz
• eine professionelle Haltung zu herausforderndem Verhalten (Selbst- und Fremdaggression, Suizidalität, sog.
„Noncompliance“) entwickeln
• persönliche Stresssignale und „Di-Stress“ frühzeitig erkennen und diesen entgegenwirken (Work-Live-
Balance)
• das eigene Handeln in kritischen und emotional herausfordernden Situationen kritisch reflektieren
• die eigene Lebenswelt im Kontext der Inhalte „Umgang mit Zwang und Gewalt“ sowie „Würde und Toleranz“
reflektieren
• Förderung der eigenen Gesundheit durch persönliches Stressmanagement
5.2 Lerninhalte
• Gesundheitsförderung und Prävention
• Modelle von Gesundheit und Krankheit (z. B. Vulnerabilität-Stress-Coping-Modell und Salutogenese)
• Allgemeine Psychopathologie und Klassifikationen psychischer Erkrankungen
- ICD und DSM
- AMDP Systematik
• Schizophrene Psychosen (Klassifizierung, Symptome, Verläufe, Therapien)
• Affektive Störungen (Klassifizierung, Symptome, Verläufe, Therapien)
• Organische psychische Störungen (Klassifizierung, Symptome, Verläufe, Therapien)
• Persönlichkeitsstörungen (Klassifizierung, Symptome, Verläufe, Therapien)
• Essstörungen (Klassifizierung, Symptome, Verläufe, Therapien)
• Abhängigkeitserkrankungen (Klassifizierung, Symptome, Verläufe, Therapien)
• Pharmakologische Behandlung und andere Behandlungsmethoden
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.0• Pflegeprozess (unter Nutzung pflege- und bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse)
- Assessment und Assessmentinstrumente, zum Assessment benötigte Kompetenzen
- Pflegediagnostischer Prozess (NANDA orientiert)
- Zielformulierung anhand der individuellen Verlaufsphasen psychiatrischer Erkrankungen
- Entwicklung und kritische Beurteilung angemessener Interventionen
• Multiprofessionelle Behandlungsplanung in der Pflege allgemeinpsychiatrisch erkrankter Menschen
• Pflegerisch-psychiatrische Gruppenarbeit
• Pflegetherapeutische Einzelangebote
• Sozio- und Milieutherapie
• Beratung als zentrale pflegerische Aufgabe
• Lebenswelt von Betroffenen, insbesondere Angehörigenarbeit
→ zu den Details: siehe Vorlesungsverzeichnis, Lehrveranstaltungsplan etc.
6 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten).
Die jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich
festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/-en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc.) entnommen
werden.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01 1.1 Modulbezeichnung (dt. / engl. 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 05: Forschungsmethoden (FH)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege/Psychische Gesundheit Pflicht 2. Fachsemester
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkt
Lehrform Semester je in Std. e (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Seminaristischer Unterricht
Kontaktzeit 05a Empirie 2 30
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer 05b Deskriptive Statistik 2 30
Unterricht, Projekt-/
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes
Tutorium) (weitere Zeilen
möglich)
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in
Std. 60
150 5 CP
Selbststudium Vorbereitung und Nachbereitung 45
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, Vorbereitung und Nachbereitung 45
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 90
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz
Einfachere Evaluationsstudien in Fachzeitschriften lesen und verstehen und angemessen beurteilen (CONSORT-
Kriterien; kritische Würdigung)
Methodenkompetenz
Ergebnisse aus Evaluationsstudien im Sinne einer evidenzbasierten Praxis anwenden
Sozialkompetenz
Ergebnisse aus empirischen Studien zielgruppenadäquat und situationsgerecht unter Beachtung der empirischen
Evidenz vermitteln und/oder im beruflichen Handlungsfeld anwenden und implementieren
Selbstkompetenz
Ergebnisse aus Evaluationsstudien zur Reflexion der eigenen Tätigkeit nutzen
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.05.2 Lerninhalte
Grundsatz: Integrierte Lehre der Empirie und Deskriptiven Statistik zu einer inhaltlichen Thematik aus dem
psychiatrischen Versorgungskontext
• Beobachtungsverfahren
• Befragungsmethoden
• experimentelle Planung
• Planung von Evaluationsstudien
• Standards von Evaluationen
• Skalenniveaus; Lage- und Streuungsmaße; Fehlende Werte; Grafische Darstellungen; Korrelation und
Assoziation
→ zu den Details: siehe Vorlesungsverzeichnis, Lehrveranstaltungsplan etc.
6 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten).
Die jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich
festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/-en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc. entnommen
werden).
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01.1 Modulbezeichnung (dt. / engl.) 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 06: Theoretische Grundlagen psychiatrischer
Versorgung und Gesundheitsförderung (FH)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B. Sc. Psychiatrische Pflege / Psychische Gesundheit Pflicht 2. Fachsemester
4. Fachsemester
BB PPPG vom 22.01.19 Anlage 2
Zusammenlegung von LV
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkte
Lehrform Semester je in Std. (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
Seminaristischer Unterricht 15 Semesterwochen
Kontaktzeit 06a: Gesundheitsförderung in der 2 30
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer psychiatrischen Versorgung
Unterricht, Projekt-/ 06b: Theoretische Grundlagen 2 30
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes Tutorium)
der Pflege mit Schwerpunkt
(weitere Zeilen möglich) psychische Gesundheit
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in 150 5
Std. 60
Selbststudium Vorbereitung und Nachbereitung 45
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, Vorbereitung und Nachbereitung 45
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 90
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz: aktuelle theoretische pflegewissenschaftliche Grundlagen der psychiatrischen Pflege rezipieren,
beschreiben, kritisch betrachten und in der Praxis damit arbeiten. Gesundheitsförderung & Prävention in der
psychiatrischen Versorgung definieren, ihre Prinzipien beschreiben und zusammenfassen.
Methodenkompetenz: Die Studierenden werden befähigt, psychologische Theorien, Ansätze und Instrumente
Gesundheitsförderung einzusetzen und Instrumente, Techniken, Organisationsformen, Prinzipien und
Modelle/Theorien der psychiatrischen Pflege gegeneinander abzuwägen und in verschiedenen Settings gezielt
patientenzentriert einzusetzen.
Sie verstehen Prävention auch als Gesundheitsaufklärung, –beratung, -erziehung, -bildung inkl. EdE (Experten durch
Erfahrung) und wenden sie dementsprechend an.
Sozialkompetenz: im Team fallbezogene Entscheidungen auf der Basis theoretischer pflegewissenschaftlicher
Grundlagen diskutieren, fällen, in ihren Konsequenzen reflektieren.
In der Praxis reflektieren die Studierenden Gesundheitsförderung & Prävention interdisziplinär und unter
Berücksichtigung der Expertise der Experten durch Erfahrung (EdE).
Selbstkompetenz: eine eigenständige, selbstkritische Haltung zu a) gesellschaftlichen Normalitätserwartungen b)
Personen mit psychischen Erkrankungen c) berufspolitischen Fragestellungen entwickeln; persönliche Werte und
Normen erkennen und als eine der möglichen Perspektiven auf die Lebenswelt reflektieren.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.05.2 Lerninhalte
Grundlagen der Gesundheitsförderung
• Gesundheitsförderung & Prävention: Begriffe und Abgrenzung;
• Ansätze der Gesundheitsförderung: z.B. Setting-Ansätze (WHO);
• Präventionskonzepte und deren kritische Betrachtung;
• Empowerment, shared-decision-making & Partizipation als Prinzipien; Salutogenese als
Rahmenmodell, NANDA-Diagnosen;
• Instrumente der Gesundheitsförderung & Prävention in (teil-)stat. & ambl. psych. Settings, alters-
und institutionsspezifisch, inkl. EdE (Experten durch Erfahrung)
Pflegewissenschaftliche Grundlagen der psychiatrischen Pflege:
Aufgaben: z.B. beobachten (Krankheitsverlauf, Suizidgefahr) begleiten (Gesprächsführung, Krisenbegleitung), beraten
(z.B. Patienten, Angehörige) unterstützen (Selbstpflegemaßnahmen, Annahme von Therapieangeboten,
Alltagsbewältigung, Erhalt und Aufbau sozialer Beziehungen, Entwicklung von Coping Strategien), aufklären
(Psychoedukation, Soziotherapie, Milieutherapie)
Organisationsformen: Partnerschaft im interdisziplinären Team, sektoral: Bezugspflege, Primary Nursing,
Überleitungspflege; intersektoral: Care-/Case-Management;
Theoretische Konzepte: z.B. Patientenzentrierung, Empowerment, Recovery, Partizipation,
(theoretische) Prinzipien der psychiatrischen Pflege: z.B. Alltagskompetenz fördern, aktivierend pflegen, biographisch
arbeiten,
Instrumente/Techniken der psychiatrischen Pflege: z.B. Pflegeprozess, Pflegediagnosen NANDA, Pflegevisite
Erkenntnistheoretische Ansätze: Verstehende Soziologie (Hermeneutik, Symbolischer Interaktionismus),
Konstruktivismus, Systemtheorie
Modelle und Theorien in der psychiatrischen Pflege: (z.B. Peplau, Friedemann, B. Neuman, King)
Forschungsfelder: z.B. Interventionsforschung; Effektivitäts-/Evaluationsforschung, nutzerbezogene Forschung,
Biographieforschung
→ zu den Details: siehe Vorlesungsverzeichnis, Lehrveranstaltungsplan etc.
6 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten). Die
jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/ -en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc.) entnommen
werden.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01 1.1 Modulbezeichnung (dt. engl.) 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
Modul 7a: Wahlpflichtmodul Gerontopsychiatrische
Pflege (WB)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege / Psychische Gesundheit Wahlpflicht 2. Fachsemester
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkt
Lehrform Semester je in Std. e (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Seminaristischer Unterricht
Kontaktzeit 7a: Wahlpflichtmodul 70
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer Gerontopsychiatrische Pflege
Unterricht, Projekt-/
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes
Tutorium) (weitere Zeilen
möglich)
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in
Std. 70
300 Std. 10 CP
Selbststudium Angeleitetes Selbststudium; 10
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, (Angeleitete) Praktische 220
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von Weiterbildung
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std.230
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz
• gerontopsychiatrische Erkrankungen (z. B. affektive Störungen im höheren Lebensalter, paranoide
Störungen im höheren Lebensalter sowie organische, einschließlich symptomatische psychische Störungen
im höheren Lebensalter inklusive der Demenzsyndrome) anhand von Symptomen, Verlauf und
Behandlungsmethoden erläutern
• das Personenzentrierte Modell nach T. Kitwood differenziert darstellen und Konsequenzen für pflegerischen
Handeln ableiten
• spezielle gerontopsychiatrische Konzepte (z.B. Biografiearbeit / Validation / Realitätsorientierungstraining
ROT) anwendungsbezogen beschreiben
• die nationalen Expertenstandards anhand der unterschiedlichen Qualitätsebenen darstellen und die
enthaltenen grundlegenden diagnostische Verfahren und Interventionen erläutern
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.0Methodenkompetenz
• den individuellen Pflegebedarf von gerontopsychiatrischen Patienten erkennen und erheben, die
erforderliche Pflege zielgerichtet planen, die Selbsthilfepotentiale der Betroffenen aktivieren, die Pflege unter
Berücksichtigung der Expertenstandards eigenverantwortlich durchführen und den Verlauf dokumentieren
• im eigenen Handeln aktuelle medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze
über Entstehung und Verlauf von gerontopsychiatrischen Erkrankungen und Verhaltensweisen nutzen
• in die Pflege spezielle Pflegetechniken integrieren, wie Validation, Biografiearbeit, Entspannungstechniken,
Basale Stimulation und Snoezelen
• das eigene Wissen über ethische Aspekte, pharmakologische, somatische und andere Therapieverfahren in
die gerontopsychiatrische Pflege integrieren
• Lebensqualität förderndes Milieu in gerontopsychiatrischen Einrichtungen gestalten und dessen Auswirkung
auf die Erkrankung nutzen sowie das Leben und die Arbeit in der Einrichtung unter den Aspekten von
Zwang und Gewalt reflektieren
• pflegerische Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der gerontopsychiatrischen Behandlung planen und
diese selbständig durchführen und evaluieren
• relevante rechtliche Grundlagen für die Arbeit in gerontopsychiatrischen Einrichtungen berücksichtigen
Sozialkompetenz
• grundlegende pflegerische Versorgungsformen und innovative Ansätze kennen und vermitteln sowie
Gespräche und Assessments fallbezogen durchführen
• für die Kooperation und Koordination mit anderen Gesundheitsberufen und Angehörigen sowie Networking
mit anderen Organisationen im Gerontopsychiatrischen Verbund offen sein und sich konstruktiv mit der
Profession der Pflege einbringen
• zur Arbeit im Netzwerk gerontopsychiatrischer Hilfen befähigt sein und die Selbsthilfepotentiale des
Betroffenen, den sie als primären Auftraggeber sehen, aktivieren
• Sterbende und deren Bezugspersonen würdevoll und orientiert an den Bedürfnissen der
Sterbenden und Bezugspersonen bis zum Tod begleiten
• Patienten und deren Bezugspersonen im Rahmen des SGB XI beraten
Selbstkompetenz
• die anvertrauten und sich anvertrauenden Menschen in ihrer Einzigartigkeit umfassend und insbesondere
unter Berücksichtigung der von Patienten gelebten Geschichte wahrnehmen, achten und wertzuschätzen
• das pflegerische Handeln subjektorientiert und unter Einbezug der kulturellen und geschlechtsspezifischen
Sichtweisen würdevoll gestalten
• die persönliche und berufliche Lebenswelt im Hinblick auf das Altern und den damit verbundenen
Veränderungen reflektieren
• sich der eigenen ethischen Verantwortung bewußt werden und diese für das eigene berufliche
Handlungsfeld nutzen
5.2 Lerninhalte
• die demografische Entwicklung und Folgeerscheinungen
• Alterstheorien: vom Defizitmodell bis zum SOK Modell
• gerontopsychiatrische Erkrankungen
- affektive Störungen im höheren Lebensalter
- paranoide Störungen im höheren Lebensalter
- organische einschließlich symptomatische psychische Störungen im höheren Lebensalter (einschließlich
der Demenzsyndrome)
• Grundlagen und Gestaltung eines lebensqualitätsfördernden Milieus
• das Personenzentrierte Modell nach T. Kitwood und die Ableitung pflegerischen Handelns
• spezielle gerontopsychiatrische Konzepte:
- Biografiearbeit
- Validation
• pflegerisch-psychiatrische Gruppenarbeit spezifisch gerontopsychiatrisch
• pflegetherapeutische Einzelangebote spezifisch gerontopsychiatrisch
• Verwirrtheit als Pflegephänomen
• Kommunikation und Interaktion mit gerontopsychiatrisch veränderten Menschen
• Aufnahme- und Entlassungssituationen sowie Pflegeüberleitung
• Begleitung und Beratung der Angehörigen
• Ethische Aspekte: Zwang und Gewalt gegen alte Menschen
• Expertenstandards (DNQP)
• Altern in der Gesellschaft
→ zu den Details: siehe Vorlesungsverzeichnis, Lehrveranstaltungsplan etc.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.06 Teilnahmevoraussetzungen (Formal: Prüfung in Modul XY muss bestanden sein o. ä.; Inhaltlich: Modul XY sollte absolviert sein, folgende Kenntnisse sollten
vorhanden sein, …)
keine
7 7.1 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (z. B. Bestehen der Prüfung, erfolgreicher Abschluss einer Studienleistung, regelmäßige und
aktive Teilnahme)
Bestehen der Prüfung
7.2 Prüfungsformen und -umfang (z. B. Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit, Präsentation, Portfolio, Dauer der Prüfung in Min.)
Wird regelmäßig abgeschlossen durch Klausur (2. Std.), mündliche Prüfung (30 Min.) oder Hausarbeit (10 Seiten).
Die jeweilige Prüfungsform wird vom Prüfungsausschuss grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn verbindlich
festgelegt.
7.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung
keine
7.4 Gewichtung der Note bei Ermittlung der Endnote
s. Prüfungsordnung/ -en für oben (Zeile 3) genannte Studiengänge*
*Die Prüfungsordnungen der Studiengänge finden Sie in den Amtlichen Bekanntmachungen der FH Münster unter dem folgenden Link
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/amtliche_bekanntmachungen/index.php?p=2,7.
8 8.1 Veranstaltungssprache/n
Deutsch Englisch Weitere, nämlich:
8.4 Maximale Teilnehmerzahl (optional)
8.5 Ergänzende Informationen (optional) (z. B. Literaturempfehlungen, weitere beteiligte Personen etc.)
Aktuelle Informationen können dem Veranstaltungsverzeichnis (Vorlesungsverzeichnis, LSF, ILIAS, etc.) entnommen
werden.
Modulhandbuch_Modulbeschreibung.doc WW.Boe.20170706.20180706 3.01 1.1 Modulbezeichnung (dt. / engl.) 1.2 Kurzbezeichnung (optional) 1.3 Modul-Code (aus HIS-POS)
7b: Wahlpflichtmodul Pflege und Erziehung in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie (WB)
2 2.1 Modulturnus: 2.2 Moduldauer:
Angebot in jedem SoSe, jedem WiSe, 1 Semester 2 Semester
anderer Turnus, nämlich:
3 3.1 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge 3.2 Pflicht, Wahlpflicht, Wahl 3.3 Empfohlenes Fachsemester
B.Sc. Psychiatrische Pflege/ Psychische Gesundheit Wahlpflicht 2. Fachsemester
4 Workload
Workload insgesamt
Lehrformen/ Form SWS je Std. pro Arbeitsaufwand Leistungspunkt
Lehrform Semester je in Std. e (Credits)
Lehrform/ (Workload) i. d. R. 30 Std. = 1
angegebener Summe Kontaktzeit LP; nur ganze
Form + Summe Selbst- Zahlen zulässig!
1 SWS darf als 15 studium in Std.
Zeitstunde ange-
Seminaristischer Unterricht setzt werden, d. h.
1 SWS = 1 UStd. x
15 Semesterwochen
Kontaktzeit 7b: Wahlpflichtmodul Pflege 70
(z. B. Vorlesung, Übung,
Praktikum, seminaristischer und Erziehung in der Kinder-
Unterricht, Projekt-/ und Jugendpsychiatrie
Gruppenarbeit, Fallstudie,
Planspiel, kreditiertes
Tutorium) (weitere Zeilen
möglich)
Summen Summe Kontaktzeit Summe
in SWS Kontaktzeit in
Std. 70
300 Std. 10 CP
Selbststudium Angeleitetes Selbststudium 10
(z. B. Tutorium, Vor-/
Nachbereitung, (Angeleitete) Praktische 220
Prüfungsvorbereitung,
Ausarbeitung von Weiterbildung
Hausarbeiten,
Recherche)
Summen Summe
Selbststudium in
Std. 230
5 5.1 Lernziele
Fachkompetenz
• über Grundlagenkenntnisse der Entwicklungspsychologie verfügen und Bindungstheorie, diese erläutern
und Konsequenzen für die pflegerisch-pädagogische Arbeit ableiten
• über differenzierte Kenntnisse zu psychiatrischen Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen (z.B.
Traumatisierung, PTBS, Essstörungen (Schwerpunkt Anorexia nervosa), Emotionale Störungen,
Persönlichkeitsstörungen in Kindes- und Jugendalter, Selbstverletzende Verhaltensweisen Psychosen
(schizophren/affektiv), ADHS/ADS Störungen des Sozialverhaltens) Therapieformen, Pharmakologie (Off-
Label-Use) verfügen und diese erläutern
• die Auswirkungen von Traumatisierungen, insbesondere von sexualisierter und anderer Gewalt bei Kindern
und Jugendlichen und ziehen daraus Konsequenzen für die Pflege und Therapie erkennen
• Kenntnisse zur Milieugestaltung vertiefen
• mit Suchtverhalten und Abhängigkeitserkrankungen im Kindes- und Jugendalter vertraut sein und
dieses Wissen in pflegerischen Handlungen berücksichtigen
• rechtliche Grundlagen welche für die Therapie in der KJP von besonderer Relevanz sind (z.B. SGB V,
Psych-PV) erläutern und Konsequenzen für pflegerisch-erzieherische Arbeit ableitenMethodenkompetenz
• eigenverantwortlich und theoretisch fundiert den spezifischen, Pflege- und Erziehungsbedarf bei Kindern
und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten erheben, die erforderliche
Pflege zielgerichtet planen und durchführen, den Verlauf dokumentieren und eigenverantwortlich in den
multiprofessionellen Behandlungsplan einbringen
• Modelle pädagogischer und therapeutischer Eltern- und Familienarbeit in der Praxis umsetzen
• ein gesundheitsförderliches und therapeutisches Milieu in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendpsychiatrie gestalten
• das Suizidrisiko von Jugendlichen einschätzen, zeitnah adäquat handeln und Maßnahmen einleiten
• in den Netzwerken von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule mitwirken
• die Selbsthilfepotentiale des Betroffenen, den sie als primären Auftraggeber sehen, aktivieren
• Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der kinder- und jugendpsychiatrischen
Behandlung planen und diese eigenständig durchführen
• in der Behandlung von Kindern, Jugendlichen und familiären Systemen pharmakologische und somatische
Therapieverfahren sowie psychotherapeutische und andere therapeutische Methoden berücksichtigen
Sozialkompetenz
• Grundlegende Versorgungsformen und innovative Ansätze kennen und erläutern
• mit anderen Gesundheitsberufen, Angehörigen sowie Organisationen im Versorgungssektor kooperativ
zusammenarbeiten
• mit Aggression und Gewalt um eigenverantwortlich umgehen und eine sensible, auf Deeskalation
ausgerichtete Grundhaltung mit den dazu gehörenden Kommunikationsstilen und Handlungen fördern
Selbstkompetenz
• die eigene Rolle und die Perspektiven und Wertvorstellungen der Kinder und Jugendlichen, ihrer Eltern
klären und selbstbewusst gestalten
• Lösungswege bei Konflikten und ethischen Dilemmata erkennen und Lösungswege anbahnen
5.2 Lerninhalte
1. Allgemeine Grundlagen:
- Kurze Einführung zur Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Epidemiologie psychischer Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter
- Besonderheiten kinder- und jugendpsychiatrischer Pflege und Therapie
- Rechtliche Grundlagen (SGB V, Psych-PV)
- Versorgungsstrukturen/Kooperation mit Jugendhilfe (SGB VIII), komplementären Einrichtungen und Schule
- Wissenschaftlichkeit und Wissen in der kinder- und jugendpsychiatrischen Pflege
2. Psychologische Grundlagen
- Grundlagen der Entwicklungspsychologie
- Einflussfaktoren auf die psychische/physische Entwicklung
- Einflussfaktoren auf Bindung und Bindungsfähigkeit
3. Medizinische Grundlagen und Therapie
- Therapieformen
- Traumatisierung, PTBS
- Essstörungen (Schwerpunkt Anorexia nervosa)
- Emotionale Störungen
- Persönlichkeitsstörungen in Kindes- und Jugendalter
- Selbstverletzende Verhaltensweisen
- Psychosen (schizophren/affektiv)
- ADHS/ADS
- Störungen des Sozialverhaltens
- Pharmakologie (Off-Label-Use)
4. Pflege und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Milieugestaltung
- Beziehungsarbeit, Interaktion, Gesprächsführung
- Pflegerische Gruppenangebote, Freizeitgestaltung
- Pflegeplanung/Pflegediagnostik
- Eltern-/Angehörigenarbeit
- Theoriegeleitete Reflexion der pflegerischen Praxis
5. Krisen und Krisenintervention im Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Rechtliche Grundlagen (Geschlossene Unterbringung, Medikation, Fixierung, Time-Out Maßnahmen)
- Notfälle
- Deeskalationsmethoden
- Umgang mit Aggression
- Umgang mit SuizidalitätSie können auch lesen