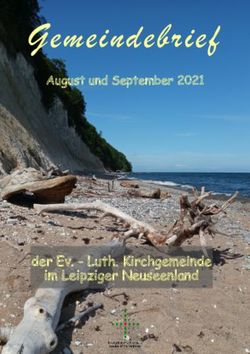MONISCHES . PHILHAR - Bergische Symphoniker
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SAISON
2021/22
7. PHILHAR
MONISCHES
KONZERT
mit Theo Plath Fagott7.
PHIL H A R MONIS CH E S KONZERT
Konzertsaal Solingen Teo Otto Theater Remscheid
Di 08.03.2022 | 19.30 Uhr Mi 09.03.2022 | 19.30 Uhr
18.45 Uhr Einführungsvortrag
von Katherina Knees
▸ Theo Plath Fagott
▸ Zoi Tsokanou Leitung
Videoclips aller aktuellen Konzerte finden Sie unter
www.bergischesymphoniker.deAnspruchsvoll geplant, wirtschaftlich gebaut. Als Ihr großes Bauunternehmen der Region wissen wir genau, worauf es Ihnen ankommt: Wirtschaftlichkeit, Termintreue und genaues Kostenmanagement. Darauf verlassen sich unsere Business-Kunden seit über 125 Jahren. Für jedes Bauvorhaben bringen wir von der Planung bis hin zur Fertigstellung unser übergreifendes Bauingenieur-Wissen ein, davon profitieren unsere Kunden jeden Tag aufs Neue. Generalunternehmung für Industrie und Investoren Hoch- und Schlüsselfertigbau Verkehrswegebau Ingenieur Tief- und Kanalbau Grundstücks- und Projektentwicklung www.dohrmann.de
Giannis Konstantinidis (1903-1984)
Dodekanesische Suite Nr. 2
I. Lento e solenne – Allegretto scherzando –
Tema con Variazione. Con moto
II. Scherzino. Vivo e leggiero
III. Andante con moto – Andantino mosso
IV. Lento e mesto – Allegro moderato
V. Lamento. Lento funebre
VI. Finale. Moderato quasi narrativo –
Allegretto scherzando – Allegro feroce
ma non tanto
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Konzert für Fagott und Orchester F-Dur op. 75
I. Allegro ma non troppo
II. Adagio
III. Rondo. Allegro
PAUSE
Alexander Borodin (1833-1887)
Symphonie Nr. 2 h-Moll
I. Allegro
II. Scherzo. Prestissimo – Trio. Allegretto
III. Andante
IV. Finale. AllegroDas Programm des heutigen Konzertabends kombiniert unter-
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
schiedliche Klangwelten zu einer spannenden musikalischen
Abenteuerreise für die Ohren. Die drei Komponisten der interpre-
tierten Werke eint über die musikalische Qualität ihres Schaffens
hinaus auch die Tatsache, dass sie allesamt äußerst interessante
und vielseitige Laufbahnen zu verzeichnen haben. Der griechische
Komponist Giannis Konstantinidis hat sich unter einem Pseudonym
im 20. Jahrhundert über den klassischen Konzertsaal hinaus mit
populären Songs und Filmmusiken einen Namen gemacht. Seinen
Sinn für atmosphärische Gestaltung und Melodien mit Ohrwurm-
Potenzial kitzelt die griechische Dirigentin Zoi Tsokanou am
heutigen Abend auch aus seiner Dodekanesischen Suite Nr. 2
für Orchester heraus. Der Name Carl Maria von Weber ist zwar
untrennbar mit seiner Oper Der Freischütz verknüpft, jedoch hat
der romantische Komponist zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch
dem häufig unterschätzten Fagott ein bis heute unangefochtenes
Paradekonzert auf den schlanken Leib geschrieben, mit dem
Theo Plath am heutigen Abend als Solist vor dem Orchester im
Rampenlicht glänzen kann – und in der zweiten Symphonie
des russischen Tausendsassas Alexander Borodin können die
Bergischen Symphoniker einmal mehr ihr weites Spektrum an
Klangfarben und ihre ungekünstelte Spielfreude offenbaren.
Lassen Sie sich mitreißen!
Der griechische Komponist, Pianist und
Dirigent Giannis Konstantinidis (1903-1984)
war ein überaus vielseitiger Künstler, der mit
seiner Dodekanesischen Suite Nr. 2 eine
faszinierende Klangwelt eröffnet, die voller
Fantasie und Liebe zum musikalischen
Detail steckt. In einer guten Viertelstundeund über sechs kurzweilige Sätze hinweg kreiert Giannis
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
Konstantinidis viele unterschiedliche und zuweilen märchenhafte
Stimmungen, in denen alle klanglichen Facetten der verschiedenen
Orchesterinstrumente zum Ausdruck kommen. Doch wer war
eigentlich dieser griechische Künstler, der auch unter diversen
Pseudonymen erfolgreich war? Giannis Konstantinidis kam im
August 1903 als Sohn einer wohlhabenden großbürgerlichen
Familie im heutigen Izmir zur Welt. Er wuchs im liberalen Klima
der Stadt auf, die damals noch Smyrna hieß und über 40 Theater
verfügte, in denen auch Opern und Operetten aufgeführt wurden.
Ersten Unterricht in Harmonielehre erhielt Giannis Konstantinidis
bereits als Kind, außerdem prägten ihn die Volksmusik der Arbeiter
aus den Vorstädten und der bäuerlichen Bevölkerung aus dem
ländlichen Umland der Stadt. Im Frühling 1922, kurz vor der Rück-
eroberung Smyrnas durch die Türken im Griechisch-Türkischen
Krieg, verließ Giannis Konstantinidis seine Heimatstadt und be-
gab sich zunächst nach Dresden, im Januar 1923 schließlich nach
Berlin, wo er bis 1930 blieb. Hier studierte er Komposition, Klavier
und Dirigieren sowie Orchestration bei Kurt Weill.
Nebenbei arbeitete er als Pianist in Kabarett- und Filmvorfüh-
rungen und trat unter dem Pseudonym Costa Dorres 1927 mit der
Uraufführung der Operette Der Liebesbazillus erstmals auch als
Komponist in Erscheinung. 1931 zog Giannis Konstantinidis nach
Athen, wo er zur Bestreitung seines Lebensunterhalts vor allem
als Komponist populärer Lieder arbeitete, die er unter dem Pseu
donym Kostas Giannidis veröffentlichte. Dieses wurde bald
bekannter als sein eigentlicher Name, unter dem er dennoch
stetig und mit wachsendem Erfolg Kompositionen für Orchester
und andere klassische Besetzungen komponierte.
Während er als Kostas Giannidis in den 1960er Jahren auch bei
einigen Schlagerwettbewerben erfolgreich war, komponierte erunter seinem wirklichen Namen vor allem von der griechischen
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
Volksmusik inspirierte Werke im spätromantischen Stil, die ihn
zu einem Vertreter der griechischen Nationalen Schule machten.
Carl Maria von Weber (1786-1826) gehört zu
den erfolgreichsten Komponisten, die auf der
Schwelle zum 19. Jahrhundert tätig waren
und gilt mit seiner Oper Der Freischütz als
Begründer der romantischen deutschen
Oper. In den knapp 40 Jahren seines kurzen,
aber überaus bewegten Lebens, das gegen
Ende von fortschreitender Tuberkulose
gezeichnet war, hat er eine Fülle an Bühnen-
werken, Orchesterkompositionen und Konzerten geschrieben,
so wie auch das Konzert für Fagott und Orchester F-Dur op. 75,
das bis heute ein absolutes Muss für alle Fagottist*innen ist.
Carl Maria von Weber war das erste von drei Kindern von Franz
Anton von Weber und dessen zweiter Ehefrau, der Opernsängerin
und Schauspielerin Genovefa Weber. Ab 1796 konzentrierte sich
Franz Anton vor allem auf die musikalische Ausbildung seines
Sohnes, in der Hoffnung, ihn als musikalisches Wunderkind
präsentieren zu können. In Salzburg bekam Carl Maria von Weber
unter anderem Unterricht von Michael Haydn und Johann Peter
Heuschkel in Klavier, Harmonielehre und Tonsatz. 1804 wurde
der talentierte junge Mann mit nur 17 Jahren Kapellmeister am
Theater in Breslau, wo er sich durch seine ernsthafte Probenarbeit
große Anerkennung verschaffte. Die Breslauer Erfahrungen
wurden das Fundament für Webers spätere Arbeit als Kapell
meister in Prag und Dresden und begründeten seinen guten Ruf
als Dirigent. Weil ihm aber die alltäglichen Pflichten am Theater
zu wenig Raum für eigene kreative Arbeit ließen, verzichtete ernach zwei Jahren auf die Verlängerung seines Vertrages und lebte
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
bis Anfang 1807 zunächst als Gast des preußischen Generals
Herzog Eugen von Württemberg im oberschlesischen Carlsruhe,
später bei dessen Bruder Friedrich von Württemberg, bis er nach
einer Korruptionsaffäre Anfang 1810 aus Württemberg ausgewiesen
wurde. Daraufhin arbeitete Carl Maria von Weber als freischaf-
fender Pianist, Dirigent und Komponist in Mannheim, Frankfurt,
München und Berlin. Von 1813 bis 1816 war der Komponist Opern-
direktor am Ständetheater in Prag, ab 1817 wirkte er als Königlicher
Kapellmeister und Direktor der Deutschen Oper am Dresdner
Hoftheater. Neben seinem Renommee als Komponist, musikalischer
Leiter und Dirigent, hat Carl Maria von Weber sich auch durch
musikalische und dramaturgische Artikel einen Namen gemacht,
die wichtige Dokumente über die Musik und das Theater seiner
Zeit sind. Sein in Fragmenten erhaltener unvollendeter Roman
über ein Künstlerleben, der autobiografische Züge hat, bezeugt
darüber hinaus seine schriftstellerischen Ambitionen.
Webers Fagottkonzert gehört zusammen mit Mozarts
B-Dur-Konzert KV 191 zu den beliebtesten und meistgespielten
Solokonzerten für das tiefe Holzblasinstrument. Dessen Qualitäten
stellt Weber in jedem Satz in anderer Form unter Beweis, wie
schon gleich die Hauptthemen zeigen: der Kopfsatz wird durch
ein rhythmisch markantes Thema dominiert, im kleiner besetzten
Adagio stehen kantable Passagen im Vordergrund und im
abschließenden Rondo Allegro darf der Solist sein Können von
Anfang an durch große Intervallsprünge und rasche Spielfiguren
unter Beweis stellen. Der damals fünfundzwanzigjährige Weber
schrieb Fagottkonzert zwischen dem 14. und dem 27. November
1811 in München auf die Bitte des Fagottisten Georg Friedrich
Brandt. Für die erste Aufführung des Werkes, die am 28. Dezember
im Münchner Hoftheater stattfand, wurde eine Reinschrift derPartitur angefertigt, die Weber daraufhin elf Jahre lang bei sich
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
behielt, bis er sie 1822 an seinen Berliner Verleger Schlesinger
weitergab, der sie im folgenden Jahr als Einzelstimmen veröffent-
lichte. Carl Maria von Weber war inzwischen noch erfahrener und
hatte auch Brandts Aufführung des Werkes in Prag gehört und
hatte deshalb vor der Veröffentlichung die Gelegenheit genutzt,
um mehrere Änderungen an dem Stück vorzunehmen. Die Solo-
stimme blieb jedoch, von einigen geringfügigen Änderungen
abgesehen, unverändert. Seitdem das Konzert 1823 erstmals in
Druck erschien, hat es unzählige Neuauflagen erlebt. Die Fassung,
in der es heute allgemein bekannt ist, stammt von einem anonymen
Herausgeber und entstand etwa vierzig Jahre nach dem Tod von
Carl Maria von Weber. Diese Version weicht jedoch in vielen
Einzelheiten vom Original ab, so dass der Fagottist Theo Plath
es sich zum Ziel gesetzt hat, in einer eigenen Ausgabe, wieder zu
Carl Maria von Webers Originaltext der Ausgabe von 1823 zurück-
zufinden und das zentrale romantische Werk der Fagottliteratur
so authentisch wie möglich zu interpretieren.
Alexander Borodin (1833-1887) war eine
faszinierende Persönlichkeit des 19. Jahrhun-
derts. Er gehört nicht nur zu den bedeuten-
den russischen Komponisten, sondern war
als Professor für Chemie und promovierter
Mediziner hauptberuflich Wissenschaftler,
der quasi nebenbei mit Werken wie seiner
Symphonie Nr. 2 in h-Moll ein bedeutendes
musikalisches Œuvre hinterlassen hat.
Alexander Borodin wuchs bei seiner Mutter in St. Petersburg auf
und erhielt dort eine gute und umfassende Ausbildung, die bei
dem talentierten Jungen auf fruchtbaren Boden fiel. Neben denSprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch lernte
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
er früh Klavier, Flöte und Cello, begann mit acht Jahren zu kompo-
nieren und vollendete 1847 sein erstes Flötenkonzert. Darüber
hinaus begeisterte er sich für naturwissenschaftliche Themen und
studierte deshalb in seiner Heimatstadt Petersburg Medizin und
Chemie, arbeitete zwei Jahre als Arzt, wurde 1864 Professor für
Chemie an der Petersburger Akademie und gründete die erste
medizinische Hochschulklasse für Frauen in Russland, in der er
auch unterrichtete. Seine Leidenschaft gehörte jedoch weiterhin
der Musik. Ab 1862 studierte Alexander Borodin neben seiner
Tätigkeit als Wissenschaftler Harmonielehre und Komposition
bei Mili Balakirew. Dieser war der Initiator und Kopf der Gruppe
der Fünf, oder – wie sie sich auch nannte – der Novatoren, zu der
neben Modest Mussorgski, Nikolai Rimski-Korsakow und César
Cui auch Alexander Borodin gehörte. Die Künstler, die von
missgünstigen Kritikern auch spöttisch als Das mächtige Häuflein
bezeichnet wurden, orientierten sich vornehmlich an der Musik
von Hector Berlioz, Robert Schumann und Franz Liszt und waren
darüber hinaus künstlerisch stark durch die heimatliche Volks
musik geprägt. Da Borodin aufgrund seiner Arbeit als Professor
und Wissenschaftler nie viel Zeit für seine Kompositionen blieb,
entstanden etliche davon über einen Zeitraum von mehreren
Jahren hinweg und wurden teilweise erst nach seinem Tod am
28. Februar 1887 veröffentlicht und von Freunden und Kollegen
fertig gestellt. Die 2. Symphonie, die zwischen 1869 und 1876
entstanden ist, ist das größte Werk, das vollständig aus Borodins
eigener Feder entstanden ist. Die vier Sätze spiegeln auch die
anderen Projekte wie seine Oper Prinz Igor und die Ballettmusik
Mlada wider, mit denen sich Borodin in dieser Schaffensperiode
musikalisch auseinandergesetzt hat.Borodin begann mit der Arbeit an seiner zweiten Symphonie 1869
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
unmittelbar im Anschluss an die erfolgreichen Aufführungen
seiner ersten Symphonie, die ihn nachhaltig motiviert hatten.
Den ganzen ersten Satz über kontrastieren Passagen mit tiefen
Streichern und Blechbläsern mit eleganten tänzerischen Abschnitten,
die auch ohne weiteres in die Tanzmusik zur Oper Fürst Igor
hätten Eingang finden können. 1878 überarbeitete Borodin die
Partitur und versah die wuchtigen, basslastigen Partien mit mehr
Leichtigkeit, die das Orchester vor allem im Scherzo brauchte,
welches als Prestissimo als furioser zweiter Satz folgt. Weil dieser
Satz bei der Uraufführung offenbar zu langsam dargeboten wurde,
blieb der erwünschte Effekt zunächst aus, so dass Borodin auch
diesen Satz nochmal überarbeitete. Virtuos dargeboten gibt es
jedoch nur wenige schnelle Sätze im symphonischen Repertoire
jener Ära, die eine vergleichbare Energie verströmen. Das im
Anschluss folgende Andante ist ein eleganter und ausgesprochen
melodiös gestalteter Satz, der sich zu einem leidenschaftlichen
Höhepunkt in der Mitte hin steigert. Die Musik dieses dritten
Satzes steckt voller Sehnsucht und Gefühl, ohne dabei melancho-
lisch zu werden. Das finale Allegro wiederum ist dann ein purer
Tanz, eine Ballettmusik, die ihre Wurzeln unüberhörbar in der
russischen Volksmusik hat. Alexander Borodins zweite Symphonie
ist mit einer knappen halben Stunde Aufführungsdauer nicht
allzu lang geraten. Neben Tschaikowskis Sechster Symphonie
in h-Moll op. 74, der so genannten Pathétique, ist Borodins Zweite
aber gewiss die eingängigste russische Symphonie des späten
19. Jahrhunderts, die als ungemein tänzerisches und schwung
volles Werk ohne jeden Anflug von Schwermut sicherlich auch
Ihre Ohren im Sturm erobern wird.
Katherina Kneesschöne Töne genießen
MALERWERKSTÄTTEN
EPE
EPE Malerwerkstätten | Remscheid | Hindenburgstraße 60 | 02191 5910780 | www.epe-maler.deTheo Plath
© Marco Borggreve
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
Als Preisträger des Internatio-
nalen ARD-Musikwettbewerbs
2019 und als Solofagottist des
hr-Sinfonieorchesters Frankfurt
gehört Theo Plath zu den
gefragtesten Fagottisten
seiner Generation.
Als Solist tritt Theo Plath unter
anderem mit dem Münchner
Kammerorchester und dem
hr-Sinfonieorchester auf und ist in Sälen wie dem Konzerthaus
Dortmund und der Elbphilharmonie Hamburg zu hören. Als ge-
fragter Kammermusiker ist er regelmäßiger Gast internationaler
Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder den
Spannungen in Heimbach, wo er mit Künstlern wie Vilde Frang,
Christian Tetzlaff, Maximilian Hornung und Lars Vogt zusammen-
arbeitet; zudem ist er Mitglied des Monet Bläserquintetts.
Theo Plath studierte an der Musikhochschule München und
wurde neben einem dritten Preis beim Internationalen Musik-
wettbewerb der ARD bei zahlreichen Wettbewerben wie dem
Aeolus-Wettbewerb und dem Deutschen Musikwettbewerb 2018
mit ersten Preisen ausgezeichnet.
Gefördert durch die GVL und den Deutschen Musikwettbewerb, ein Projekt des Deutschen MusikratsZoi Tsokanou
7. P H I L H A R M O N I S C H E S KO N Z E RT
verfügt über ein lebhaftes
Temperament, eindrückliches
technisches Vermögen und ein
tiefes musikalisches Wissen.
© Amanda Protidou
Sie ist die erste Frau, die ein
bedeutendes griechisches
Orchester leitet. Seit 2017/2018
ist sie Chefdirigentin und künst-
lerische Leiterin der Thessaloniki State Symphony Orchestra.
In dieser Saison dirigiert sie das Royal Opera House Orchester in
London mit der World Premiere Ballett Produktion von Crystel
Pite und wird zum dritten Mal auf dem Podium des Barcelona
Sinfonie Orchesters stehen. Weitere Engagements hat sie bei dem
L’Orchestre de Chambre de Genève in Genf, beim Symphonie
Orchester Biel und Orchester Stettin. Vergangene Engagements
führten sie zum Orchestre National de Lille, zu den Düsseldorfer
Sinfonikern, der NDR-Philharmonie, dem Radio-TV Orchester in
Madrid, dem Kammerorchester in Ingolstadt und dem Athener
Staats- und Radioorchester sowie zur dortigen Oper, wo sie
regelmäßig verpflichtet wird. Vor ihrer Position in Thessaloniki
war sie ständige Dirigentin am Theater Erfurt. Zoi Tsokanou
wurde in Thessaloniki geboren, wo sie ihren Abschluss in Klavier
und Musikwissenschaft erhielt. In Zürich studierte sie Klavier bei
Konstantin Scherbakov und beim Dirigenten Johannes Schlaefli.
Sie gewann mehrere Preise bei internationalen Dirigentenwett
bewerben.DIE REINSTE FREUDE ... Wir freuen uns, dass Sie ein/e Liebhaber/in guter Musik sind. Auch wir schätzen die Bergischen Symphoniker – sie sind der gute Ton unserer Stadt und unserer Kultur. Wenn es um gute Noten für gepflegte Geschäftsräume und eine saubere Umgebung geht, sind wir in unserem Element. Mit rund 2.800 Mitarbeitern sind wir täglich unterwegs und sorgen in unserer Region für Sauber- keit, Pflege und Werterhaltung. Und wie Musiker in einem guten Orchester, arbeiten wir gemeinsam daran, dass sich unsere Kunden freuen: Ob Büro-, Gebäude-, Praxen-, Klinik-, private Glasreinigung oder unsere Tech- nischen Dienste – Schulten bietet Ihnen stets saubere und individuelle Lösungen. Wenn Sie mehr über unsere vielfältigen Dienstleistungen wissen wollen, würden wir uns über Ihren Anruf freuen. 42853 Remscheid . Nordstraße 38 . Telefon 02191 466-0 mail@schulten.de · www.schulten.de
W I R ST E L L E N VO R
UNSERE
ORCHESTERMITGLIEDER
© Marco Göhre
Peter Schneider
entstammt einer Musikerfamilie.
Er studierte in jungen Jahren mit Orfeo
Mandozzi und später an der Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien. Es folgte ein Studium an
der Hochschule für Musik Detmold. Momentan vertieft er seine
Studien an der Hochschule für Musik Luzern. Peter Schneider
hat an zahlreichen internationalen Meisterkursen teilgenommen
unter anderem bei Gustav Rivinius, Natalia Gutmann und Bernhard
Greenhouse. 2015 gewann er den Internationalen Musikwettbe-
werb in Stockholm in der Solo- und in der Kammermusikwertung.
2019 entstand aus seiner Leidenschaft zur Kammermusik das
neue Salontrio mit Zoe Knoop an der Harfe und dem Virtuosen
Sebastian Kuleschow an der Violine. 2017 bekam er bei den
Bielefelder Philharmonikern einen 3-jährigen Zeitvertrag. Seit
Februar 2022 ist er festes Mitglied der Bergischen Symphoniker.
Peter Schneider spielt ein Violoncello von Nicolas Vuillaume aus
dem Jahr 1871.Mit Energie und Engagement für Solingen. Als einer der größten Förderer in Solingen übernehmen wir jeden Tag Verantwortung für unsere Stadt. Dabei unterstützen wir im Jahr über 80 Kinder- und Jugend- projekte in Solingen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stadtwerke-solingen.de
W I R ST E L L E N VO R
STIPENDIAT*INNEN
DER ORCHESTER AK ADEMIE
DER BERGISCHEN SYMPHONIKER
IN DER SP IEL ZEI T 2021/22
Johann Pereira
wurde 1994 geboren und in Brasilien auf
der Trompete ausgebildet. Seit 2019 ist er
in Deutschland Student an der Hochschule
für Musik Karlsruhe. Der junge Hornist hat
in seiner Heimat an mehreren Wettbe
werben erfolgreich teilgenommen, unter
anderem am 2. Musikwettbewerb Marcus
Bonna für junge Hornisten. Zweimal gewann Johann Pereira den
Ernani de Almeida Machado-Preis beim Wettbewerb des São
Paulo State Youth Symphony Orchestra und erzielte den 1. Platz
in seiner Altersklasse beim King’s Peak International Music
Competition in London.
Johann Pereira besuchte diverse Meisterklassen. Als Gastsolist trat
er mit dem São Paulo State Symphony Orchestra, dem São Paulo
Symphony Jazz Orchestra und dem Brazilian Symphony Orchestra
auf. Von 2012 bis 2017 war er Solohornist des São Paulo State
Youth Symphony Orchestra und von 2018-2019 in derselben
Position beim Bahia Symphony Orchestra. In Deutschland spielt
er zur Zeit das erste Horn beim Young Classic Sound Orchestra
in Karlsruhe. 2020 gründete Johann Pereira mit anderen
Musiker*innen das Brazilian Wind Ensemble.VO R S C H AU
8.
PHIL H A R MONIS CH E S KONZERT
Konzertsaal Solingen Teo Otto Theater Remscheid
Di 05.04.2022 | 19.30 Uhr Mi 06.04.2022 | 19.30 Uhr
Camille Saint-Saëns (1835-1921):
»Spartacus« Ouvertüre für Orchester
Johann Wilhelm Wilms (1772-1847):
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 C-Dur op. 12
César Franck (1822-1890):
Symphonie d-Moll
Nareh Arghamanyan Klavier ▸ Daniel Huppert LeitungVO R S C H AU
JUGEND BR IL L IER T
Teo Otto Theater Remscheid Konzertsaal Solingen
Fr 18.03.2022 | 19.30 Uhr Sa 19.03.2022 | 19.30 Uhr
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837):
Konzert Es-Dur für Trompete und Orchester
Joaquín Rodrigo (1901-1999):
Concierto de Aranjuez
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Konzert für Flöte und Orchester G-Dur KV 313
Richard Strauss (1864-1949):
Konzert für Horn und Orchester Nr. 1 Es-Dur op. 11
Bent Lux Trompete ▸ Noah Plota Gitarre ▸ Alma Cermak Flöte
▸ Jonathan Wilken Horn ▸ Johannes Zink Moderation
▸ Christian Blex Leitung
GEFÖRDERT VON:
PARTNER:
PARTNER:
MEDIEN-
KULTUR-
Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und Bildaufnahmen unserer Aufführungen durch jede Art elektronischer
Geräte strikt untersagt sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar.
Impressum: Bergische Symphoniker – Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH, 2022 · Geschäftsführer: Stefan
Schreiner · Aufsichtsratsvorsitzender: Burkhard Mast-Weisz · Redaktion: Manuela Scheuber · Gestaltung: Abdank & Milardović,
Büro für Gestaltung, Düsseldorf · Satz: rsn marxböhmer, Remscheid · Druck: Schmidt, Ley+Wiegandt, WuppertalSeit Jahrzehnten unterstützen
wir als Druckerei die Bergischen
Symphoniker. Es ist uns eine
große Freude, die Musikerinnen
und Musiker als Partner beglei-
ten und an ihrem künstlerischen
Schaffen teilhaben zu dürfen.
Schmidt, Ley + Wiegandt GmbH + Co. KG · Möddinghofe 26 · 42279 Wuppertal · slw-medien.de
Druckproduktion, Lettershop, Warehouse, Logistik, Webshops.Sie können auch lesen