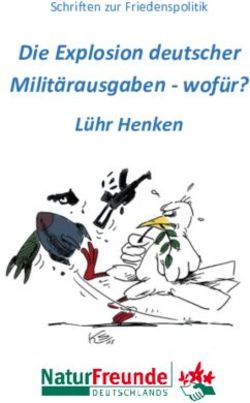PRESS REVIEW Monday, June 15, 2020 - Daniel Barenboim Stiftung Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal - Index of
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRESS REVIEW
Daniel Barenboim Stiftung
Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
Monday, June 15, 2020PRESS REVIEW Monday, June 15, 2020
Pforzheimer Zeitung (Print), 15.06.2020, PBS, DB
Barenboims Boulez-Saal boomt 4
Osnabrücker Zeitung (Print), 15.06.2020, PBS
Musikpreis für Florian Weber 5
Welt am Sonntag (Print), 15.06.2020, DB, DIVAN
Triple Concerto 6
Süddeutsche Zeitung (Print), 15.06.2020
Salzburger Festspiele „nicht in Gefahr, aber Situation nicht ungefährlich“ 7
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 15.06.2020
Ouvertüre auf dem Parkhausdeck. Es gibt wieder Musiktheater in Berlin 8
Süddeutsche Zeitung (Print), 15.06.2020
Weißt du, wie das wird? Richard Wagner „Rheingold“ auf einer Berliner Parkdeck
11
Der Tagesspiegel (Print), 14.06.2020
Nur regnen darf es nicht. Endlich wieder live: Die Deutsche Oper zeigt „Rheingold“ 13
Berliner Morgenpost (Print), 14.06.2020
Göttertreffen auf dem Parkdeck. Deutsche Oper feiert kleine Premiere 18
Berliner Zeitung (Print), 15.06.2020
Wagalaweia auf dem Parkdeck. Deutsche Oper überzeugt bei erster Inszenierung 23
Der Tagesspiegel (Print), 15.06.2020
So echt, wie es nur geht. Avi Avital und andere spielen im Potsdamer Nikolaisaal 25
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 13.06.2020
Anna Netrebko singt in Dresden 28
Süddeutsche Zeitung (Print), 15.06.2020
Oase des Wahns. Endlich wieder Oper in München 29Deutschlandfunk Kultur (Online), 13.06.2020
Dresdner Philharmonie spielt Trilogie. Von Haydn zu Hindemith 31
Deutschlandfunk Kultur (Online), 13.06.2020
Der Prager Frühling hat stattgefunden 33
Der Tagesspiegel (Print), 13.06.2020
Klassik und Klimaschutz. Mitglieder der Staatskapelle engagieren sich und andere 35
Süddeutsche Zeitung (Print), 13.06.2020
Kultur im Grundgesetz 40
Berliner Zeitung (Print), 13.06.2020
Staatsziel Kultur. Wiedervorlage der Linken 41
Berliner Zeitung (Print), 13.06.2020
Unterschätztes Weltkino wird sichtbar. Ein Online-Festival zeigt iranische Filme 43
Rbb Kultur (Online/Radio), 15.06.2020
„Berlin Postkolonial“ will streitbare Statuen umgestalten 44
Süddeutsche Zeitung (Print), 15.06.2020
Neues Debakel für Berliner Bauakademie 45
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 13.06.2020
Hilfsfonds des Goethe-Instituts 46
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 13.06.2020
Der Drive der punktierten Zweiunddreißigstel. Drei Bagatellen um B.: Brendel,
Beatles, Boogie-Woogie 47
New York Times (Online), 14.06.2020
My favorite string quartet. Alban Berg Quartet with new CD-box 50
Die Welt (Print), 15.06.2020
Denkmal gegen Denkmal. Kulturkampf um Frankfurts Oper 53
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Print), 15.06.2020
Wie ernst meint es der Dissident? Die Causa um Schriftsteller Jörg Bernig 54Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
F.A.Z. - Feuilleton Montag, 15.06.2020
Ouvertüre auf dem
Parkhausdeck
Es gibt wieder Musiktheater in Berlin. Die Deutsche Oper
geht mit einem handlichen Open-Air-„Rheingold“ voran
Wer sich in Zeiten von Corona neu oder überhaupt erst findet,
agiert vielleicht anders als sonst: weniger leistungsoptimiert und
attraktivitätsversessen, eher vorsichtig defensiv wägend, gewiss
dankbar, dass da überhaupt erst einmal wieder eine Beziehung
entsteht. Anfälliger sind solche Neubegegnungen und wegen dieser
Verletzlichkeit kostbarer – auch in Konzertsälen und auf Musikbüh-
nen, wo jetzt langsam wieder analoges Leben erwacht.
Als Berlins Deutsche Oper jetzt mit einem Pocket-„Rheingold“
(Jonathan Dove hat Wagners Original für seine Kammerfassung um
ein knappes Drittel gekürzt) ersten neuen Beziehungsmut zeigte,
spielte diese Fragilität immer mit und zeitigte ungewohnte Formen
der Kommunikation. Wo sich die Sänger sonst vor einem engge-
packten, in anonymes Dunkel versenkten Publikum exponieren
müssen, agierten die ungefähr vierzig Aktiven nun auf dem Park-
hausdeck des Hauses in der gleichen Tagesend-Halbhelligkeit, in
der auch ihre zweihundert Zuhörer saßen. Jeder konnte, auf Lücke
plaziert, jeden sehen – eher Sportplatz- als Theaterverhältnisse.
Und wenn dann Auf- und Abgänge durch die Gasse zwischen den
Sitzreihen erfolgten, waren sich Künstler und Gucker so nahe, wie
das „unter Dach“ kaum je möglich wäre.
Spielleiter Neil Barry Moss hat die Innenhofsituation, indem er ein
paar Fenster der umlaufenden Gebäudetrakte einbezog, geschickt
für einige raumüberspannende, quasi quadrophone Arrangements
genutzt. Die Jagd nach dem Gold lief dann, zwischen lustvoll-anar-
chistisch zusammengeklaubten Requisiten und in faschingshaft
durchgeknallter Kostümierung, mit viel Gewusel, manch komödian-
tischer Übertreibung und freilich auch ziemlich viel Stegreif-Leer-
1 von 3 15.06.2020, 09:30Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
lauf ab.
Gelegentlich blitzte erfrischende, antipathetische Ironie auf, die
man vielleicht als optimistischen Vorschein auf Stefan Herheims
Inszenierung nehmen konnte, die eigentlich am gleichen Abend
Premiere haben sollte und nun irgendwann später zum Zuge
kommen wird. Einer dieser kleinen, augenzwinkernden Momente
war Frickas (mit gehalten-fraulicher Würde: Annika Schlicht)
fassungslos ergebener Blick auf den gewölbten Leib Erdas, in dem
wohl gerade das Rebellenkind Brünnhilde heranwächst. Judit
Kutasi sang die Urmutter mit zunächst wallend orgelndem, im Fort-
gang etwas zerfaserndem Timbre.
Man muss dem eher auf punktuelle Pointen als auf geschlossene
dramaturgische Bögen gerichteten Treiben zugutehalten, dass hier
mit kürzester Probenzeit, unter wettersensiblen Open-Air-Bedin-
gungen (launische Windstöße grüßten von einer angekündigten,
aber dann doch einen anderen Weg nehmenden Gewitterfront) und
in einer Konstellation, wo die Sänger fast durchweg mit dem
Rücken zum Dirigenten agierten, gearbeitet wurde. Und wenn etwa
Freias Entführung eher ein kleines Wettrennen als eine handgreifli-
che Überwältigung wurde, durfte man auch an infektionsbedingte
Abstandsgebote denken, die ansonsten gut kaschiert und höchstens
im Fesselungsgerangel zwischen Alberich und Loge kurz ausgetestet
wurden. Am Ende schien sich die glückliche Besucherschar (alle
Karten für die geplanten sechs Vorstellungen waren binnen Minu-
ten ausverkauft) mit großer Mehrheit der alten Weisheit zuzunei-
gen, dass man vom Ochsen nicht mehr als Rindfleisch verlangen
dürfe. Die Begeisterung, endlich überhaupt wieder analoges Musik-
theater zu erleben, war fast mit Händen zu greifen.
Und sie wurde von den Akteuren erwidert. Die Dove-Fassung mit
ihren nur 22 Orchestermusikern – darunter lediglich sechs Strei-
cher – konnte ihre möglichen Qualitäten nur partiell entfalten. Sie
ist für kleinere Räume, nicht für das Spiel unter freiem Himmel
gedacht. So mussten sich Donald Runnicles am Pult, Musiker,
Sänger und Hörer im ersten Bild akustisch erst einmal vorsichtig
zueinander hintasten. Im Weiteren gab es eine gut getaktete Koor-
dination und schöne Einzelmomente, zum Beispiel im Aufscheinen
der Holzbläser, aber naturgemäß nie jene Ohr und Hirn wohlig
einnebelnde Vollklanglichkeit, die sonstige Wagner-Erlebnisse
2 von 3 15.06.2020, 09:30Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
prägt.
Ermutigendwaren die Begegnungen mit der Sängerriege, die zu
guten Teilen im Haus beheimatet ist und auch bei Herheim auf der
Bühne gestanden hätte. Allen voran gab Thomas Blondelle einen
umwerfend spielfreudigen Loge als intellektuell-sarkastischen
Strippenzieher, auch stimmlich selbstbewusst und frei ausströ-
mend, ohne die in dieser Rolle häufigen meckernden Manierismen.
Nicht im etwas statuarischen Bewegungsvokabular, wohl aber im
mächtig und souverän entfalteten, herrschaftlich strömenden
Stimmfluss hielt sich Derek Weltons Wotan auf gleicher Höhe,
während Philipp Jekals Alberich nach etwas flackernd-ungefestig-
tem Beginn mit seinem durchdringenden, aggressiv-verzweifelten
Fluch das große Finale einleitete – von dem man nun hoffen muss,
dass es eigentlich eine Ouvertüre war. Gerald Felber
3 von 3 15.06.2020, 09:30Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/790401/9 1 von 2 15.06.2020, 09:52
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/790401/9 2 von 2 15.06.2020, 09:52
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469313/22 1 von 5 15.06.2020, 11:44
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469313/22 2 von 5 15.06.2020, 11:44
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469313/22 3 von 5 15.06.2020, 11:44
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469313/22 4 von 5 15.06.2020, 11:44
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469313/22 5 von 5 15.06.2020, 11:44
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/602/ 1 von 5 15.06.2020, 13:51
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/602/ 2 von 5 15.06.2020, 13:51
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/602/ 3 von 5 15.06.2020, 13:51
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/602/ 4 von 5 15.06.2020, 13:51
Firefox https://reader.morgenpost.de/bmberlinermorgenpost/602/ 5 von 5 15.06.2020, 13:51
Artikel auf Seite 18 der Zeitung Berliner Zeitung vom Di, 16.06.2020 https://epaper.berliner-zeitung.de/
Wagalaweia auf dem Parkdeck
Die Deutsche Oper überzeugt open air bei erstaunlicher Akustik mit einem gekürzten
„Rheingold“
Ausdrucksstarkes „Rheingold“ auf dem Parkdeck: Annika Schlicht als Fricka, im HIntergund Derek Welton als Wotan. Bernd Uhlig
Peter Uehling
Dass wir das in dieser Spielzeit noch erleben dürfen! Oper, wirkliche Oper, mit hier und jetzt singenden, hier und jetzt spielenden Menschen!
Das Parkdeck der Deutschen Oper macht es möglich: Hier gibt es Platz für 200 mit Abstand gesetzte Zuschauer, hier gibt es eine erstaunliche
Akustik; lediglich eine Spielfläche gibt es nicht so recht, aber das fällt bei dieser Aufführung des „Rheingolds“, gekürzt und für ein Orchester
von 22 Spielern, bearbeitet vom englischen Komponisten Jonathan Dove, kaum auf. Denn man merkt den Sängern am Freitag an: Sie wollen
wieder auf die Bühne – und die schaffen sie sich, wo immer ein Plätzchen ist.
Genug Gewirbel, genug Schimmer
Eigentlich sollte an diesem Abend im Haus ein neuer „Ring des Nibelungen“ beginnen, der vorgesehene Regisseur Stefan Herheim saß auch im
Publikum. Es ist noch immer nicht klar, ob in der nächsten Saison mit dem zweiten Stück der Tetralogie, der „Walküre“, gestartet werden kann,
die Premiere ist für den 27. September vorgesehen. Dieses Krisen-„Rheingold“ ist kurzfristig zustandegekommen. Dove hatte seine Fassung für
die Birmingham Opera Company angefertigt, die eine Aufführung durch ein anderes Ensemble genehmigen muss; diese Genehmigung wurde
zehn Tage vor der ersten Berliner Aufführung erteilt.
Klanglich hat Dove die Aufgabe, Wagners orchestrale Hundertschaft auf weniger als ein Fünftel einzudampfen, beeindruckend gelöst – und
Donald Runnicles und das Orchester der Deutschen Oper haben das nach kleinen anfänglichen Koordinationsproblemen ebenso beeindruckend
dargestellt: Nur zwei statt acht Hörner und keine Wagner-Tuben, nur sechs statt 64 Streicher – und dennoch entsteht der weiche, volle Walhall-
Klang. Nur selten fehlt dem Hörer etwas, etwa beim Abstieg nach Nibelheim, in der die in Terzentürme gepresste Orchestermasse auch für die
Unterdrückung eines ganzen Volks durch den Ausbeuter Alberich steht. Aber diese Passage kürzt Dove ohnehin drastisch, indem der ganze
Auftritt Mimes wegfällt.
Die Absicht der Kürzungen ist nicht immer klar, viele wirken pragmatisch und sinnlos zugleich. Wagner hatte angeblich eine Aufführungsdauer
von zwei Stunden im Sinn und schalt seine Dirigenten der Temperamentsarmut, dass sie immer eine halbe Stunde mehr bräuchten. Doves
Fassung dauert 110 Minuten – das ist zwar weniger, aber das Stück wird nicht wirklich schlanker.
Mag sein, dass manche Textpassagen entbehrlich ist, aber sie enthält eventuell die Vorstellung eines wichtigen Motivs. So ist durch die Kürzung
des Mime-Auftritts die Exposition des Tarnhelm-Motivs weggefallen; kehrt es wieder, fällt es nicht mehr auf, der musikalische Eindruck ist ein
ganz anderer. Mancher Sprung bringt nur Sekunden, stört aber das periodische Gleichgewicht der Gesangsphrasen empfindlich: So merkt man
immerhin, dass Wagners Musik keineswegs so formlos ist, wie es ihr oft vorgeworfen wurde, dass es Proportionen gibt, die man nicht
durcheinanderbringen sollte.
Der verkleinerte Klang gibt den Sängern die Möglichkeit zu klarster Artikulation. Thomas Blondelle als Loge übt sich mit überschäumender
Spiellaune in dämonischer Überdeutlichkeit, der Wotan Derek Weltons bleibt darstellerisch etwas behäbig, überzeugt aber durch eine reiche
dynamische Spannweite und großen Klang, wie auch Annika Schlicht als Fricka – beide bilden ein musikalisch glänzend dargestelltes Ehepaar
im Streit.
Philipp Jekals Alberich funktioniert vielleicht nur mit dieser Besetzung: Der junge Bariton singt mit schlankem Ton und viel Sprache, muss an
Volumen noch gewinnen, vermittelt aber den Umschwung der Komödie in die Tragödie, die Verfluchung des Rings bereits mit großer Wucht.
Dagegen wirkte Judit Kutasis Erda bei wuchtigem Klang eher konventionell, , auch in dem, was solch großen Altstimmen an Intonation oft
misslingt. Zauberhaft harmoniert das Rheintöchter-Trio mit Elena Tsallgova, Irene Roberts und Karis Tucker.
Riesen im Nadelstreifenanzug
Die von Neil Barry Moss erarbeitete „Szenische Einrichtung“ spielt mit dem Charakter einer Not-Inszenierung: Weiß verhüllte Kostümpuppen
1 von 2 15.06.2020, 12:20Artikel auf Seite 18 der Zeitung Berliner Zeitung vom Di, 16.06.2020 https://epaper.berliner-zeitung.de/
erinnern an den Anfang des Götz-Friedrich-Rings im Tunnel, Wotan nimmt in einem Drehstuhl mit der Aufschrift „Regie“ Platz, Alberich betritt
die Bühne mit Rudolph-Moshammer-Perücke und mit zu vielen Blumen am Jeansanzug, das Rheingold selbst besteht aus goldenen
Brustpanzern, die aus einem Haufen überflüssiger Requisiten ausgewählt werden.
Zum Einzug aus Walhall fallen aus dem angrenzenden Gebäude die Banner verschiedener Produktionen – Walhall als das Opernhaus selbst, das
sehnsüchtig des Einzugs der Gäste harrt. Die Riesen erscheinen als Bauunternehmer im Nadelstreifenanzug, und vielleicht wirkte kein Fafner je
so gnadenlos und furchterregend wie der entsprechend nüchtern singende Tobias Kehrer, der mit dem Klemmbrett in der Hand und mit der
kalten Leidenschaft der Pedanterie registriert, ob da auch genug Gold aufgehäuft wird – hier wird aus der szenischen Einrichtung eine
Inszenierung mit Ausdruckskraft.
Weitere Aufführungen am 16., 18., 19., 20. und 21. Juni. Deutsche Oper Berlin, Bismarckstr. 35, Telefon: 030 34 38 43 43
2 von 2 15.06.2020, 12:20Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469319/20 1 von 3 15.06.2020, 11:34
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469319/20 2 von 3 15.06.2020, 11:34
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469319/20 3 von 3 15.06.2020, 11:34
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464901/12
F.A.Z. - Feuilleton Samstag, 13.06.2020
Anna Netrebko singt in
Dresden
Es geht wieder los: Die Dresdner Semperoper nimmt nach gut drei-
monatiger Pause am 19. Juni den Spielbetrieb wieder auf. Die russi-
sche Sopranistin Anna Netrebko und ihr Mann, der Tenor Yusif
Eyvazov, werden an vier aufeinanderfolgenden Abenden in einer
konzertanten Aufführung von Giuseppe Verdis Oper „Don Carlo“ in
gekürzter Fassung mit reduzierter Orchesterbesetzung zu erleben
sein. Die anderthalbstündigen Vorstellungen sind der Auftakt für
eine Programmreihe mit je eineinhalbstündigen Veranstaltungen
ohne Pause. Der Spielbetrieb unterliegt der Einhaltung aktueller
Hygienebestimmungen, wozu auch eine eingeschränkte Platzkapa-
zität zählt.dpa
1 von 1 14.06.2020, 19:36Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/790401/9 1 von 2 15.06.2020, 09:50
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/790401/9 2 von 2 15.06.2020, 09:50
KONZERT | Beitrag vom 13.06.2020 APP: DLF AUDIOTHEK
Dresdner Philharmonie spielt Trilogie unter Marek Janowski
Von Haydn zu Hindemith –
Klangbrücken III
Moderation: Stefan Lang
Beitrag hören
Iveta Apkalna, Orgel
Francesco Piemontesi, Klavier
Dresdner Philharmonie
Leitung: Marek Janowski
Marek Janwoski hat die Haydn-Hindemith-Trilogie konzipiert. (Dresdner Philharmonie / Oliver Killig)
Wenn die klassische Sinfonie von Joseph Haydn auf die kammermusikalische von Paul
Hindemith trifft, werden die großen klanglichen Unterschiede klar aufgezeigt. Aber
auch, dass Hindemith jene Klassik immer im Hinterkopf hatte.
Es war die Idee von Marek Janowski, sein großes Orchester, die Dresdner
Philharmonie, für ein Programm mit Haydn und Hindemith zu begeistern. Dabei hat er
drei Abende konzipiert – und sein Orchester gedrittelt. Jeden Abend spielt das
Orchester also in einer neuen Zusammensetzung – so konnten alle Musikerinnen und
Musiker sich in Haydn und Hindemith vertiefen.
Marek Janowski hat jedem Musiker der Dresdner Philharmoniker ermöglicht, ein Radiokonzert zu
spielen. (Dresdner Philharmonie / Oliver Killig)
Auch am dritten Abend greift das Konzert auf folgendes Konzept zurück: Zwei Haydn-
Sinfonien sind die Pole, zwischen denen zwei Kammermusiken des Bürgerschrecks
Paul Hindemith erklingen.
Haydn – Pariser Liebling
Haydn kannte Paris nur von Zeichnungen, aber ganz Paris kannte Haydn. Er war für
die Pariser Kulturschickeria und eben auch für die Kulturkenner gleichermaßen Genie.
Haydn konnte groß besetzen und wusste um die technische Perfektion der Pariser
Musikkollegen.Als dann auch noch die aus Österreich stammende Marie Antoinette eine Lieblingssinfonie erkor, wurde dieses Werk kurzerhand mit dem Beinamen „La Reine“ betitelt. Die französische Königin war Protektorin der Konzertreihe „Concerts de la Loge Olympique“. Haydn hatte in dieser Sinfonie Nr. 85 unter anderem eine französische Romanze eingebaut, die Antoinette noch kurz vor ihrer Hinrichtung leise sang. Hindemith – der Bürgerschreck Er war ein Komponist, der gern provozierte. Mit grellen Dissonanzen, mit hastigen Rhythmen – vergleichbar bunt und kantig, wie die Expressionisten seiner Zeit malten. Er wollte ein Anti-Künstler sein. Und so schuf er mit seinem Klavierkonzert, der Kammermusik Nr. 2 für obligates Klavier, ein Werk, in dem der Solist athletisch sein Können zeigt – ein neobarockes Konzert mit aggressiv- lärmendem Humor. Francesco Piemontesi wird der Solist an diesem Abend sein. Francesco Piemontesi wird Hindemiths sogenanntes Klavierkonzert aus den 20-er Jahren spielen. (Francesco Piemontesi / Marco Borggreve) Zuvor spielt Iveta Apkalna die Kammermusik Nr. 7 für Orgel und Kammerorchester. 1927 bekam Hindemith einen Auftrag des Frankfurter Rundfunks – das Radio war das begeistert aufgenommene, schnell wachsende, neue Medium. Eine neue Orgel sollte eingeweiht werden. Der Schwager des Komponisten war damals Leiter des Senders. Und Hindemith komponiert hierfür die prächtigste der Kammermusiken. Von wegen feierlich Dieses Mal dreisätzig, also ganz konventionell, ja klassisch angelegt. Der Orgel werden Bläser, etliche Celli und Kontrabässe zur Seite gestellt. Fanfarenartig eröffnet der erste Satz. Und Hindemith vermag die Bläser- und Orgelregister derart zu verschmelzen, dass man manchmal nicht so recht weiß, wer gerade am Zug ist. Iveta Apkalna ist in diesem Fall Solistin – in einem Werk, das die Feierlichkeit des damaligen Momentes kräftig humorvoll und mit viel Spiellaune unterläuft. Die lettische Organistin Iveta Apkalna ist eine der führenden Organistinnen der Musikszene. (Iveta Apkalna / Maxim Schulz)
KONZERT | Beitrag vom APP: DLF AUDIOTHEK 14.06.2020 Tschechische Philharmonie, Collegium 1704 und Prager Symphonieorchester Der Prager Frühling hat stattgefunden Moderation: Volker Michael Beitrag hören Mit Inbrunst sang sie ein Gloria von Georg Friedrich Händel beim Prager Frühling – die Sopranistin Hana Blažíková. (Ivan Malý/Český Rozhlas/EBU) Hana Blažíková hatte das Glück, in einem der ersten Publikum-Konzerte singen zu können. Sie zog beim „Prager Frühling“ mit ihrem klaren und gleichzeitig weichen Sopran in Händels „Gloria“ die Besucher in ihren Bann. Eigentlich sollte es ein rauschender Jubiläumsjahrgang werden, der 75. Prager Frühling, ein internationales Musikfestival, eines der größten und ältesten Europas, das nicht zuletzt viel älter ist das politische Ereignis gleichen Namens von 1968. Doch dann kam der Lockdown wegen der Pandemie – das gesamte Festival hätten die Verantwortlichen absagen können. Doch sie verfügten über genügend finanzielle Mitteil und öffentliche Unterstützung, um die Konzerte dennoch zu organiseren. Und einiges fand nicht nur online und in Radio und Fernsehen statt, sondern auch mit leibhaftigem Publikum im Saal. Jakub Hrůša leitet die Tschechische Philharmonie (Český Rozhlas/EBU) Wir haben aus dem Angebot des Tschechischen Rundfunks/Radio Moldau drei Veranstaltungen ausgewählt, aus denen Sie jeweils Ausschnitte hören können. Am Ende einen Teil des Abschlusskonzerts vom 4. Juni mit der Tschechischen Philharmonie, dirigiert von Jakub Hrůša. Er hat eine eigene Orchesterfassung eines späten Streichquartetts von Ludwig van Beethoven vorgestellt. Und zwar des rätselhaft helltönigen F-Dur-Quartetts op. 135.
Liebling Josef Suk
Außerdem gibt es zwei Stücke für Streichorchester von Josef Suk, die Meditation
über den altböhmischen Choral „Sankt Wenzel“ und die E-Dur-Serenade. Tomáš
Brauner leitet das Prager Symphonieorchester FOK, das städtische Orchester der
Landeshauptstadt. Josef Suk, der Schwiegersohn Antonín Dvořáks, ist mit seiner
Musik nicht nur der erklärte Liebling Kirill Petrenkos, des Chefdirigenten der Berliner
Philharmoniker, sondern wird auch in seiner Heimatstadt Prag verehrt und regelmäßig
gespielt.
Der Dirigent Tomáš Brauner (Lukáš Poláček/Český Rozhlas/EBU)
Am Beginn steht sakrale Barockmusik mit dem hochgelobten Collegium 1704. Das hat
am 18. Mai ein Konzert in der Annenkirche des Kulturzentrums Prague-Crossroads
gegeben. Solistin war die Sopranistin Hana Blažíková, sie sang das Gloria, eine frühe
Solo-Kantate Georg Friedrich Händels, die erst vor einigen Jahren entdeckt
wurde. Václav Luks dirigierte den Abend, der mit der bewegenden Motette „Jesu,
meine Freude“ von Johann Sebastian Bach endete. Dieses Konzert fand noch unter
erschwerten Bedingungen statt. Dirigent, Musikerinnen und Musiker und Vokalisten
trugen sämtlich Gesichtsmasken, Publikum gab es auch noch nicht.
Konzerte mit Publikum
Das war bei den späteren Konzerten Anfang Juni schon anders. Da saßen Zuhörer im
Saal und die Orchestermusiker konnten frei atmend auftreten. Inzwischen hat ja
Tschechien als eines der ersten Länder Europas seine Grenzen wieder für die
Anrainerstaaten geöffnet. Und anscheinend ging dort auch in der Kultur schon etwas,
als in deutschen Städten noch alle Säle geschlossen waren und zumeist immer noch
sind.
75. Prager Frühling Ludwig van Beethoven
Aufzeichnungen vom 18. Mai, 1. und 4. Juni 2020 Streichquartett Nr. 16 F-Dur op. 135
(Orchestrierung: Jakub Hrůša)
Georg Friedrich Händel
„Gloria“, Geistliche Solo-Kantate
Tschechische Philharmonie
Leitung: Jakub Hrůša
Johann Sebastian Bach
„Jesu, meine Freude“, Motette BWV 227
Hana Blažíková, Sopran
Collegium Vocale 1704
Collegium 1704
Leitung: Václav Luks
Josef Suk
Meditation über den Choral „St. Wenzel“ op. 35a
Streicherserenade E-Dur op. 6
Prager Symphonieorchester
Leitung: Tomáš BraunerFirefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469295/22 1 von 5 15.06.2020, 11:55
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469295/22 2 von 5 15.06.2020, 11:55
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469295/22 3 von 5 15.06.2020, 11:55
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469295/22 4 von 5 15.06.2020, 11:55
Firefox https://epaper.tagesspiegel.de/webreader-v3/index.html#/469295/22 5 von 5 15.06.2020, 11:55
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/790347/17 1 von 1 15.06.2020, 10:06
Artikel auf Seite 16 der Zeitung Berliner Zeitung vom Sa, 13.06.2020 https://epaper.berliner-zeitung.de/
Staatsziel Kultur
Wiedervorlage der Linken
Das klingt schön, ist aber kein neuer Gedanke. Ein solches Staatsziel garantiere auch keine
höhere Förderung. Und im Streitfall müssten Gerichte über kulturelle Belange
entscheiden.
Petra Kohse
„Die Linke im Bundestag will die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern“, meldet dpa. Diese Idee ist nicht neu. Schon vor 15 Jahren
hatte der damalige Bundestag eine Enquetekommission Kultur in Deutschland eingesetzt, die die Empfehlung formulierte, dem Grundgesetz
einen Artikel 20 b anzufügen, der lauten sollte: „Der Staat schützt und fördert die Kultur“. In Artikel 20 a werden die „natürlichen
Lebensgrundlagen“ und die Tiere geschützt. Daraufhin formulierte die FDP-Fraktion seinerzeit einen Gesetzesentwurf, der aber im
Tagesgeschäft offenbar wieder versackte.
Das Thema flackert seither immer wieder auf, und nachdem man am Beispiel der Rettungspolitik von Bund und Ländern für Kulturschaffende in
den letzten Monaten erleben konnte, welche, sagen wir es mal diskret, Uneinheitlichkeit und Ungerechtigkeit sich aus der prinzipiell föderalen
Zuständigkeit der Länder ergeben hat, liegt der Wunsch nach einem Sicherheitsnetz namens Bundesaufgabe tatsächlich gerade wieder sehr nahe.
Damit daraus gleichzeitig keine Nachteile für die Länder entstehen, plädiert Simone Barrientos, die kulturpolitische Sprecherin der Linken im
Bundestag, auch mit Blick auf ein sich daraus ergebendes Kooperationsgebot sicherheitshalber für eine Lösung, „die den Bund in die Pflicht
nimmt, ohne den Ländern die Gestaltungsfreiheit zu nehmen“. Für die Wissenschaft gibt es eine solche Vereinbarung bereits (Artikel 91 b).
Das klingt gut. Andererseits hat sich die aktuelle Bundesregierung Schutz und Förderung der Kultur ja schon jetzt zum Auftrag gemacht, wie ein
Blick in die Koalitionsvereinbarung und natürlich auch die Kulturmilliarde zeigen. Über die Höhe der Förderung müsste man sich weiterhin
streiten. Und dazu träte etwas ein, das auch einmal unerwünschte Ergebnisse produzieren könnte: Kulturelle Belange wären nicht mehr nur ein
Thema der politischen Debatte, sondern auch der Gerichtsbarkeit.
;Petra Kohse,
nickt, aber gibt etwas zu
bedenken.;Die Linke im Bundestag will die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern“, meldet dpa. Diese Idee ist nicht neu. Schon vor 15
Jahren hatte der damalige Bundestag eine Enquetekommission Kultur in Deutschland eingesetzt, die die Empfehlung formulierte, dem
Grundgesetz einen Artikel 20b anzufügen, der lauten sollte: „Der Staat schützt und fördert die Kultur“. In Artikel 20a werden die „natürlichen
Lebensgrundlagen“ und die Tiere geschützt. Daraufhin formulierte die FDP-Fraktion seinerzeit einen Gesetzesentwurf, der aber im
Tagesgeschäft offenbar wieder versackte.
Das Thema flackert seither immer wieder auf, und nachdem man am Beispiel der verschiedenen Kultur-Rettungsmaßnahmen von Bund und
Ländern in den letzten Monaten erleben konnte, welche, sagen wir es mal diskret, Uneinheitlichkeit und welches Ungenügen sich aus der
prinzipiell föderalen Zuständigkeit für die in den verschiedenen Regionen Deutschlands lebenden Künstler ergeben hat, liegt der Wunsch nach
einem Sicherheitsnetz namens Bundesaufgabe tatsächlich gerade wieder einmal sehr nahe.
Damit daraus gleichzeitig keine Nachteile für die Länder entstehen, plädiert Simone Barrientos, die kulturpolitische Sprecherin der Linken im
Bundestag, auch mit Blick auf ein sich aus einem „Staatsziel Kultur“ ergebenden Kooperationsgebot (derzeit herrscht nachgerade das
Gegenteil: ein Kooperationsverbot) sicherheitshalber für eine Lösung, „die den Bund in die Pflicht nimmt, ohne den Ländern die
Gestaltungsfreiheit zu nehmen“. Für die Wissenschaft gibt es eine solche Vereinbarung bereits (Grundgesetz Artikel 91b).
Das klingt zweifellos gut. Andererseits hat sich die aktuelle Bundesregierung Schutz und Förderung der Kultur ja schon jetzt zum Auftrag
gemacht, wie ein Blick in die Koalitionsvereinbarung und natürlich auch die Kulturmilliarde zeigen. Über die Höhe der Förderung müsste man
sich allerdings weiterhin streiten.
1 von 2 15.06.2020, 12:23Artikel auf Seite 16 der Zeitung Berliner Zeitung vom Sa, 13.06.2020 https://epaper.berliner-zeitung.de/
Und noch dazu träte etwas ein, das auch einmal unerwünschte Ergebnisse produzieren könnte: Kulturelle Belange wären nämlich nicht mehr
nur ein Thema der politischen Debatte, sondern auch der Gerichtsbarkeit.
2 von 2 15.06.2020, 12:23Artikel auf Seite 17 der Zeitung Berliner Zeitung vom Sa, 13.06.2020 https://epaper.berliner-zeitung.de/
Unterschätztes Weltkino wird sichtbar
Ein Online-Festival zeigt iranische Filme
„Roozi ke zan shodam“ (Der Tag, an dem ich zur Frau wurde), Iran 2000 M Meshkiny
Claus Löser
Immer aufs Neue erreichen uns aus dem innen- wie außenpolitisch hart umkämpften Iran aufregende filmische Botschaften. Regulär in die
deutschen Kinos gelangt davon leider nur wenig. Durch die coronabedingte Krise erweitern sich paradoxerweise gerade die Möglichkeiten. Auf
der Webseite der Berliner Festspiele findet ein zehntägiges Online-Festival statt, bei dem sieben lange und vier kurze Beispiele aus den Jahren
zwischen 1973 und 2018 sichtbar werden.
Dieses Spektrum greift weit, macht aber unbedingt Sinn. Von der iranischen, seit 1989 in Deutschland lebenden Kuratorin und Produzentin
Afsun Moshiry wird damit ein Aufriss angeboten, der gar nicht repräsentativ sein kann – der aber doch auf eine immense kinematografische
Substanz verweist. Ideal waren die Arbeitsbedingungen weder vor noch nach der „Islamischen Revolution“ von 1979; tendenziell lastet gerade
wieder die Zensur schwerer denn je. Dies muss beim Sehen der Filme stets mitgedacht werden: dass es sich um abgetrotzte Werke handelt, um
Akte des Widerstands, stets auf der Klinge des Verbots balancierend, mit möglichen Konsequenzen von Verfolgung, Haft, Exil.
Einigermaßen bekannt sind derzeit nur die Fälle von Mohammad Rasulof und Jafar Panahi. Beide Regisseure stehen offiziell unter Berufsverbot
und sind von mehrjährigen Haftstrafen bedroht. Regelmäßig unterlaufen sie die strengen gerichtlichen Auflagen, gefährden sich selbst, setzen
aber ermunternde Zeichen der Zivilcourage für jüngere Kolleginnen und Kollegen.
Mit dem 1973 von Sohrab Shahid Saless gedrehten „A Simple Event“ liegt bei „10 Days of Iranian Cinema“ auch ein Film aus der Schah-Ära
vor. Mit diesem wortkargen, streng inszenierten, dabei tief berührenden Kindheitsbild aus einer maroden Siedlung am Kaspischen Meer wird
auch auf systemübergreifende Kontinuitäten verwiesen. Das iranische Kino fuhr immer dann zu Höchstform auf, wenn in seinem Zentrum
Vergessene, Ausgestoßene, Gefährdete standen. Diese soziale Empathie ging stets mit ungewöhnlichen Erzählformen einher.
Auch der jüngste Beitrag des Festivals steht in dieser Tradition. „Shouting at the Wind“ (2018) von Siavash Jamali und Ata Mehrad erzählt von
den verzweifelten Befreiungsversuchen eines Jugendlichen aus familiärem und urbanem Sumpf. Obwohl zwischen beiden Filmen fast 50 Jahre
liegen, verbindet sie eine gemeinsame Haltung. Dass Kino ein fragiler kultureller Raum inmitten tiefgreifender Umbrüche sein kann, zeigt
Mohammadreza Farzad im nur 30-minütigen „Blames and Flames“ (2011). In dynamischer Montage verknüpft er Ausschnitte aus Spielfilmen
von vor 1979 mit dokumentarischen Bildern aus der Zeit des Umsturzes.
Das Online-Festival „10 Days of Iranian Cinema“ ist vom 12. bis 21. Juni unter www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/on-
demand/iran-filme.html freigeschaltet.
1 von 1 15.06.2020, 12:24Mo 15.06.2020 - "Berlin Postkolonial" will streitbare Statuen umgestal... https://www.rbb-online.de/rbbkultur/kulturnachrichten/2020/06/Berlin... 1 von 1 15.06.2020, 12:26
Firefox https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/790347/16 1 von 1 15.06.2020, 10:03
Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464901/12
F.A.Z. - Feuilleton Samstag, 13.06.2020
Hilfsfonds des Goethe-Instituts
Das Goethe-Institut und das Auswärtige Amt haben einen Hilfs-
fonds für kulturelle Einrichtungen im Ausland aufgelegt, die sich
für künstlerische Freiheit und pluralistische Gesellschaften einset-
zen. Der Fonds soll insbesondere langjährigen lokalen Partnern der
Goethe-Institute helfen, die durch die Corona-Pandemie ausgelöste
Existenzkrise zu überstehen. Die Mittel des Fonds, dessen Budget in
Höhe von drei Millionen Euro aus dem Haushalt des Außenministe-
riums stammt, werden durch ein Konsortium vergeben, dem neben
den Trägerinstitutionen auch Vertreter mehrerer deutscher Stiftun-
gen und der deutschen Unesco-Kommission angehören. Die Beihil-
fen können bis zum 30. Juni auf dem Bewerbungsportal der
Goethe-Institute beantragt werden, die Höchstsumme beträgt fünf-
undzwanzigtausend Euro. Die Laufzeit des Hilfsfonds, der auf drei
Monate angelegt ist, beginnt Anfang September. Mit den Förder-
mitteln sollten etwa Künstlerkollektive, Schreibwerkstätten, Kultur-
zentren oder freie Theatergruppen unterstützt werden, deren
Finanzierung gerade in autoritären Staaten infolge der Pandemie
weggebrochen sei, sagte der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-
Dieter Lehmann, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Diese mutigen
Leute jetzt hängenzulassen können wir uns nicht leisten.“ kil.
1 von 1 14.06.2020, 19:35Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
F.A.Z. - Feuilleton Montag, 15.06.2020
Der Drive der punktierten
Zweiunddreißigstel
Drei Bagatellen um B.: Brendel, Beatles, Boogie-
Woogie/Von Heiner Goebbels
In der Berliner Philharmonie konnte ich 2003 eine überraschende
Entdeckung machen – nicht im Konzert, sondern in der Umbau-
pause einer Probe. Simon Rattle hatte zuvor an meinem Orchester-
stück „Aus einem Tagebuch“ gearbeitet, danach stand Beethovens
drittes Klavierkonzert auf dem Programm. Die Philharmoniker
hatten die Bühne für eine Pause verlassen. Nur Simon Stockhausen
saß noch am Keyboard und korrigierte die Lautstärke und das
Tempo der Maschinensounds, die in meiner Komposition als Samp-
les zugespielt werden, als Alfred Brendel auf die Bühne kam und
sich mit einigen Takten von Beethovens Klavierkonzert einspielte –
von den rabiaten, industriellen Geräuschen völlig unbeeindruckt.
Dazu trat in die Mitte der Bühne ein Bühnenmeister und rief dem
Maschinisten die Höhe der Podien zu, die für die neue Orchester-
aufstellung verändert werden mussten: „Vierzig! Fünfundvierzig!
Fünfzig!“ Das störte weder Brendel noch Stockhausen. Niemand
spielte sich hier auf, alle drei gingen hochprofessionell und konzen-
triert ihren jeweiligen Aufgaben nach, und die Maschinengeräu-
sche, Beethoven-Fragmente, Zahlenreihen liefen unabhängig und
gleichberechtigt nebeneinander ab. Geräusch, Musik und Stimme –
alle hatten Platz in einer entspannten, selbstverständlichen, fast
utopischen Koexistenz.
In diesem Moment entstand eine ungewöhnliche Musik, die mir
auch einen neuen Einblick in das allzu bekannte Repertoirestück
ermöglicht hat. Und es entstand ein ungewöhnliches Bild: drei
Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen und ästhetischen
Sphären, in verschiedene Richtungen schauend – und eine sich wie
von Geisterhand bewegende Bühne. Ich war der einzige Zuschauer
1 von 3 15.06.2020, 09:32Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
in der leeren Philharmonie und dachte, so müsse Neues Musikthea-
ter sein. Und auf diese Weise wäre es auch in Zeiten dieser Pande-
mie aufführbar.
Die Konzerterlebnisse, die ich als Jugendlicher in einer beschauli-
chen pfälzischen Kleinstadt mit klassischer Musik machen konnte,
wären heute undenkbar. Das Kulturprogramm war legendär. Von
einem Stehplatz aus, für zwei Mark, sah und hörte ich die größten
Interpreten der Nachkriegszeit: Wilhelm Kempff, Claudio Arrau,
Wilhelm Backhaus und viele andere. Ob Mstislaw Rostropowitsch
oder Kyrill Kondraschin, auch für die russischen Künstler stand
diese Kleinstadt auf dem Plan, selbst wenn sie nur für vier Konzerte
nach Deutschland kamen.
Nahezu alle hatten Beethoven im Programm. Musik des zwanzigs-
ten Jahrhunderts sah der Repertoirebetrieb nicht vor. Sogar die
Berliner Philharmoniker und Karajan kamen 1968 und spielten
Beethovens Fünfte. Das machte mir zwar großen Eindruck, aber
war ich davon berührt? Eher nicht. Aufgerüttelt wurde ich vom
Eigensinn der Solisten, der Fragilität der Bachkonzerte mit David
und Igor Oistrach, dem tanzenden Sergiu Celibidache und amüsiert
von der gefeierten Beethoven-Interpretin Elly Ney, die als Zugabe
mit dem Publikum „Guten Abend, gut’ Nacht“ sang. Zu Hause spiel-
te ich auf dem Klavier die üblichen Beethoven-Sonaten, aber viel
wichtiger waren mir Bach und Boogie-Woogie; und ich brachte mir
die neuen Songs der Beatles und Beach Boys bei.
Aber eine Erfahrung hat damals mein Beethoven-Bild verändert: als
Swjatoslaw Richter Beethovens letzte Sonate op. 111 im Programm
hatte. Zu Beginn des zweiten Satzes spielte er die Passage der punk-
tierten Zweiunddreißigstel mit einem derartigen Drive, als handele
es sich um einen Boogie-Woogie. Ich erinnere mich noch an den
Schock, den das bei mir auslöste. Die Energie, mit der er dabei das
Klavier ansprang, fiel aus dem Rahmen all der anderen Konzerte,
und plötzlich verflüchtigte sich auch der Graben, der bis dahin
zwischen Bühne und Stehplatz, zwischen meinen klassischen und
nicht-klassischen Musikwelten bestanden hatte. Das sollte immer
noch Beethoven sein?
Natürlich ist dieses Bild später komplexer geworden. Während
meines Musikstudiums hat mir mein Klavierprofessor nicht nur
2 von 3 15.06.2020, 09:32Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
beigebracht, wie man sich an der Alban-Berg-Sonate versucht, für
Stücke von John Cage das Klavier präpariert, für Earle Brown nach
der Stoppuhr spielt oder die Intonarumori des Futuristen Luigi
Russolo bedient; er hat mir auch die Überraschungen und Brüche
in den späten Beethoven-Bagatellen nahegelegt. Nur die Sonate op.
111 hatte ich seit jener Teenagerzeit nie wieder gehört.
Das sollte sich vor kurzem in einem Schöneberger Hinterhof in
Berlin ändern, als in den Räumen eines Klavierbauers zur Eröff-
nung des Beethoven-Gedenkjahres sechzig Pianisten an vier aufein-
anderfolgenden Tagen diese letzte Sonate spielten. Nacheinander.
Als ich davon erfuhr, waren die ersten beiden Tage schon vorbei.
Die Namen der meisten Pianisten waren mir unbekannt, Igor Levit
hatte ich verpasst; nach meinen ersten beiden Hörerfahrungen kam
Pierre-Laurent Aimard, hatte allerdings die Sonate „nicht drauf“,
sondern bot sich stattdessen an, einen jungen Mann zu unterrich-
ten. Wie er dann die Sonate mit Humor und großer Freundlichkeit
für den kleinen Kreis der Zuhörer und Zuhörerinnen aufschloss und
durch seine Eingriffe und Kommentare analysierte, war eine erhel-
lende, großartige Lehrstunde.
Zum Beispiel unterbrach er den Pianisten und bat ihn zu singen.
„Wie?“ – „Ja, singen Sie das Thema. Wenn Sie nur Klavier spielen
wollen, müssen Sie sich einen anderen Komponisten suchen. Beet-
hoven muss man singen.“ Und der Erfolg dieser kleinen Maßnahme
für Atem, Phrasierung, Dynamik wurde für alle schlagartig nach-
vollziehbar. Viele Male hörte ich die Sonate noch, immer anders:
mal streng und voller Brüche, mal dramatisch, mal auf expressive
Weise romantisierend, mal fast meditativ und entschleunigend.
Aber immer Beethoven. Ein nachahmenswertes Format, das mir
eine starke Erfahrung ermöglicht hat. Besser als Streaming. Und
anderthalb Meter Abstand konnten auch hier zwanglos eingehalten
werden.
Heiner Goebbels ist Komponist und war von 2012 bis 2014 Inten-
dant der Ruhrtriennale.
3 von 3 15.06.2020, 09:32My Favorite String Quartet - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/06/14/arts/music/alban-berg-string-quar... 1 von 3 15.06.2020, 12:39
My Favorite String Quartet - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/06/14/arts/music/alban-berg-string-quar... 2 von 3 15.06.2020, 12:39
My Favorite String Quartet - The New York Times https://www.nytimes.com/2020/06/14/arts/music/alban-berg-string-quar...
◆◆◆
◆◆◆
◆◆◆
◆◆◆
3 von 3 15.06.2020, 12:39Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
F.A.Z. - Feuilleton Montag, 15.06.2020
Wie ernst meint es der
Dissident?
Der Schriftsteller Jörg Bernig wollte Leiter des
Kulturamts in Radebeul werden. Für sein kritisches
Milieu im Osten schlug die Stunde der Wahrheit.
Zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer gaben Walter Schmitz und
Jörg Bernig einen 750 Seiten dicken Band über „Schriftsteller aus
der DDR in der Bundesrepublik“ heraus. Titel: „Deutsch-deutsches
Literaturexil“. Bernig wurde 1964 in Wurzen geboren, studierte in
Leipzig und wurde 1996 an der Freien Universität Berlin mit einer
Arbeit über Stalingrad-Romane promoviert. Seit 1998 veröffentlicht
er Lyrik und Ro-
mane. Am Dresdner Lehrstuhl von Schmitz war er als Projektmitar-
beiter beschäftigt. Zum Kompendium über die DDR-Schriftsteller in
der Bundesrepublik hat Bernig zwei Aufsätze beigesteuert: über
Siegmar Faust und Ulrich Schacht, die 1976 nach Westdeutschland
kamen. Bernig zeigt sich hier als untadeliger Germanist: Er inter-
pretiert sensibel, belegt gründlich und schreibt eine Prosa ohne
Jargon. Von Schacht zitiert er einen Satz von 1982: „Ich kann in
Deutschland kein Emigrant sein.“
Jörg Bernig, dessen literarische Produktion ebenfalls um den
Komplex von Heimat, Flucht und Vertreibung kreist, würde seine
eigene Haltung zu seinem Vaterland inzwischen wohl nicht mehr
mit dem Satz Schachts bestimmen. Er hat sein jüngstes Buch in
einer Taschenbuchreihe der Dresdner Buchhandlung von Susanne
Dagen veröffentlicht, die den Titel „Exil“ trägt. Die anderen
beiden Autoren der Reihe sind Monika Maron und Uwe Tellkamp.
Vor drei Jahren sammelte Susanne Dagen Unterschriften für einen
offenen Brief, der dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels
1 von 4 15.06.2020, 09:31Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
vorwarf, einer „Meinungsdiktatur“ Vorschub zu leisten. Der Titel
des Aufrufs lautete „Charta 2017“. Dass die Unterzeichner sich in
die Kontinuität der „Charta 77“ stellten, der Petition der Opposition
der Tschechoslowakei, wurde weithin als Anmaßung verurteilt.
Genauso meinen es aber die Intellektuellen, die sich im Zuge der
Flüchtlingskrise des Jahres 2015 zu einem mehr oder weniger losen
Aktionsbündnis zusammenfanden, mit dem Buchhaus Loschwitz
als Basisstation und dem örtlichen Großschriftsteller Tellkamp als
Sprecher: Der systemkritischen Redensart, die Regierenden in
Berlin seien auf die Errichtung einer neuen Diktatur aus, wollen sie
durch Rückgriff auf die Erfahrung der Ostblock-Dissidenten
Substanz verleihen.
Wie ernst diese Behauptungen von Wiederkehr oder Kontinuität zu
nehmen sind, das wurde jetzt eine politische Frage, als Jörg Bernig
sich um das Amt des Kulturamtsleiters der Stadt Radebeul bewarb.
Nachdem der Stadtrat ihn am 20. Mai gewählt hatte, gab es Protes-
te aus der Stadt wie aus der sächsischen Kulturszene. Der parteilose
Oberbürgermeister Bert Wendsche legte Widerspruch gegen die
Wahl ein, um einen nochmaligen Wahlgang zu ermöglichen, der für
den heutigen Montag angesetzt wurde. Am Donnerstag zog Bernig
mit einer von Susanne Dagen verbreiteten Erklärung seine Kandi-
datur zurück.
In einem offenen Brief hatten Tellkamp und Dagen Ende Mai die
Proteste gegen Bernigs Wahl als Anschlag auf die Demokratie
bewertet: Kritische Positionen zur Einwanderungspolitik dürften
kein Grund zum Ausschluss von öffentlichen Ämtern sein. Mit dem
Publizisten Friedrich Dieckmann und Sebastian Kleinschmidt, dem
ehemaligen Chefredakteur von „Sinn und Form“, unterschrieben
zwei Repräsentanten bürgerlicher Erbepflege unter den ostdeut-
schen Intellektuellen. Die Positionen zur Flüchtlingspolitik, die
Bernig 2015 und 2016 in mehreren Texten ausgebreitet hat, gaben
Grund zur Nachfrage, weil er sie im Duktus des Dissidenten
vortrug, der im Sinne von Václav Havel in der Wahrheit leben will
und dann aber im Zweifel auch erklären muss, welche Konsequen-
zen er zieht. Wenn jemand den eigenen Zustand als moralische
Ausbürgerung beschreibt, wie will und kann er dann seine bürgerli-
chen Rechte und Pflichten ausüben? Mit der Radebeuler Affäre
schlug die Stunde der Wahrheit für die Dissidenten-Imitatio des
Tellkamp-Zirkels.
2 von 4 15.06.2020, 09:31Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
Bernig hat festgestellt, dass der deutsche Staat „seine Souveränität“
schon lange vor 2015 „aufgegeben“ habe. Unter Anspielung auf
Brechts Gedicht über den 17. Juni 1953 beschrieb er eine „Lage, in
der die Regierung und auch weite Teile der Medienwelt gegen das
Volk regieren“, eine vorrevolutionäre
Situation. Nur der Volkszorn, gab er zu verstehen, könne Abhilfe
schaffen. Als er sich nun um eine Stelle als städtischer Beamter
bewarb, handelte er da als Organ dieses Zorns, oder hat der Zorn
sich inzwischen erübrigt? In den Essays des von Susanne Dagen
verlegten Bandes „An der Allerweltsecke“ beschwört er das Reifen
der Früchte des Zorns: „Lauter und lauter verschaffen sich diejeni-
gen Gehör, die gegen den Verlust ihrer Angelegenheiten protestie-
ren“, und sie „verschaffen sich Zugang zu den Parlamenten und
Regierungen“.
Der Oberbürgermeister von Radebeul gab zwischenzeitlich die
versöhnliche Parole aus, dass es bei der Zuständigkeit für die Kultur
auf die politischen Meinungen des Amtsleiters nicht ankomme.
Aber Bernig hat seinen Angriff auf die herrschende Politik
ausdrücklich damit begründet, dass sie keinen Begriff von Kultur
habe, unter „Unkenntnis der Komplexität von Kultur“ leide. „Für
nicht wenige der in Deutschland Regierenden scheint Kultur nichts
weiter als ein Konzertabonnement zu sein. Kultur regelt aber
grundlegend das Zusammenleben.“ Die meisten deutschen Kultur-
politiker sehen ihre Aufgabe allerdings gerade nicht in der Ermögli-
chung des Konzertbetriebs. Oder sie schreiben dieser Kulturförde-
rung eine politische Funktion zu: So behauptet Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters allen Ernstes, die Erhaltung der Grundversor-
gung mit Kinos diene der Bekämpfung der AfD. Dieses politisierte
Verständnis von Kultur begegnet in der Programmatik des Rade-
beuler Beinahe-Amtsleiters Bernig seinem fratzenhaften Spiegel-
bild. Das bedeutet aber auch, dass Bernigs Rollenverständnis gar
nicht so dissident ist, wie er es sich einbildet.
Die Karriere von Jörg Bernig eignet sich für eine Fallstudie einer
Entwicklung in der ostdeutschen Intellektuellenwelt, für die sich
das einfache, aber nicht falsche Stichwort der Radikalisierung
eingebürgert hat. Neben der Verschiebung von Ansichten müsste
man auch den Ton studieren. Die Doktorarbeit war noch eine
Verteidigung der Aufarbeitung der Vergangenheit mit Adorno und
3 von 4 15.06.2020, 09:31Firefox https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/464909/11
Mitscherlich. Der Schacht-Aufsatz verbirgt die politische Überein-
stimmung nicht. Als Herausgeber des Bandes „Die selbstbewusste
Nation“ machte Schacht in Bernigs Deutung das Verdrängte des
vereinigten Deutschland öffentlich: Auch die Bundesrepublik sei
1990 untergegangen. Bernig merkte an, dass sich „ostdeutsche
Intellektuelle kaum je“ an dieser Debatte beteiligt hätten. Das hat
sich ein Vierteljahrhundert später komplett geändert. Kurz vor
seinem Tod unterschrieb Ulrich Schacht noch wie Bernig die
„Gemeinsame Erklärung 2018“, das neonationalistische Manifest
der Merkel-Feinde.
In einem Zitat aus der Besprechung eines Schacht-Gedichtbandes,
die 1981 in dieser Zeitung erschien, setzte Bernig hinter die
Wendung „bei uns“ zur Bezeichnung der Welt, von welcher der
Rezensent Schacht abhob, ein Ausrufezeichen in Klammern. Hier
markierte Bernig beiläufig einen Stachel, der ein mächtiges Motiv
der heutigen Pseudo-Dissidenz bildet: das Gefühl der Zurückset-
zung im ostdeutschen Bildungsmilieu. Die durch die Krise von 2015
angeblich aufgeworfene Schicksalsfrage hat Bernig auf die Formel
gebracht: Bundesrepublik oder Deutschland?
Auch der liberale Staat kann vormundschaftliche Züge ausbilden.
Ein Ferment dissidenter Intelligenz könnte der Öffentlichkeit
guttun, und Überempfindlichkeit ist allemal besser als Unempfind-
lichkeit. Beim Blick in Bernigs jüngere Schriften ist das Eklatante
die Vergröberung im Stil wie im Argument. Eine mit der Schablone
produzierte politische Essayistik kann im literarischen Sinne nicht
als dissident gelten.
Den Horizont eines neuen mittel-
europäischen Konservatismus umreißt Bernig in einem der Reise-
berichte des „Exil“-Bändchens so: „Gustav Mahler sprach irgendwo
vom ,Hüten der Glut, nicht vom Aufbewahren der Asche‘.“ Mahler
spricht davon, wie Gerald Krieghofer nachgewiesen hat, nur im
Internet. Die wahre Quelle dieser in der rechten Pamphletistik
überall zitierten Definition von Tradition ist eine Rede des französi-
schen Sozialisten Jean Jaurès. Bundesrepublik oder Deutschland?
Jörg Bernigs Deutschland ist eine ziemlich ortlose Sache mit schi-
märischen Grenzen. Patrick Bahners
4 von 4 15.06.2020, 09:31Sie können auch lesen