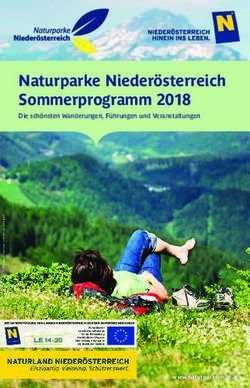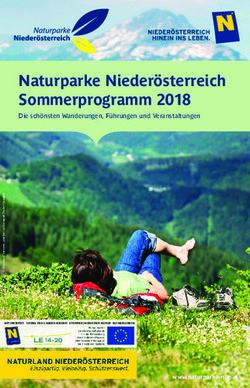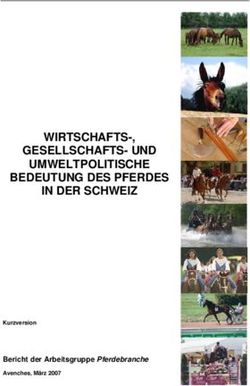Programmanalyse Schweizer Regionalfernsehen mit Leistungsauftrag 2018 - Bakom
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Programmanalyse Schweizer Regionalfernsehen mit Leistungsauftrag – 2018 Bericht Eine Untersuchung der Publicom AG im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation Dr. Matthias Brändli Stefano Sasso Dr. Sonja Glaab-Seuken © Publicom AG, CH-8802 Kilchberg, Juli 2019
Inhaltsverzeichnis
Management Summary .................................................................................................................4
1. Ausgangslage, Auftrag und Ziel der vorliegenden Untersuchung .............................................5
2. Methodische Umsetzung ..........................................................................................................8
2.1. Methodischer Steckbrief ...................................................................................................8
2.2. Entwicklung und Etablierung des Forschungsinstruments ...............................................10
2.3. Kurzzusammenfassung der wichtigsten bisherigen Forschungsresultate .........................11
2.4. Operationalisierung ........................................................................................................12
2.5. Interpretationsgrundlage für die Ergebnisse ...................................................................16
2.6. Reliabilität der Codierentscheidungen ............................................................................18
2.7. Abschliessende Bemerkungen zur methodischen Umsetzung .........................................19
3. Gesamtergebnisse der quantitativen Analysen 2018 ..............................................................20
3.1. Programmstruktur ..........................................................................................................20
3.2. Sendungsstruktur ...........................................................................................................27
3.3. Leistungsindikatoren.......................................................................................................34
3.3.1. Tagesaktualität ........................................................................................................34
3.3.2. Relevanz ..................................................................................................................35
3.3.3. Vielfalt .....................................................................................................................38
3.3.4. Sprache und Regionalbezug.....................................................................................40
4. Ergebnisse der quantitativen Analysen 2018: Deutsche Schweiz............................................45
4.1. Von mehreren Sendern abgedeckte Ereignisse in der Untersuchungsperiode .................45
4.2. Ergebnisse der einzelnen Regionalfernsehsender ............................................................47
4.2.1. Kanal 9 ....................................................................................................................47
4.2.2. TeleBärn...................................................................................................................48
4.2.3. Telebasel ..................................................................................................................49
4.2.4. Tele M1 ...................................................................................................................50
4.2.5. Tele 1.......................................................................................................................51
4.2.6. Tele Top...................................................................................................................52
4.2.7. TVO.........................................................................................................................53
4.2.8. Tele Südostschweiz ..................................................................................................54
4.2.9. TeleZüri....................................................................................................................55
25. Ergebnisse der quantitativen Analysen 2018: Französische und italienische Schweiz ............56
5.1. Von mehreren Sendern abgedeckte Ereignisse in der Untersuchungsperiode .................56
5.2. Ergebnisse der einzelnen Regionalfernsehsender ............................................................58
5.2.1. Canal 9 ....................................................................................................................58
5.2.2. Léman Bleu ..............................................................................................................59
5.2.3. La Télé .....................................................................................................................60
5.2.4. Canal Alpha .............................................................................................................61
5.2.5. TeleBielingue ...........................................................................................................62
5.2.6. TeleTicino ................................................................................................................63
5.3. Durchschnittswerte der konzessionierten Regionalfernsehsender ...................................64
6. Fazit: Die Programmleistungen der Schweizer Regionalfernsehsender 2018 ..........................65
Anhang
A. Literatur ..................................................................................................................................68
B. Quellen....................................................................................................................................70
C. Instrumentarium ......................................................................................................................71
D. Codebuch ...............................................................................................................................73
3Management Summary
Inhalt der vorliegenden Untersuchung ist die Umsetzung der Leistungsaufträge durch die 13 kon-
zessionierten Schweizer Regionalfernsehsender. Der Anspruch des Gesetzgebers beziehungs-
weise der Regulierungsbehörden auf periodische Überprüfung ergibt sich durch die teilweise öf-
fentliche Finanzierung der konzessionierten Regionalfernsehsender, die einen Anteil der Abgaben
für Radio und Fernsehen erhalten.
Untersucht wurden insgesamt 13 regionale Fernsehsender aus ebenso vielen Versorgungsgebie-
ten. Diese 13 Sender veranstalten 14 Programme. Zum Vergleich wurde TeleZüri, als Sender
ohne Leistungsauftrag und Abgabenanteil, in die Untersuchung mitaufgenommen. Für die Erhe-
bung wurden zwei künstliche Wochen mit zufällig gezogenen Wochentagen gebildet, die sich
über das ganze Jahr verteilten. Pro Stichtag wurde die explizit in der Konzession genannte Haupt-
sendezeit (18.00 bis 23.00 Uhr) als Aufnahmedauer festgelegt. Für alle 15 Sender insgesamt wur-
den somit 750 Stunden Programm aufgenommen. Mittels quantitativer Inhaltsanalyse wurde das
komplette Bild- und Tonmaterial dahingehend untersucht, wie die Leistungsindikatoren Tagesak-
tualität, Relevanz, Vielfalt (Themen-, Meinungs-, Akteurs- und Formenvielfalt), Sprache und Re-
gionalbezug umgesetzt wurden.
Das Programm aller untersuchten Regionalfernsehprogramme bestand während der fünfstündi-
gen "Prime Time" zum grössten Teil aus Informationssendungen. Mit wenigen Ausnahmen do-
minierten bei allen untersuchten Sendern die beiden Themenbereiche Politik und Verwaltung so-
wie Gesellschaft. Aber auch Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport machten
einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung aus. "Softere" Themen, wie beispielsweise Hu-
man Interest oder "Bad News", fanden sich bei den meisten Sendern nur in einem relativ gerin-
gen Ausmass. Tendenziell war der Anteil von "Soft News" (Human Interest, "Bad News") bei
Programmen aus der Deutschschweiz einerseits, beim Sender TeleZüri andererseits höher als bei
den übrigen untersuchten Programmen.
Die untersuchten Regionalfernsehsender profilieren sich hingegen kaum mit der Einbettung von
verschiedenen Meinungen oder dem Aufzeigen einer zusätzlichen, zweiten Perspektive. Die
überwiegende Mehrheit der Informationsbeiträge ist nüchtern und bietet kaum Einordnung oder
Orientierung zum Sachverhalt des Geschehens an. Schwergewichtig berichten Regionalfernseh-
sender über Ereignisse, die innerhalb des Konzessionsgebiets stattgefunden haben und stellen
sehr häufig einen Bezug zu ihrem Versorgungsgebiet her. Es zeigen sich aber auch hier Unter-
schiede zwischen den einzelnen Sendern: So neigen insbesondere die drei Programme der CH-
Media-Senderfamilie zu einer eher international ausgerichteten Berichterstattung, die weniger
dem jeweiligen Versorgungsgebiet verpflichtet ist.
41. Ausgangslage, Auftrag und Ziel der vorliegenden Untersuchung
An Radio und Fernsehen werden in der Schweiz hohe normative Erwartungen gestellt: Die
schweizerische Bundesverfassung1 sieht unter anderem vor, dass Radio und Fernsehen zur Bil-
dung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung beitragen
(Art. 93, Abs. 2). Damit die Veranstalter von Radio- und Fernsehprogrammen diesen Ansprüchen
gerecht werden, gibt das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG)2 in Artikel 3 Bedingun-
gen für die Ausstrahlung eines Programms in der Schweiz vor: Veranstalter unterstehen der vor-
gängigen Meldepflicht beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) oder müssen über eine
Konzession verfügen. Diese Rundfunkkonzessionen, die in der Schweiz vom Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation – dem UVEK – vergeben werden,
sind an bestimmte Leistungsaufträge geknüpft. Leistungsaufträge spielen insbesondere dann eine
Rolle, wenn die betroffenen Programme knapp verfügbare Frequenzen beanspruchen (Radio)
und/oder mit öffentlichen Geldern finanziert werden (Radio und Fernsehen). Daraus leitet sich
der Anspruch des Gesetzgebers beziehungsweise der Regulierungsbehörden ab, die Umsetzung
der Leistungsaufträge periodisch zu überprüfen.
2018 war es genau zehn Jahre her seit der letzten grossen Vergaberunde von Konzessionen an
private regionale Radio- und Fernsehsender in der Schweiz. In diesen aktuell gültigen konzessi-
onsrechtlichen Bestimmungen ist unter anderem festgehalten, dass der mediale "Service public"
auf nationaler und sprachregionaler Ebene durch die SRG SSR, auf lokal-regionaler Ebene durch
private Veranstalter mit Leistungsauftrag erfüllt werden soll. Diese privaten Rundfunkanbieter
verpflichten sich, die mediale Grundversorgung auf lokal-regionaler Ebene sicherzustellen, in dem
sie sich an die in Artikel 5 ihrer Konzessionen festgehaltenen Bestimmungen halten:
1. Die Konzessionärin veranstaltet ein tagesaktuelles regionales Fernsehprogramm, das vor-
wiegend über die relevanten lokalen und regionalen politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhänge informiert sowie zur Entfaltung des kulturellen Lebens im Ver-
sorgungsgebiet beiträgt.
2. Die Konzessionärin stellt werktags während den Hauptsendezeiten (18 bis 23 Uhr) si-
cher, dass ihre lokalen und regionalen Informationsangebote:
a. in erster Linie relevante Informationen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Kultur, Gesellschaft und Sport beinhalten;
b. thematisch vielfältig sind;
c. eine Vielfalt an Meinungen und Interessen wiedergeben;
1
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 23. September 2018)
2
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) vom 24. März 2006 (Stand am 01. Januar 2017)
5d. eine Vielfalt von Personen beziehungsweise Personengruppen zu Wort kommen
lassen, und
e. das gesamte Versorgungsgebiet berücksichtigen3.
Im Gegenzug erhalten die privaten Veranstalter privilegierten Zugang zur Verbreitungsinfrastruk-
tur sowie einen gewissen Wettbewerbsschutz: Das RTVG untersagt der SRG SSR in Artikel 26 die
Ausstrahlung regionaler Programme im Fernsehen. Mit Genehmigung des UVEK darf die
SRG SSR lediglich in ihren Radioprogrammen zeitlich begrenzte regionale Fenster einfügen. Die
Sender der SRG SSR machen mit den "Regionaljournalen" von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Regionalfernsehsender mit Leistungsauftrag erhalten zudem einen Anteil der Abgaben für Radio
und Fernsehen, der abhängig ist vom Versorgungsgebiet, das dem entsprechenden Sender zuge-
teilt ist. Mit dieser Aufteilung der Abgaben zwischen der SRG SSR und den privaten Radio- und
Fernsehsendern sollen letztere in der Erfüllung ihres Leistungsauftrags unterstützt werden. Die
Abgabenanteile, die für die privaten Radio- und Fernsehsender vorgesehen sind, betragen 4 bis 6
Prozent des Ertrags der Abgabe für Radio und Fernsehen (RTVG, Art. 40), den restlichen Anteil
erhält die SRG SSR. Der Anteil, den die privaten Radio- und Fernsehstationen erhalten, wurde in
den letzten Jahren schrittweise angehoben und Ende 2018 für 2019 auf die gesetzlich maximal
möglichen sechs Prozent festgesetzt. Insgesamt erhielten die regionalen Radio- und Fernseh-
sehsender 2018 67.5 Millionen Franken. Für das Jahr 2019 wurde dieser Betrag auf 81 Millionen
Franken erhöht. Der Grossteil dieser Gelder geht an die regionalen Fernsehsender: 2018 erhielten
die 13 konzessionierten Veranstalter 41.9 Millionen Franken, für das Jahr 2019 wurde ihr Anteil
an den Abgaben für Radio und Fernsehen auf 50.3 Millionen Franken angepasst. Der Betrag für
einen einzelnen Regionalfernsehsender setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag zur Deckung
der standortunabhängigen Produktionskosten (60%) und einem Strukturausgleich, der wirt-
schaftliche Standortnachteile einzelner Versorgungsgebiete kompensieren soll (40%). Diese bei-
den Elemente erklären die unterschiedlichen Beträge, die jeder Regionalfernsehsender enthält. Im
Jahr 2018, das für den vorliegenden Untersuchungsbericht massgeblich ist, erhielt jeder Sender
zwischen 2.5 (Versorgungsgebiet Zürich-Nordostschweiz, Tele Top) und 4.2 Millionen Franken
(Versorgungsgebiet Vaud-Fribourg, La Télé). Canal 9/Kanal 9 erhält einen Anteil an den Abga-
ben für Radio und Fernsehen von 4.1 Millionen Franken zugesprochen, muss damit aber ein Pro-
gramm für den französisch- und den deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis bestreiten.
Die vorliegende Untersuchung ist folglich nicht nur aus demokratietheoretischer, sondern auch
aus medienpolitischer und konzessionsrechtlicher Perspektive von Relevanz. Konkret hat die Pro-
grammanalyse der Schweizer Regionalfernsehsender mit Leistungsauftrag zum Ziel, dem Regula-
tor anhand der Analyse des ausgestrahlten Programms der einzelnen konzessionierten
3
Konzession für ein Regionalfernsehen mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil
6Regionalfernsehsender Hinweise dazu zu geben, wie die Veranstalter die in den rechtlichen
Grundlagen formulierten Bestimmungen zur Ausstrahlung von regionalem Fernsehen umsetzen.
Die Beurteilung (des Ausmasses) der Konzessionserfüllung aber ist Aufgabe des BAKOM und die
Resultate in der vorliegenden Studie werden nach Vorgabe der Auftraggeberin ausgewiesen.
72. Methodische Umsetzung
2.1. Methodischer Steckbrief
Methode Quantitative Inhaltsanalyse
Instrument Anhang C und D
Untersuchte Programme
Deutsche Schweiz > Kanal 94
> TeleBärn
> Telebasel
> Tele M1
> Tele 1
> Tele Top
> TVO
> Tele Südostschweiz
> TeleZüri (Veranstalter ohne Leistungsauftrag/Abgabenanteil)
Französische Schweiz > Canal 94
> Léman Bleu
> La Télé
> Canal Alpha
> TeleBielingue5
Italienische Schweiz > TeleTicino
Stichprobe Zwei künstliche Wochen, jeweils Montag bis Freitag
Aufnahmedauer: 5 Stunden pro Tag
Pro Sender: 50 Stunden Programm
Total: 750 Stunden Programm
4
Die Konzession wurde an den Sender Canal 9 vergeben und schreibt vor, dass für den deutsch- und französischsprachigen Teil
des Versorgungsgebiets (Kanton Wallis plus Bezirk Aigle im Kanton Waadt) je ein redaktionelles Programmfenster in der Haupt-
sendezeit (unter dem Namen Kanal 9 resp. Canal 9) ausgestrahlt wird (Art. 6 der Konzession). In der anschliessend folgenden
Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 3) wird das Programm von Kanal 9 unter den Sendern der deutsch-, dasjenige von Canal 9
unter den Sendern der französischsprachigen Schweiz aufgeführt.
5
TeleBielingue ist nach eigenen Angaben das "einzige wirklich zweisprachige Regionalfernsehen der Schweiz" (http://www.te-
lebielingue.ch/de/team, 07.05.2019). Aufgeführt wird der Sender unter den Programmen der französischen Schweiz. In wel-
chem Ausmass welche Sprache gesprochen wird, ist eine offene, empirisch zu klärende Frage (Kapitel 3.3.4).
8Stichtage 10 Stichtage
1. Montag, 18. Juni 2018
2. Dienstag, 28.August 2018
3. Mittwoch, 24. Januar 2018
4. Donnerstag, 05. April 2018
5. Freitag, 09. November 2018
6. Montag, 02. Juli 2018
7. Dienstag, 11. September 2018
8. Mittwoch, 07. Februar 2018
9. Donnerstag, 19. April 2018
10. Freitag, 23. November 2018
>
Bestimmung der Stichtage > Verteilung der Stichtage über das ganze Erhebungs-
jahr, um Verzerrungen der Stichprobe durch saiso-
nale Besonderheiten zu vermeiden
> Bestimmung eines Zeitfensters von 14 Tagen für den
ersten Stichtag im Januar: 22.01. bis 04.02.2018
> Zufallsauswahl eines Tages innerhalb dieses Zeit-
raums: Mittwoch, 24. Januar 2018
> Festlegung des zweiten Stichtags: erster Stichtag
plus zwei Wochen > Mittwoch, 07. Februar 2018
> Restliche Stichtage: Gleichmässige Verteilung auf die
im Jahr noch verbleibenden Wochen
> Zufallsauswahl eines Tages innerhalb der bestimm-
ten Woche
Zeitraum Hauptsendezeiten: 18.00 bis 23.00 Uhr
Programmaufzeichnung IT + Media Group GmbH, Baden-Baden (D)
Eurospider Information Technology AG, Zürich (CH)
Untersucht werden insgesamt 13 regionale Fernsehsender aus ebenso vielen Konzessionsgebie-
ten. Diese 13 Sender veranstalten 14 Programme. Canal 9 beziehungsweise Kanal 9 sollen, wie
erwähnt, die Grundversorgung an lokalen und regionalen Informationen für den französisch-
/deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis sicherstellen, das als ein Versorgungsgebiet zählt (Va-
lais-Wallis). Zusätzlich wurde zum Vergleich TeleZüri, als Sender, der nur meldepflichtig ist, kei-
nen Leistungsauftrag hat und ergo auch keinen Anteil der Abgaben für Radio und Fernsehen er-
hält, in die Untersuchung mitaufgenommen.
92.2. Entwicklung und Etablierung des Forschungsinstruments
Die kontinuierliche Analyse der Radio- und Fernsehprogramme der konzessionierten Anbieter
wurde 2008 vom BAKOM als Instrument zur systematischen Überprüfung der Leistungsaufträge
initiiert. Das Ziel war, ein "konzeptionell kohärentes Analyse-Instrumentarium" aufzubauen, "das
für alle beobachteten Medien – öffentlich-rechtliche und private Veranstalter, Radio und Fernse-
hen – inhaltlich und methodisch vergleichbare Ergebnisse liefern kann"6. Die beauftragten For-
schungsteams (Publicom/Universität der italienischen Schweiz/Universität Genf und Universität
Fribourg) haben in einer umfassenden Pilotstudie diese Vorgaben soweit als möglich umgesetzt7.
2008 wurde mit der Analyse der SRG-Programme begonnen, 2009 vergab das BAKOM den Auf-
trag für die kontinuierliche Programmanalyse des Schweizer Regionalfernsehens mit Leistungs-
auftrag.
Unter der Leitung von Steffen Kolb (heute: HTW Berlin) konzipierte ein Forscherteam der Univer-
sität Fribourg (in Kooperation mit der Universität Basel) die Studie in enger Anlehnung an die
SRG-Programmforschung. Das Forschungsinstrument wurde aber dahingehend erweitert, dass
der spezielle Programmauftrag der regionalen Privatfernsehsender – der regionale Service public –
adäquat erfasst werden konnte. Dazu wurden insbesondere die Kategorien zum Regionalbezug
(Akteure, Themen, Ortsbezüge) angepasst. Auch das Stichprobenmodell der SRG-Studie wurde
übernommen: Jeweils im Frühling und Herbst wurde das Programm einer natürlichen Kalender-
woche analysiert. Im Verlauf der letzten Jahre wurde das Erhebungsdesign mehrfach geringfügig
verändert. Im Herbst 2010 beispielsweise wurde die Studie zu Vergleichszwecken um den reich-
weitenstärksten, nicht konzessionierten Regionalsender TeleZüri erweitert. 2014 wurden zum ers-
ten Mal kalenderjährliche Auswertungen durchgeführt und die Analyse auf das Fernsehpro-
gramm an Werktagen zwischen 14 und 23 Uhr begrenzt8.
Die vorliegende Untersuchung baut auf diesen empirischen Vorarbeiten auf und führt sie weiter.
Die Studie soll so an die bisher durchgeführten Programmanalysen anknüpfen, dass möglichst
keine Datenbrüche entstehen. Zusammen mit dem BAKOM wurde aber entschieden, die Stich-
probe umzustellen: Während bis und mit 2016 jeweils zwei natürlichen Wochen im Frühling und
Herbst untersucht wurden, stellen in der vorliegenden Untersuchung zwei künstliche Wochen,
deren Tage über das ganze Jahr verteilt sind, das Untersuchungsmaterial dar. Damit wird die
Stichprobe auf eine stabilere Grundlage gestellt und an den international üblichen "State of the
art" angeglichen. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind aus diesem Grund nur mit
Einschränkung und Zurückhaltung mit den früher durchgeführten Programmanalysen zu verglei-
chen. Bei der Operationalisierung der Leistungsindikatoren, auf die im Anschluss eingegangen
6
BAKOM: Schwerpunktthemen Medienforschung 2008/2009 (Erläuterungen)
7
Grossenbacher/Trebbe (2009)
8
Neumann-Braun/Kolb/Brutschi/Pileggi (2015)
10wird, wurde ebenfalls auf die Anschlussfähigkeit Wert gelegt und die Anknüpfung an bisher
durchgeführte Programmanalysen verfolgt.
2.3. Kurzzusammenfassung der wichtigsten bisherigen Forschungsresultate
Die erste Auswertung der Programmstrukturen der privaten Fernsehsender 2009 offenbarte noch
grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Veranstaltern, insbesondere was den Umfang der
tagesaktuellen Sendungen und die Themenschwerpunkte der potentiell informierenden Pro-
grammbeiträge betraf. Seither wurde aber eine Festigung der Charakteristika der Sender und eine
stärkere Ausrichtung an ihren Leistungsaufträgen konstatiert. Die geforderten Inhalte werden
stärker fokussiert. Im Zeitvergleich tragen sie besser zur Sicherung des regionalen Service public
bei als noch 20099. Verglichen mit TeleZüri setzen sich die konzessionierten Sender intensiver –
und damit konzessionskonform – mit ihrer jeweiligen Region auseinander. Kritischer wird der Bei-
trag der Sender zur regionalen Meinungsvielfalt eingeschätzt, was allerdings der Eingrenzung der
Untersuchung auf das tagesaktuelle Programm geschuldet sein könnte10. Diese Entwicklung wird
in der aktuellsten Studie für das Erhebungsjahr 201611 bestätigt: Einerseits befinden sich die regi-
onalen Fernsehsender mit Leistungsauftrag in einem steten Wandel, andererseits stabilisieren sich
die Programme aber auch langsam. In einzelnen Fällen führt die stärkere Gebührenunterstützung
zu einer Ausweitung und inhaltlichen Weiterentwicklung.
Zusätzlich zur kontinuierlichen Programmanalyse der regionalen Privatsender mit Leistungsauf-
trag entstanden Studien, die sich auf Basis der erhobenen Daten mit den möglichen Einflussfak-
toren auf die Programmqualität der Sender auseinandersetzten. Das Forscherteam um Steffen
Kolb konnte beispielsweise empirisch nachweisen, dass die Gebührenfinanzierung in manchen
Regionen essentiell für die Sicherung des regionalen Service public ist. Die Programmqualität wird
allerdings nach dem bisherigen Forschungsstand nicht ausschliesslich durch die Höhe der Gebüh-
ren determiniert und steigende Gebühren gehen nicht automatisch mit einer Verbesserung der
Qualität im Zeitverlauf einher. Weitere strukturelle Faktoren zeigen keinen einheitlichen Einfluss
auf die Programmqualität12.
9
Kolb/Baeva (2013)
10
Neumann-Braun/Kolb/Brutschi/Pileggi (2015)
11
Kolb/Neumann-Braun/Pileggi/Müller (2017)
12
Baeva/Kolb (2013)
112.4. Operationalisierung
Methodische Basis ist das in der Pilotstudie zum Programmwandel im schweizerischen Rundfunk
von Publicom mitentwickelte Forschungsdesign13, auf dem auch die früheren in der Schweiz
durchgeführten Programmanalysen beruhen. In der Studie wurden unter anderem der Begriff des
"Service public" aus verschiedenen Perspektiven und Positionen beleuchtet. Beim Begriff handelt
es sich um ein "ideologisiertes Konzept"14, zu dem es weder in der Politik noch in der Wissen-
schaft einen definitorischen Konsens zu geben scheint. Aus diesem Grund wurde die Wahrneh-
mung des Hauptakteurs – des Publikums – in die Evaluation des Begriffs miteinbezogen. Als
Schlüsselbegriffe des Konzepts konnten die Aspekte "Qualität" und "Vielfalt" identifiziert wer-
den. Deren inhaltsanalytische Operationalisierung wurde anschliessend anhand von sechs Radio-
und zwei Fernsehprogrammen überprüft. Die vorliegende Untersuchung der privaten konzessio-
nierten Fernsehprogramme baut auf diese Konzepte in modifizierter beziehungsweise erweiterter
Form auf.
Das Forschungsprojekt arbeitet mit der Methode der quantitativen Inhaltsanalyse. Darunter ist
eine "empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung
inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen"15 zu verstehen, die in der Kommunikati-
onswissenschaft für die Analyse grosser Text-, Bild- und/oder Videomengen angewendet wird.
Dabei wird die Forschungsfrage zunächst in geeignete Indikatoren und anschliessend in messbare
Variablen mit trennscharfen und sich nach Möglichkeit ausschliessenden Ausprägungen (Katego-
rien) übersetzt. Das eigentliche Instrument der Inhaltsanalyse ist das Codebuch, in dem die Vari-
ablen definiert und nötigenfalls erläutert, sowie mit ihren jeweiligen Kategorien und möglichen
Unterkategorien festgehalten werden. Auf Basis dieses Codebuchs wird die Analyse durchge-
führt. Der Codeplan der vorliegenden Untersuchung findet sich in Anhang D.
Im Folgenden wird auf die konkrete Operationalisierung – das heisst auf die Übersetzung der für
die konzessionierten Regionalfernsehsender zu überprüfenden Leistungsmerkmale in messbare
Indikatoren beziehungsweise Variablen eingegangen16. Wie bereits einleitend erwähnt, verlangt
der Leistungsauftrag von den Regionalfernsehsendern explizit tagesaktuelle, relevante und viel-
fältige Informationen aus dem gesamten Konzessionsgebiet zu Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesell-
schaft und Sport, Vielfalt an Meinungen, Interessen und Personen, sowie einen Beitrag zur
13
Publicom (2007)
14
Publicom (2007), S. 26
15
Früh (2017), S. 29
16
Auf die detaillierte Herleitung der Kategorien aus der Forschungsliteratur bzw. den normativen Verfassungs-, Gesetzes- und
Konzessionsvorlagen wird an dieser Stelle verzichtet. Dafür wird unter anderem auf Grossenbacher/Trebbe (2009) verwiesen
und darin insbesondere auf die Beiträge von Grossenbacher/Trebbe und Kust/Lischer.
12Entfaltung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet17. Diese zu überprüfenden Leistungs-
merkmale werden folgendermassen operationalisiert:
> Tagesaktualität bedeutet, dass das Programm einen (tages-)aktuellen Bezug aufweist. Sie
wird auf Sendungs- und Beitragsebene ermittelt.
> Relevanz ist ein Begriff, der immer in Bezug zu einem konkreten Publikum gesetzt wer-
den muss, damit er nicht inhaltsleer bleibt. Für wen sind oder sollen welche Inhalte rele-
vant sein? Das Konzept kann daher inhaltsanalytisch nicht direkt gemessen werden18. In-
direkt lässt sich Relevanz anhand der Themen (z. B. Politik vs. Human Interest), Akteure,
Ereignisort und anderer Variablen abschätzen. Das setzt aber ein restriktiv-normatives
Konzept von Relevanz voraus. Dass ein solches in der publizistisch-journalistischen Praxis
nicht existiert, zeigen unter anderem die Ereignisanalysen im Rahmen der Radiopro-
grammanalyse 2013, die bei vergleichbaren, im selben Kommunikationsraum operieren-
den Regionalradios sehr unterschiedliche Relevanzkonzepte eruierte19. Es macht auch we-
nig Sinn, Agenda-Vergleiche bei Referenzmedien anzustellen20.
> Vielfalt kann auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Facetten gemessen
werden.
> Themenvielfalt meint, dass eine Vielzahl von behandelten Themen in den Infor-
mationssendungen vorkommt. Vielfalt kann einerseits im Themenmix des einzel-
nen Senders, andererseits auch im Vergleich zwischen verschiedenen Program-
men ermittelt werden.
> Meinungsvielfalt bedeutet, dass Meinungen und Perspektiven verschiedener poli-
tischer und gesellschaftlicher Gruppen in den Informationssendungen dargestellt
werden – entweder indem sie direkt zu Wort kommen, oder indem indirekt auf
die entsprechenden Positionen verwiesen wird. Meinungsvielfalt wird einerseits
über die Akteure ermittelt, andererseits wird erhoben, ob in einem gegebenen
thematischen Kontext nur eine oder mehrere Positionen dargestellt werden.
> Akteursvielfalt bezeichnet das Vorkommen von verschiedenen Personen, Perso-
nengruppen oder Organisationen in Informationsinhalten, insbesondere auch in
Bezug auf ihre unterschiedliche politische und gesellschaftliche Rolle. "Akteure"
sind sowohl aktiv Agierende, als auch Betroffene. Es kann über sie berichtet wer-
den oder sie können selbst zu Wort kommen.
17
Konzession für ein Regionalfernsehen mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil
18
Breunig (1999), S. 95
19
Publicom (2013a), S. 110; Publicom (2013b), S. 105; Publicom (2013c), S. 101
20
Lischer/Schwotzer (2009), S. 89
13> Formenvielfalt bezieht sich auf die Vielfalt der Darstellungs- und Aufbereitungs-
formen – hier im Bereich der Information. Diese drücken sich einerseits in der
Vielfalt der eingesetzten Genres aus, und andererseits – auf Beitragsebene – in
der Verwendung des Spektrums der Beitragsarten und journalistischen Darstel-
lungsformen. Formenvielfalt gilt als ein Indikator der inhaltlichen Vielfalt.
> Sprache ist für die mehrsprachige Schweiz ein besonders wichtiges identitätsstiftendes
Merkmal und ein Indikator für den Regionalbezug. Zu berücksichtigen sind aber auch
Dysfunktionen, z. B. durch die Verwendung von Dialekt, den Landsleute aus anderen
Sprachregionen oder Ausländer nicht verstehen und somit von der Rezeption ausschliesst.
Die Sprache wird sowohl auf Sendungs- als auch Beitragsebene ermittelt.
> Regionalbezug wird einerseits anhand der Ereignisorte erhoben: Wenn der Ort, an dem
ein Berichterstattungsereignis stattfindet, im Konzessionsgebiet liegt, ist der Regionalbe-
zug gegeben. Andererseits werden auch beiläufige Erwähnungen von Ortsbezeichnun-
gen erhoben. Der Regionalbezug bringt zum Ausdruck, welche Regionen der Schweiz in
der Realität der Fernsehprogramme wie prominent vorkommen. Damit können die Fra-
gen, ob der Austausch unter den Landesteilen zustande kommt und ob die Eigenheiten
und Bedürfnisse der Kantone berücksichtigt werden, beantwortet werden.
Die Kategorien Themenbereich, Thema und Akteur können zudem als Indikator für die Emotio-
nalität und die Variablen Sendungs- beziehungsweise Beitragstyp als Indikator für die Kommer-
zialität des Programms verwendet werden. Weitere Leistungsmerkmale, die im Rahmen der
Analyse auf Ebene des Beitrags erhoben werden, sind Orientierungs- oder Einordnungsleistungen
(Beitragsart, journalistische Form, Vorkommen einer anderen Meinung oder Perspektive). Ta-
belle 1 stellt die Operationalisierung der zu überprüfenden Leistungsmerkmale als Übersicht dar.
Weitere Details zur Operationalisierung beziehungsweise dem eingesetzten Instrumentarium fin-
den sich in Anhang C und D.
14Tabelle 1: Operationalisierung der Leistungsindikatoren
Leistungsindikatoren Variablen Bemerkungen
Tagesaktualität Aktualität Aktualitätsbezug des Beitrags (Sendung, Beitrag)
Beitragstyp
Themenbereich
Indirekte Ableitung (z. B. Politik vs. Human Interest; instituti-
Relevanz Thema
onelle Akteure vs. private Akteure)
Ereignisort
Akteur
Themenbereich 10 Themenbereiche/gesellschaftliche Subsysteme
Themenvielfalt
Thema Ca. 50 Themenkategorien
Erster/zweiter Akteur Politische Akteure: nach Parteien
Meinungsvielfalt
Andere Meinung/Perspektive Im gleichen thematischen Kontext
Personen und Institutionen nach ihrer gesellschaftlichen Rolle
Akteursvielfalt Erster/zweiter Akteur
(Politik, Wirtschaft, Kultur etc.) und politischen Zugehörigkeit
Elemente der Programmstruktur (Information, Unterhaltung
Sendungstyp
etc.)
Genre
Formenvielfalt Beitragstyp Nachrichten/Information
Beitragsart Formale Charakteristik
Journalistische Form
Sprache
Sprache Sprache Sprache der Untersuchungseinheit (Sendung, Beitrag)
Kategorisierung nach Sprachregionen, Zentrums- und Kan-
Ereignisort
tonshauptorten, sowie Wirtschaftsräumen
Regionalbezug
Kategorisierung nach Sprachregionen sowie Wirtschaftsräu-
Erster/zweiter Regionalbezug
men
Themenbereich Emotionale Themen (Human Interest, "Bad News")
Emotionalität Thema
Akteur Privatpersonen als Akteure
Sendungstyp
Kommerzialität Werbung, Sponsoring und Eigenwerbung im Programm
Beitragstyp
Beitragsart
Orientierungs-
Journalistische Form Einordnungsleistung
leistungen
Andere Meinung/Perspektive Innerhalb eines gegebenen thematischen Kontexts
Publicom 2019
152.5. Interpretationsgrundlage für die Ergebnisse
Der im nächsten Kapitel beginnenden Darstellung der Ergebnisse wird im Folgenden eine kurze
Interpretationshilfe vorangestellt, die den Zugang zu und das Verständnis der empirischen Resul-
tate erleichtern soll.
Die Ergebnisse werden in der Regel auf Basis der Zeitdauer ausgewiesen. Ein Beispiel: Wenn fest-
gestellt wird, dass in einem Beitrag von 30 Sekunden Länge ein Regionalbezug zum Kommunika-
tionsraum Zürich hergestellt wird, wird ein Regionalbezug von 30 Sekunden ausgewiesen. Das
bedeutet nicht zwingend, dass während des gesamten Beitrags ununterbrochen und ausschliess-
lich Zürich im Zentrum bleibt. Die Messeinheit ist aber trotzdem die Dauer des erhobenen Bei-
trags. Das ist insbesondere für Variablen wie Akteur, Regionalbezug, Ereignisort und Quelle wich-
tig. Bei mehreren vorkommenden Akteuren, Sprechern, Regionalbezügen oder bspw. Quellen
werden jeweils die wichtigsten zwei codiert, im Zweifelsfall die erstgenannten. Wenn im oben er-
wähnten Beispiel im selben Beitrag noch ein Bezug zum Kommunikationsraum Winterthur vorge-
nommen wird, wird für diesen ebenfalls eine Dauer von 30 Sekunden gemessen. Bei der Interpre-
tation der Resultate ist dies entsprechend zu berücksichtigen.
Die Einführung und Diskussion der nachfolgenden Begriffe sollen die Interpretation der gewon-
nen Ergebnisse weiter vereinfachen.
> Programmstruktur: Das Gesamtprogramm der untersuchten Regionalfernsehsender glie-
dert sich in verschiedene Typen von Sendungen. Eine Sendung kann grundsätzlich den
Kategorien Information, Service oder Unterhaltung zugeordnet werden. Elemente zur
Programmüberbrückung – dazu gehören Abtrennungen zwischen Sendungen und Wer-
bung, Trailer, Programm- und Sendungsvorschauen oder andere Füllelemente, wie z. B.
Bilder aus dem Archiv oder von einer Webcam – und verkaufte Sendezeit (Werbung oder
Sponsoring) strukturieren das Gesamtprogramm eines Senders weiter. Ein Sendungstyp
kann nach Sendungsart differenziert werden: Zur Kategorie Information gehören bei-
spielsweise Nachrichten-, Magazin- oder Talksendungen, in der Kategorie Service kann
unter anderem zwischen Wetter-, Börsen- oder Kochsendungen unterschieden werden.
Der Anteil an Information ist ein wichtiger Indikator dafür, wie der Programmauftrag
umgesetzt wird und wo die inhaltlichen Schwerpunkte eines Programms liegen. In der
vorliegenden Untersuchung wird Information ausschliesslich quantitativ erhoben. Das
heisst: Es kann für jeden Sender festgestellt werden, wie lange er pro Stichtag über regio-
nale Themen z. B. aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder Sport
berichtet.
> Beitragsart und journalistische Form: Diese beiden Variablen sind in erster Linie Indikato-
ren für Formenvielfalt, können aber auch zur Beschreibung der Professionalität herange-
zogen werden. So ist eine Reportage aufwändiger als ein Nachrichtenbeitrag und setzt
auch höher entwickelte journalistische Kompetenzen voraus. Aussagen zur
16Professionalität der Programme stehen allerdings nicht im Zentrum der vorliegenden Un-
tersuchung, weshalb auf diesen Aspekt hier nicht weiter eingegangen wird.
> Thema: Thematische Vielfalt ist ein zentraler Bestandteil des Leistungsauftrags. Idealty-
pisch wäre ein ausgewogenes Verhältnis der Themenbereiche Politik, Wirtschaft, Kultur
und Gesellschaft. Allerdings sind nicht alle Publika für alle Themen gleichermassen emp-
fänglich. Thematische Schwerpunktsetzungen sind daher aus programmstrategischen
Überlegungen sinnvoll oder sogar unerlässlich. Aus einer gesamtgesellschaftlichen Per-
spektive ist es aber wünschenswert, dass das Rundfunksystem insgesamt eine möglichst
breite thematische Vielfalt anbietet. Für die untersuchten Regionalfernsehsender sind
konzessionsrechtlich in erster Linie die Themen im Versorgungsgebiet von Bedeutung, die
relevant und vielfältig sein sollen. Über die Verteilung und Häufigkeiten der Themen
kann auf die inhaltliche Relevanz der Programminhalte geschlossen werden. Diese Infer-
enz wird aber der Auftraggeberin überlassen.
> Akteure und Quellen: Akteure – die Personen oder Institutionen, über die berichtet wird,
sind zusammen mit den Quellen ein wichtiger Indikator für Vielfalt und Ausgewogenheit
der Berichterstattung. Mit der Quelle wird der Urheber der Information bezeichnet: Eine
Behörde, eine Politikerin, ein Unternehmen, aber auch ein öffentliches Ereignis, wie z. B.
eine Sportveranstaltung, kann die Quelle der Berichterstattung sein. Quellen üben in der
Regel einen erheblichen Einfluss auf die Berichterstattung aus, oder versuchen teilweise
diese sogar in ihrem Sinn zu beeinflussen. Für eine vielfältige und ausgewogene Informa-
tionsleistung ist die Berücksichtigung von möglichst vielen, unterschiedlichen Quellen und
Akteuren essenziell.
> Ereignisort: Der Ereignisort ist ein harter Indikator für die Repräsentanz einzelner Regio-
nen und Orte in der Berichterstattung, weil er den Ort des Geschehens zum Ausdruck
bringt. Da die untersuchten Regionalfernsehsender zur Erbringung eines Service public
auf lokaler und regionaler Ebene verpflichtet werden, werden Ereignisse, die im Konzessi-
onsgebiet stattfinden, von anderen Ereignissen – nationalen Ereignissen in Bundesbern,
Ereignissen in anderen Regionen der Schweiz und Ereignissen im Ausland – unterschie-
den. Je grösser der Anteil der Ereignisse im Versorgungsgebiet, desto grösser ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das Programm auch vom Publikum als regionales Programm
wahrgenommen wird. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Verteilung
der Ereignishäufigkeit keiner Normalverteilung folgt, sondern abhängig ist von der Bevöl-
kerungsgrösse und der Dichte politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Institutio-
nen. Die Konzession verlang die Berücksichtigung des gesamten Versorgungsgebiets.
> Mit dem Regionalbezug wird ein zweiter, weicherer Indikator für die geografische Di-
mension der Information verwendet. Ein Regionalbezug kann bereits durch die beiläufige
Erwähnung einer Region entstehen, beispielsweise wenn über einen nordkoreanischen
Staatschef mit einer teilweise im Kanton Bern absolvierten Schulbildung oder einen Basel-
bieter Tennisspieler berichtet wird.
17> Orientierungsleistung: In erster Linie ist damit der Beitrag zur Einordnung der ausge-
strahlten Inhalte gemeint. In diesem Sinn steht Orientierungsleistung für Professionalität
und unter Umständen auch für Vielfalt. Wenn dem Publikum zu einem Sachverhalt ver-
schiedene Positionen und Perspektiven präsentiert werden, wird die Meinungsbildung er-
leichtert. Nicht jedes Thema ist jedoch per se kontrovers, weshalb Informationsinhalte
auch ohne andere Perspektiven und Meinungen ausgestrahlt werden können.
> Sprache: Die von einem Sender verwendete Sprache ist ein wichtiges identitätsstiftendes
Merkmal. Mittels Sprache wird Publikumsnähe hergestellt. Die Analyse kann zeigen, in
welchem Ausmass in den Sendungen der untersuchen Fernsehprogramme der Deutsch-
schweiz Dialekt dominiert und wie oft Hochdeutsch als Ausnahme und zur Hervorhebung
besonders bedeutender Passagen eingesetzt wird. Für die französische und italienische
Schweiz lässt sich ebenfalls feststellen, ob Dialekte über einige wenige Sendungen hinaus,
die sich dem Erhalt lokaler Bräuche und Kulturen verschrieben haben, überhaupt eine
Rolle spielen.
2.6. Reliabilität der Codierentscheidungen
Die Reliabilität der Codierungen wird einerseits durch die im Anhang C beschriebenen Prozesse
der Qualitätssicherung sichergestellt. Dabei erfolgen mehrere Prüf- und Korrekturdurchgänge der
vorgenommenen Codierungen. Andererseits wird ein Reliabilitätstest durchgeführt.
Für den Reliabilitätstest bekamen die Codierer eine ihnen unbekannte Fernsehaufnahme, die sie
selbstständig zu codieren hatten. In einem ersten Schritt wurden die Beitragstypen codiert. In ei-
nem zweiten Schritt mussten die Codierer die restlichen inhaltlichen Variablen codieren. Die Er-
gebnisse des Reliabilitätstests sind in den Tabellen 2 und 3 dokumentiert. Die aufgeführten Relia-
bilitätskoeffizienten stellen Minimalwerte vor den angesprochenen Kontrollen und systematischen
Prozessen der Qualitätssicherung dar. Für die definitiv ausgewerteten Erhebungsdimensionen
liegt die Reliabilität noch höher.
Tabelle 2: Reliabilitätskoeffizenten – Beitragstypen (Basis: 60 Minuten Fernsehaufnahmen, drei Codierer)
Untersuchungs- Vollständige Mehrheitliche Durchschnittliche
Testdimension Anzahl Variablen
einheiten Übereinstimmung Übereinstimmung Übereinstimmung
Beitragstypen 1 161 90% 99% 96%
Publicom 2019
Tabelle 3: Reliabilitätskoeffizenten – Inhaltsvariablen (Basis: 60 Minuten Fernsehaufnahmen, drei Codierer)
Untersuchungs- Vollständige Mehrheitliche Durchschnittliche
Testdimension Anzahl Variablen
einheiten Übereinstimmung Übereinstimmung Übereinstimmung
Inhalt 7 161 78% 98% 92%
Publicom 2019
182.7. Abschliessende Bemerkungen zur methodischen Umsetzung
Dass die Operationalisierung der konzessionsrechtlichen Leistungsanforderungen mit wissen-
schaftlichen Methoden nur bedingt möglich ist, wurde in den umfassenden Vorstudien aufge-
zeigt. Die systematische Programmanalyse liefert somit lediglich das empirische Datenmaterial
und mögliche Interpretationsansätze, stellt jedoch nicht eine abschliessende Bewertung der er-
brachten Programmleistungen dar. Eine solche ist letztlich Sache der Regulierungsbehörden und
setzt auch den Einbezug weiterer Daten, insbesondere aus Publikumsbefragungen, voraus.
Die wichtigsten Ergebnisse werden im vorliegenden Untersuchungsbericht nach Programmen pro
Sprachregion (deutsche Schweiz; französische und italienische Schweiz) in Form von Grafiken
und/oder Tabellen dargestellt. In den Übersichtsdarstellungen zu Beginn der empirischen Ergeb-
nisse werden die wichtigsten Befunde zusammengefasst. Im Detail sind die Ergebnisse im beilie-
genden Tabellenband dokumentiert. Eine Zusammenfassung der Befunde folgt in Kapitel 6.
193. Gesamtergebnisse der quantitativen Analysen 2018
3.1. Programmstruktur
Die Programme der untersuchten Regionalfernsehsender wurden in einem ersten Schritt hinsicht-
lich ihrer Struktur analysiert, bevor die einzelnen Sendungen, deren Beiträge und deren weiteren
Bestandteile detaillierter ausgewertet wurden (Anhang C). Einleitend lässt sich somit feststellen,
welche Typen von Sendungen im Programm der untersuchten Regionalfernsehsender wie viel
Zeit einnehmen. Der durchschnittliche Anteil an Informationssendungen lag bei den 14 unter-
suchten Programmen mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil bei 71 Prozent an den fünf ausge-
wählten Stichtagen im Erhebungsjahr 2018 (Abbildung 1). Das heisst: In Stunden und Minuten
hatten Sendungen mit informierendem Charakter mengenmässig den grössten Anteil am Pro-
gramm eines Schweizer Regionalfernsehsenders, während der definierten "Prime Time" (18.00
bis 23.00 Uhr), unter der Woche im Erhebungsjahr 2018. Im Vordergrund steht bei diesem Sen-
dungstyp die Vermittlung von Fakten und Meinungen zu verschiedenen gesellschaftlichen The-
menbereichen. Bei allen untersuchten Programmen machen Informationssendungen den jeweils
grössten Teil des Programms aus und nehmen zwischen 57 (Tele Südostschweiz) und 86 Prozent
(LémanBleu) der Sendezeit am Vorabend und Abend ein. Bei TeleZüri, der als Sender ohne Leis-
tungsauftrag und Abgabenanteil zum Vergleich in die Stichprobe mitaufgenommen wurde, lag
der Anteil an Informationssendungen mit 75 Prozent leicht über dem Durchschnittswert der 14
Programme mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil.
Abbildung 1: Sendungstypen
(Basis: alle Programminhalte, Anteil an Gesamtdauer in %)
Publicom 2019
20Weitere, quantitativ bedeutende Anteile der Programme sind Elemente zur Überbrückung dersel-
ben. Ihr Anteil macht bei den 14 untersuchten Regionalfernsehprogrammen mit Abgabenanteil
neun Prozent aus. Dazu gehören alle Bestandteile des Programms, die nicht als eigentliche Sen-
dungen erfasst, sondern in der Regel zwischen zwei Sendungen zur Strukturierung und Abtren-
nung eingesetzt werden. Beispiele für Elemente zur Programmüberbrückung sind Trailer, Vor-
schauen und weitere (werbliche) Mittel zur Promotion des eigenen Programms. Im Gegensatz
dazu wird in der Kategorie "Werbung/Sponsoring" der Programmanteil ausgewiesen, den ver-
kaufte Werbezeit an Dritte ausmacht. Diese Kategorie beinhaltet einerseits "klassische" Werbe-
spots, in denen beispielsweise ein Produkt und dessen Vorzüge in einem kurzen vorproduzierten
Filmbeitrag vorgestellt werden, andererseits die Nennung und Einblendung der Sponsoren be-
stimmter Sendungen. Der Durchschnitt an Werbung und Sponsoring der 14 Regionalfernsehpro-
gramme mit Leistungsauftrag und Abgabenanteil liegt mit 11% leicht unter dem Wert, den Wer-
bung im Programm von TeleZüri ausmacht (15%). TeleZüri weist dafür, verglichen mit den 14
übrigen Programmen (9%), einen geringeren Anteil an Elementen der Programmüberbrückung
auf (5%). Auffällig sind die Unterschiede für Werbung und Sponsoring zwischen den verschie-
denen Sprachregionen der Schweiz: Bei allen Programmen aus der französisch- und italienisch-
sprachigen Schweiz kann Werbung und Sponsoring Anteile von unter zehn Prozent der unter-
suchten Zeitdauer auf sich vereinen. Die Werte liegen zwischen vier (Canal 9) und neun Prozent
(TeleTicino). In der Deutschschweiz weist einzig Kanal 9, das deutschsprachige Programm von
Canal 9 für das Oberwallis, mit ebenfalls vier Prozent einen ähnlich tiefen Anteil von an Dritte
verkaufte Programmzeit auf. Bei den anderen Sendern der Deutschschweiz ist der Anteil von
Werbung und Sponsoring deutlich höher und beträgt zwischen 12 (TeleBärn) und 19 Prozent
(Tele Südostschweiz). Anders ausgedrückt: Wer an einem durchschnittlichen Wochentag
Deutschschweizer Regionalfernsehen schaut, konsumiert pro Stunde über dreieinhalb Minuten
mehr Werbung und Sponsoring, als auf den Programmen der französischen und italienischen
Schweiz in der gleichen Zeit.
Unterhaltungssendungen hingegen sind unter der Woche kaum Bestandteil des Hauptabendpro-
gramms der untersuchten Sender. Die einzigen Sender, bei denen nennenswerte Anteile für die-
sen Sendungstyp erhoben wurden, sind Canal 9 (5%) und TeleTicino (6%). Möglicherweise
würde Unterhaltung einen grösseren Anteil des Programms ausmachen, wenn das Wochenende
mit Sendungen am Samstag- und Sonntagabend bei der Erhebung mitberücksichtigt worden
wäre. Es lässt sich aber festhalten, dass im Gegensatz zu sprachregionalen Privatsendern (wie
z. B. 3+, 4+, 5+, 6+) keiner der untersuchten Regionalfernsehsender während der abendlichen
"Prime Time" auf vorproduzierte, fiktionale Inhalte, wie z. B. Spielfilme oder Serien, mit rein un-
terhaltendem Charakter setzt.
Weitere Unterschiede in der grundsätzlichen Ausgestaltung des Programms zeigen sich zwischen
den einzelnen Regionalfernsehprogrammen zum Beispiel auch beim Vergleich der Anteile von In-
formation und Service. Tele Südostschweiz und TeleTicino verzeichnen in ihrem Programm den
21tiefsten Anteil an Informationssendungen (57% resp. 59%), dafür nehmen dort Servicesendun-
gen mehr Platz ein (17% resp. 23%). Bis auf Kanal 9 (14%) spielen Servicesendungen, die den
Fokus auf Dienstleistungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer legen, bezogen auf ihren An-
teil an der Gesamtdauer der untersuchten Programme, eine eher untergeordnete Rolle. Zwar gibt
es bei allen Sendern Servicesendungen, beispielsweise zum Wetter oder zu den aktuellsten Ent-
wicklungen an den Finanzmärkten ("Börsen-News") – rein anteilsmässig, auf die Dauer des Ge-
samtprogramms bezogen, machen diese normalerweise eher kürzeren Sendungen aber einen re-
lativ geringen Anteil aus.
Zu den Sendern mit den grössten Anteilen an Informationssendungen an ihrem ausgestrahlten
Programm zählen Léman Bleu (86%) und Canal 9 (81%), sowie TeleBärn, Tele Top und TVO (je-
weils 79%). Auch zwischen Canal 9 und Kanal 9, die unter der gleichen Konzession ein Pro-
gramm für den französisch- respektive deutschsprachigen Teil des Versorgungsgebiets (beste-
hend aus dem Kanton Wallis und dem Bezirk Aigle im Kanton Waadt) veranstalten, unterscheidet
sich die Dauer, die Informationssendungen einnehmen, deutlich (Canal 9: 81%, Kanal 9: 63%).
Bei Kanal 9 fällt zudem der vergleichsweise hohe Anteil an Elementen zur Programmüberbrü-
ckung auf (17%). Dabei handelt es sich unter anderem um historische Archivaufnahmen, die zwi-
schen Programmblöcken als Füllelemente eingesetzt werden und jeweils mehrere Minuten dau-
ern.
In der Kategorie "Informationssendung" wurden verschiedene Arten von Sendungen mit jeweils
unterschiedlichen Charakteristika subsumiert, weshalb diese Kategorie detaillierter ausgewertet
wurde (Abbildung 2). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass "klassische" Nachrichtensen-
dungen ungefähr die Hälfte aller Informationssendungen ausmachen. Bei vielen Regionalfernseh-
sender beginnt die Hauptsendezeit mit einer Nachrichtensendung, wie z. B. "le journal", "Tages-
info" oder "Top News".
22Abbildung 2: Sendungsarten – Information
(Basis: alle Informationssendungen, Anteil an Dauer in %)
Publicom 2019
Welchen zeitlichen Anteil am Gesamtprogramm die Nachrichtensendungen ausmachen, fällt je
nach Sender aber sehr unterschiedlich aus. Die Anteile reichen von 19 (Léman Bleu) bis 70 Pro-
zent (Canal Alpha). TeleZüri hat im Vergleich zu den 14 Regionalfernsehprogrammen mit Kon-
zession und Abgabenanteil einen etwas geringeren Anteil an Nachrichtensendungen, dafür spie-
len hier Talkformate mit einem Anteil von 49 Prozent eine grössere Rolle (z. B. "TalkTäglich").
Auch bei TeleBärn (39%) und Tele M1 (47%) lassen sich überdurchschnittliche Anteile von
Talkformaten feststellen (Durchschnitt der 14 Regionalfernsehprogramme: 27%). Alle drei Sender
gehören CH Media, dem im letzten Jahr gegründeten Joint Venture der AZ Medien und den Re-
gionalmedien der NZZ-Gruppe. Es ist anzunehmen, dass die Zugehörigkeit zum gleichen Unter-
nehmen den Austausch von Sendungen fazilitiert. Die Sendung "TalkTäglich" wird beispielsweise
von Montag bis Mittwoch auch auf TeleBärn und Tele M1 ausgestrahlt, auf TeleZüri läuft die
Sendung an jedem Wochentag. Aber auch bei anderen Regionalfernsehsendern wie Tele Top
(50%), Léman Bleu (37%) oder TeleTicino (36%) können Talk-Formate einen beachtlichen Anteil
des Totals an Informationssendungen auf sich vereinen. Am wenigsten "getalkt" wird bei Canal
Alpha (5%) und TVO (9%).
Gerade bei TVO (43%), aber auch bei Telebasel (29%) oder Canal 9 (18%) sind Magazinsen-
dungen häufiger. In einem Magazin steht in der Regel die Vermittlung von Hintergrundinformati-
onen im Vordergrund, was sich in der Umsetzung oft als Sendung mit mehreren Beiträgen zu un-
terschiedlichen Themen präsentiert. Die vermittelte Tiefe an Informationen geht über das Niveau
von Nachrichtensendungen hinaus.
23Im Gegensatz zu einem Magazin ist eine Reportage oder Dokumentation monothematisch. Und
hier zeigen sich Unterschiede zwischen den Sendern, die sich fast entlang der Sprachgrenzen zwi-
schen der deutschsprachigen und der lateinischen Schweiz festmachen lassen. Bis auf wenige
Ausnahmen (Kanal 9 und TVO) kommt diese Sendungsart nämlich in der Deutschschweiz eher
selten vor. Anders in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz: Bei La Télé, Canal Alpha,
TeleTicino und Léman Bleu machen Reportagen und Dokumentationen einen Anteil zwischen ei-
nem Zehntel und einem Fünftel an allen Informationssendungen aus.
Bis jetzt konnte festgestellt werden, dass die untersuchten Regionalfernsehveranstalter in der
Hauptsendezeit einen Grossteil ihres Programms mit Informationssendungen bestreiten. Damit ist
aber noch nichts darüber ausgesagt, in welchem Umfang es sich bei den ausgestrahlten Sendun-
gen um originäre Leistungen, oder um Wiederholungen von bereits zu einem früheren Zeitpunkt
ausgestrahlten Inhalten handelt. Abbildung 3 stellt für jedes der 15 untersuchten Regionalfern-
sehprogramme die Anteile an originären Inhalten und Wiederholungen dar.
Abbildung 3: Wiederholungen
(Basis: alle Programminhalte, Anteil an Gesamtdauer in %)
Publicom 2019
Durchschnittlich sind 38 Prozent des untersuchten Programms bei den 14 Regionalfernsehsen-
dern mit Leistungsauftrag grundlegend neue Inhalte. Die deutliche Mehrheit des Programms in
den untersuchten Zeiträumen, das heisst jeweils werktags zwischen 18.00 und 23.00 Uhr, be-
steht folglich aus Wiederholungen. Heruntergebrochen auf einen Wochentag bedeutet das, dass
ein durchschnittlicher Regionalfernsehsender in der Hauptsendezeit am Abend unter der Woche
knapp 2 Stunden an neuen Inhalten ausstrahlt. Als typisches Programmschema lässt sich eine
24Sie können auch lesen