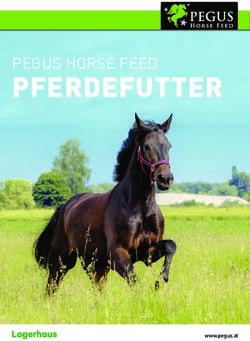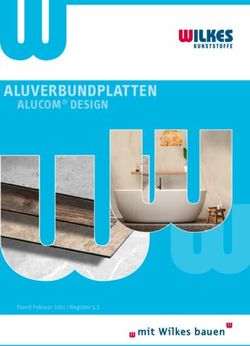Rechtliche Aspekte Dekubitusprophylaxe - Andreas Wessendorf Lehrer für Pflegeberufe
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Dekubitusprophylaxe - Einstieg
• Bei Patienten mit Risiko für das Entstehen eines
Dekubitus sind besondere pflegerische und medizinische
Maßnahmen erforderlich. Grundlegende Dinge sollten
dabei unbedingt, auch aus haftungsrechtlicher Sicht,
beachtet werden.
Seite 2
Ihre E-Mail-AdresseDekubitusprophylaxe
Nicht zwangsläufig ist das Entstehen eines Dekubitus Folge
von Fehlverhalten auf Seiten des jeweiligen Behandlers. Von
Relevanz ist hierbei grundsätzlich die Frage, inwieweit das
Dekubitalgeschwür in den sogenannten vollbeherrschbaren
Herrschafts- und Organisationsbereich einzuordnen ist.
Video von Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Großkopf
Seite 3
Ihre E-Mail-AdresseFallbeispiel - Klage wegen fehlerhafter
Dekubitusprophylaxe bei einem Hochrisikopatienten
• Der Patient wurde nicht als Hochrisikopatient für das Erlei-
den eines Dekubitus eingeordnet. Entsprechende
Behandlungsmaßnahmen wurden daher nicht vorgenom-
men.
• Die Dokumentation war lückenhaft, sodass einzelne
Behandlungsmaßnahmen nicht voll umfänglich nachvoll-
zogen werden konnten.
Seite 4
Ihre E-Mail-AdressePDF
Seite 5
Ihre E-Mail-AdresseAuszug aus der Berufsordnung
Seite 6
Ihre E-Mail-AdresseModelle zur Problemlösung
Vorbehaltene Tätigkeiten Pflegeberufegesetz §4 Abs. 2
Erhebung u. Feststellung des Organisation, Gestaltung u. Steuerung des Analyse, Evaluation, Sicherung u.
individuellen Pflegebedarfs Pflegeprozesses Entwicklung der Qualität der Pflege
Pflegeprozess Erfahrungen als
Grundlage zur
Informations Erkennen von Festlegung der Planung der Durch- Beurteilung der Planung v.
-sammlung Problemen und Pflegeziele Pflege- führung Pflegewirkung zukünftigen
Ressourcen maßnahmen Prozessen
Festlegung realistischer
Ziele, Auswahl von
Durchführung nach aktuellen
Pflegeanamnese, z.B. geeigneten
wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Einschätzung des Pflegemaßnahmen,
Beachtung geltender Standards,
Dekubitusrisikos Analyse potentieller
Dokumentation und Evaluation
Probleme durch die
ausgewählten MaßnahmenAuszug aus der Berufsordnung
Seite 8
Ihre E-Mail-AdresseAuszug aus der Berufsordnung
Seite 9
Ihre E-Mail-AdresseVerantwortlichkeiten
Gesamtverantwortung
Arzt
Anordnungsverantwortung
Arzt
Organisationsverantwortung
Durchführungsverantwortung
Durchführender
Remonstrationspflicht
Dokumentation Haftung
Seite 10Organisationsverantwortung
Sie liegt bei der Einrichtung und
somit bei der pflegerischen Leitung:
• Bereitstellung der notwendigen
Kräfte (Qualifizierung, Quantität)
• Vorhalten entsprechender
Standards
Seite 11Remonstrationspflicht
1. Überprüfung von Anweisungen auf Rechtmäßigkeit
2. Überprüfung von Anweisungen auf Richtigkeit
3. Rechtswidrige oder fehlerhafte Anweisungen sind unverzüglich
beim unmittelbaren Vorgesetzten zu remonstrieren.
Remonstrationspflicht = Pflicht zur Weigerung, solche Aufgaben zu
übernehmen, von denen der Durchführende überzeugt ist,
• dass sie dem Patienten schaden oder
• dass er diese nicht beherrscht.
4. Dokumentation eines solchen Sachverhalts
Seite 12Haftungsrecht
Haftung bedeutet, dass jemand für die Fehler und Folgen seines
Handelns einstehen muss.
Dabei können sich aus einem fehlerhaften Handeln sowohl
zivilrechtliche als auch strafrechtliche Konsequenzen ergeben.
Seite 13Haftung aus Vertrag
• Grundlage ist ein Vertrag, z.B. zwischen Arztpraxis, MVZ oder
Krankenhaus und Patient, der alle Mitarbeitenden zur Erbringung
einer fachlich einwandfreien Leistung verpflichtet
• Bei fehlerhafter Leistung kann der Patient hier im Regelfall nur
Schadensersatz vom Träger erhalten, nicht jedoch von den
Mitarbeitenden.
Zur Haftung führen:
• Sorgfaltspflichtverletzungen (mittlere und grobe Fahrlässigkeit)
• Aufklärungsfehler
• fehlende/unzureichende Sicherheitsvorkehrungen
• erhebliche Nichteinhaltung von Terminen
Seite 14Beispiele von vertraglicher Haftung in der
Wundambulanz
• Gemeint ist der alltägliche „kleine Fehlerteufel“:
• mittlere und grob fahrlässige Sorgfaltspflichtverletzungen, z.B.
Vertausch von Patientenakten bei ähnlichen Namen (Markus
Schmitt und Martin Schmitt) mit Folgen für einen oder beide
Patienten
• unbeabsichtigte, fahrlässige Schweigepflichtverletzungen
• fahrlässige Aufklärungsfehler
• fehlende/unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, z.B. beim
Einsatz von Medizinprodukten, unbeabsichtigte Kontamination von
Wunden bei fehlendem Mundschutz etc.
• erhebliche Nichteinhaltung von Terminen
Seite 15Haftung aus Delikt (unerlaubte Handlung)
• bei Verletzung von Gesundheit, Leben oder Freiheit des Patienten
durch schuldhaften Behandlungsfehler oder eigenmächtige
Heilbehandlung
• Verschulden bei Vorsatz und je nach Grad der Fahrlässigkeit
• Schadenersatz und Schmerzensgeld
Seite 16Beispiele von deliktischer Haftung in der
Wundambulanz
• Abrechnung von Leistungen, die im Rahmen der erforderlichen
Diagnostik und Therapie aber tatsächlich nicht erbracht wurden
• Körperverletzung durch fehlerhafte Behandlung
• Schweigepflichtverletzungen, z.B. bei Weitergabe von Daten ohne
Einwilligung des Betroffenen
• Verletzung der Garantenpflicht
Seite 17Relevante Haftungsbereiche im Rahmen der Wundversorgung
Zivilrechtliche Arbeitsrechtliche Strafrechtliche
Haftung: Haftung: Haftung:
Vertragliche Haftung: Vertragsrechtlich Geld- oder
Schadens- eingeschränkte Freiheitsstrafe
ersatzpflicht Haftung des
Arbeitnehmers
(abhängig vom
Verschuldungsgrad),
Deliktische Haftung: strafrechtlich volle
Schadens- Haftung
ersatzpflicht
Seite 18
Ihre E-Mail-AdresseArbeitnehmerhaftung
Bei der Haftung für Schäden, die der Arbeitnehmer in Ausführung
betrieblicher Verrichtungen nicht vorsätzlich dem Arbeitgeber zugefügt
hat, ist ein innerbetrieblicher Schadensausgleich durchzuführen.
Eine Beschränkung gilt nicht nur bei gefahrgeneigter Arbeit, sondern
für alle Arbeiten, die durch den Betrieb veranlasst sind und aufgrund
eines Arbeitsverhältnisses geleistet werden.
Der Umfang der Haftungseinschränkung bestimmt sich nach der
Abwägung der Gesamtumstände im Einzelfall nach dem Grad der
Fahrlässigkeit:
• leichte (einfache) Fahrlässigkeit: keine Haftung des Arbeitnehmers
• normale (mittlere) Fahrlässigkeit: Quotelung
• grobe Fahrlässigkeit: volle Haftung des Arbeitnehmers
Seite 19Arbeitnehmerhaftung bei leichter Fahrlässigkeit
• unerhebliches, vernachlässigendes Verschulden
• eine vergleichsweise harmlose, nur wenige Augenblicke währende
Unaufmerksamkeit in einer an sich alltäglichen Situation
• Beispiele:
• die Infusionsflasche, die dem Arbeitnehmer aus Versehen dem
Arbeitnehmer aus der Hand fällt
• das versehentliche Anrempeln während der Arbeit
Bei einer Arbeitnehmer-Pflichtverletzung im Arbeitsleben kann unter
Berücksichtigung aller Einzelumstände bei völlig geringfügigen und
leicht entschuldbaren Pflichtwidrigkeiten – die jedem Arbeitnehmer im
Laufe der Zeit passieren können – eine Arbeitnehmerhaftung
ausgeschlossen sein.
Seite 20Arbeitnehmerhaftung bei mittlerer Fahrlässigkeit
• Fälle, in denen der Arbeitnehmer einen Schaden hätte voraussehen
müssen, aber nicht daran gedacht hat
• vollständige Haftungsfreistellung abgelehnt, die Aufteilung richtet sich
nach Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkten (Teilung der
Haftung, Quotelung), z.B.
• Gefahrgeneigtheit der Arbeit und Schadenshöhe
• vom Arbeitgeber einkalkuliertes und durch Versicherung
abgedecktes Risiko
• Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und Höhe seines
Arbeitsentgelts sowie
• unter Umständen auch die persönlichen Verhältnisse des
Arbeitnehmers wie Dauer seiner Betriebszugehörigkeit,
Lebensalter, Familienverhältnisse und bisheriges Verhalten
• bei der Bildung der individuellen Haftungsquote sind die Gerichte frei,
meist wird die Haftung des AN auf ein Monatsgehalt begrenzt
Seite 21Arbeitnehmerhaftung bei grober Fahrlässigkeit
• Außerachtlassen der erforderlichen Sorgfaltspflicht, gemessen
nach den gesamten Umständen und in ungewöhnlich hohem Maße
• dabei ist zu berücksichtigen, was der Schädigende nach seinen
individuellen Fähigkeiten erkennen und erbringen konnte
• der Arbeitnehmer haftet in aller Regel für den gesamten Schaden
• Beispiel:
Eine Ärztin hat auf Grund haarsträubender Fehler einer
Patientin bei einer Operation unkompatibles Spenderblut
zugeführt. Die Patientin ist deshalb verstorben. Das BAG hat
wegen der akuten Lebensgefährdung und der schlechterdings
nicht hinnehmbaren Häufung von Fehlern und Unterlassungen
das Verschulden als „gröbst“ fahrlässig eingestuft.
Seite 22Arbeitnehmerhaftung im Kirchlichen Dienst (AVR)
Bei Mitarbeitern im kirchlichen Dienst mit Arbeitsverträgen nach den
AVR-Caritas ist die Haftung beschränkt auf Schäden, die durch grob
fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung der Dienstpflichten
entstanden sind (§ 5 Abs. 5 AVR-Caritas).
Seite 23Arbeitnehmerhaftung – Gut zu wissen!
Beweislast
Die Beweislastregel gemäß BGB wird bei der Arbeitnehmerhaftung zu
Gunsten des Arbeitnehmers modifiziert. Der Arbeitgeber muss
darlegen und beweisen, dass der Arbeitnehmer die Pflichtverletzung
zu vertreten, d. h. verschuldet hat. (Beweislastumkehr). Die
Nichterweislichkeit geht also zu Lasten des Arbeitgebers.
Ausbildungsverhältnis
Die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs gelten
auch im Ausbildungsverhältnis (BAG 8 AZR 348/01 vom 18. April
2002).
Seite 24MPG und MPBetreibV
• im Unterschied zu Arzneimitteln primär nicht pharmakologische,
metabolische oder immunologische, sondern physikalische Wirkung
• bei Anwendung von Medizinprodukten am Menschen
• Risikoklassen I, II a, II b, III (aktiv, nichtaktiv)
• Zulassungsvoraussetzungen CE – Kennzeichnung
• Hersteller, Betreiber, Anwender
• vorgeschriebene Medizinprodukteberater
• ausschließlich zweckbestimmter Einsatz
• Anwendung unter Beachtung anerkannter Technikregeln sowie
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
• Nutzung nur mit erforderlicher Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung
• vor Anwendung eines Medizinproduktes: Überprüfung der
Funktionsfähigkeit, des ordnungsgemäßen Zustandes und
Beachtung der Gebrauchsanweisung (Sicherheitsinformationen)
Seite 25
Ihre E-Mail-AdresseHaftung bei Verstößen gegen MPG und MPBetreibV?
Zum Beispiel bei:
• bei fehlerhafter Vorbereitung
• Einsatz trotz fehlender CE-Kennzeichnung
• fehlende Überprüfung bei Sterilgut
• fehlende oder unzureichende Überprüfung der
Funktionsfähigkeit eines Medizinproduktes vor Anwendung
• Missachtung der Sicherheitsinformationen
• bei Einsatz ohne vorgeschriebene Medizinprodukte-Einweisung
• bei eigenständiger Kombination von verschiedenen
Medizinprodukten (Zweckveränderung Anwender wird zum
Hersteller)
• Missachtung anerkannter Technikregeln, Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften bei Anwendung
Seite 26Fotodokumentation von Wunden
Mit den heute vorhandenen technischen Möglichkeiten durch
Digitalkameras nimmt die Wunddokumentation per Fotografie einen
immer größeren Stellenwert ein. Digitalkameras sind zur
Wunddokumentation rechtlich zulässig und aus 3 Gründen
empfehlenswert:
1. Die Bildqualität ist mittlerweile in der Regel sehr gut.
2. Der Aufbewahrungspflicht kann leichter nachgekommen werden
(30 Jahre bei medizinischen Unterlagen).
3. Es ist ein kostengünstiges Verfahren.
4. Eine Fotodokumentation ersetzt nicht die schriftliche
Dokumentation, sondern ergänzt sie. Fotos können die
Dreidimensionalität einer Wunde, mögliche Vertunnelungen und
Farben ggf. nur teilweise dargestellen. Um Probleme in der
Dokumentation des Wundverlaufs zu vermeiden, sollten Fotos
nach einem standardisierten Vorgehen gemacht werden.
Seite 27Fotodokumentation von Wunden
Datenschutz?
Diskutieren Sie!
Seite 28Sie können auch lesen