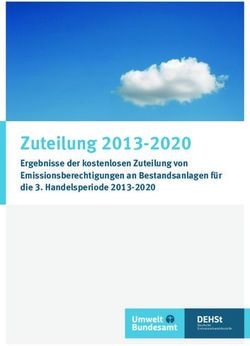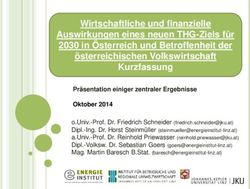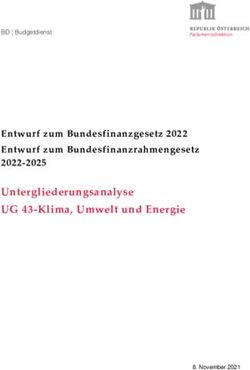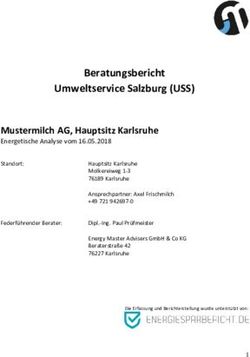REGION Energie- und Klimaschutz-konzept für die Region Bodensee-Oberschwaben - Bodensee - Oberschwaben
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
REGION Bodensee -
Oberschwaben
Energie- und Klimaschutz-
konzept für die Region
Bodensee-Oberschwaben
Umsetzung der Energiewende 2022
Bearbeitung durch
Regionalverband Bodensee-OberschwabenRegionalverband Bodensee-Oberschwaben Info Heft No. 12 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben Umsetzung der Energiewende 2022 Bearbeitung durch Energieagentur Ravensburg gGmbH Ravensburg Oktober 2012
Herausgeber: Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg
Tel.: (0751) 363 54 - 0 Fax: (0751) 363 54 - 54
E-Mail: info@bodensee-oberschwaben.de
Internet: www.bodensee-oberschwaben.de
Info: Energieagentur Ravensburg gGmbH
Zeppelinstraße 16, 88212 Ravensburg
Tel.: (0751) 764 707 - 0 Fax: (0751) 764 707 - 9
E-Mail: info@energieagentur-ravensburg.de
Internet: www.energieagentur-ravensburg.de
Verfasser: Nadine Wahl, Studierende an der Hochschule Biberach / Ulm
Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg gGmbH
Druck: Druckerei Harder GmbH, 88250 WeingartenRegionalverband Bodensee-Oberschwaben 5 Vorwort Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung von enormer Tragweite. Mit der Abschaltung aller deutschen Kernkraftwerke bis spätestens 2022 wurde das Ende des Atomzeitalters in Deutschland beschlossen. In Baden-Württemberg, das einen hohen Atomstromanteil von 52 % an der Bruttostromerzeugung im Jahr 2009 aufwies, sind besondere Anstrengungen beim Ausbau er- neuerbarer Energien erforderlich. Neben den Herausforderungen, die eine Abkehr vom fossilen Energiesystem mit sich bringt, bietet die Energiewende vor allem große Chancen. Eine nachhaltige Energieversorgung durch erneuerbare Energien erhöht die Unabhängigkeit von Öl- und Gasimporten und stärkt die Wirtschaft vor Ort durch neue Arbeitsplätze und Unternehmen. Durch die Verringerung von Treibhausgas- und Schad- stoffemissionen wird ein wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet. Die Bundesregierung hat als wesentliche Ziele der Energiewende einen Anstieg der regenerativen Stromversorgung auf mindestens 35 % und der regenerativen Wärmeversorgung auf 14 % spätes- tens bis zum Jahr 2020 rechtlich verankert. Für die Realisierung dieser Ziele bedarf es neben gesetz- lichen Regelungen insbesondere Konzepte und Maßnahmen auf regionaler und kommunaler Ebene. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat frühzeitig die Bedeutung des Themas erkannt und im Juni 2011 die Energieagentur Ravensburg mit der Erarbeitung des vorliegenden Energie- und Klimaschutzkonzepts 2022 mit den Schwerpunkten "Strom" und "Wärme" beauftragt. Im Rahmen der Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie hat der Regionalverband an zahl- reichen Informationsveranstaltungen in den Städten und Gemeinden der Region mitgewirkt. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass die Bürger immer auch wissen möchten, welche Alternativen es im Bereich der Wasserkraft, der Geothermie etc. gibt. Durch die vorliegende Studie wird nun regionsweit aufgezeigt, wo wir derzeit stehen und welche Potenziale in den verschiedenen Bereichen noch reali- sierbar sind. Daneben werden sachkundige Aussagen zu den Themen "Energieeffizienz", "Netze" und "Speicher" getroffen. Ein wichtiges Ergebnis der Studie vorweg: Die Energiewende in der Region Bodensee-Ober- schwaben bezogen auf die bundespolitische Zielsetzung ist machbar. Ausgehend vom Status Quo liegen die größten Potenziale bei der Stromversorgung bei der Einsparung sowie im Bereich Wind- energie und Photovoltaik und darüber hinaus im Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Eine Vorreiter- rolle hat der Landkreis Sigmaringen, der nicht nur den gesamten Stromverbrauch im Jahr 2022 aus regenerativen Energien abdecken, sondern darüber hinaus noch "Überschüsse" erzielen könnte. Auch im Landkreis Ravensburg und in der regionsweiten Betrachtung könnten die politischen Ziel- setzungen deutlich übertroffen werden. Unser Dank geht an dieser Stelle an die Energieagentur Ravensburg, die durch langjähriges Know- how und fundierter Kenntnis der regionalen Gegebenheiten für die Erstellung der Studie prädestiniert war. Die Nähe zu den Akteuren vor Ort, zu den Landkreisen und Kommunen, aber auch zu Gewer- be- und Industrieunternehmen zeigt sich insbesondere in den Handlungsempfehlungen am Ende der Studie, deren Umsetzung der entscheidende Faktor für das Gelingen der Energiewende sein wird. Hermann Vogler Wilfried Franke Verbandsvorsitzender Verbandsdirektor
6 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben Inhaltsverzeichnis Vorwort ................................................................................................................................................ 5 1 Einleitung .................................................................................................................................. 7 2 Politische Zielsetzung und gesetzliche Regelungen ................................................................. 8 3 Energiemanagement und Klimaschutz in der Region Bodensee-Oberschwaben ..................... 9 4 Grundlagen und Methodik der Datenerhebung und Potenzialermittlung ................................. 12 4.1 Status Quo des Energiebedarfs und der Energieversorgung ............................................... 12 4.2 Energieverbrauchsentwicklung und -einsparung.................................................................. 13 4.3 Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien und für die Energieeffizienz .................. 16 4.4 Potenziale für den Ausbau der fossilen Kraft-Wärme-Kopplung .......................................... 20 4.5 Treibhausgas-Emissionen ................................................................................................... 21 5 Status Quo der Energieversorgung und Emissionen .............................................................. 22 5.1 Landkreis Bodenseekreis ..................................................................................................... 22 5.2 Landkreis Ravensburg ......................................................................................................... 22 5.3 Landkreis Sigmaringen ........................................................................................................ 23 5.4 Region Bodensee-Oberschwaben ....................................................................................... 23 6 Potenziale für die Energieversorgung und den Klimaschutz ................................................... 27 6.1 Landkreis Bodenseekreis ..................................................................................................... 27 6.2 Landkreis Ravensburg ......................................................................................................... 30 6.3 Landkreis Sigmaringen ........................................................................................................ 32 6.4 Region Bodensee-Oberschwaben ....................................................................................... 34 7 Infrastrukturelle Rahmenbedingungen .................................................................................... 40 7.1 Strom-, Wärme- und Gasnetze ............................................................................................ 40 7.2 Speichertechnologien .......................................................................................................... 43 7.3 Flächenplanung ................................................................................................................... 45 8 Handlungsempfehlungen ........................................................................................................ 46 9 Zusammenfassung und Ausblick ............................................................................................ 47 Literatur und Quellen ......................................................................................................................... 49
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 7
1 Einleitung
Energiewende und Klimaschutz Zudem sind sowohl die Nutzung von Uran als
auch die von fossilen Energien durch ihre
Im Jahr 2010 wurde von der Deutschen Bun- Ressourcenverfügbarkeit stark beschränkt.
desregierung das „Energiekonzept 2050“ vor-
gelegt. Hierin wurde als Ziel formuliert, bis zum Dennoch, so zeigen auch die Erhebungen aus
Jahr 2020 35 % sowie bis zum Jahr 2050 80 % der Region, tragen Atomkraft und fossile Ener-
der Stromerzeugung aus regenerativen Quel- gien bisher mit dem größten Anteil zu unserer
len bereit zu stellen. Der im Jahr 2000 von der Energieversorgung bei.
damaligen Regierung beschlossene Atomaus-
stieg sollte aufgehoben und die Laufzeiten der Das soll sich ändern.
Atomkraftwerke im Schnitt um 12 Jahre ver-
längert werden.
Ein Jahr später, nach der Reaktorkatastrophe Ziel und Thematik dieser Studie
in Fukushima (Japan) Anfang 2011, beschloss
die Deutsche Bundesregierung dann, unter Das Ziel dieser Studie ist es, ein ganzheitli-
dem Begriff der Energiewende, am 6. Juni ches Konzept vorzulegen, mit dem sowohl das
2011 die sofortige Abschaltung der sieben äl- Klima geschützt, als auch die Energiewende in
testen Kernkraftwerke sowie des Kernkraft- der Region Bodensee-Oberschwaben erreicht
werkes Krümmel und die stufenweise Abschal- werden kann.
tung der weiteren neun Atomkraftwerke bis
2022. Hierfür wurden für die Bereiche Strom, Wärme
und Kraft-Wärme-Kopplung zunächst der Sta-
Atomkraftwerke gelten, lässt man den Trans- tus Quo ermittelt (Kapitel 5) und darauf auf-
port der Brennstäbe unberücksichtigt, als prak- bauend die Potenziale für das Jahr 2022 er-
tisch treibhausgasfrei. Doch sowohl der Uran- rechnet (Kapitel 6).
abbau und –transport, als auch die Stromer-
zeugung selbst und besonders die Verwah- Aus diesen Erkenntnissen heraus wurden im
rung des bei der Reaktion entstehenden radio- Folgenden konkrete Handlungsempfehlungen
aktiven Abfalls, bergen immense Gefahren. formuliert (Kapitel 8), die zur möglichst ra-
schen und gezielten Umsetzung der Ziele füh-
Bei der Verbrennung von fossilen Energieträ- ren sollen.
gern wiederum entstehen Treibhausgase, da-
runter insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2), Der Bereich Verkehr / Mobilität wurde im
welche den Treibhauseffekt verstärken und Rahmen dieser Studie nicht betrachtet. Der
damit das Klima der Erde beeinflussen. Bereich Kälte wurde als Teilaspekt behandelt.8 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
2 Politische Zielsetzung und gesetzliche Regelungen
Sowohl die deutsche Bundesregierung, als Steigerung des Windenergieanteils auf
auch die baden-württembergische Landesre- 10 % der Bruttostromerzeugung
gierung, haben Energiekonzepte zur Gestal- Energieeffizienzsteigerungen, Nutzung
tung der zukünftigen Energieversorgung und von Abwärmepotenzialen, Ausbau der
zum Schutz des Klimas herausgebracht. Zu- Kraft-Wärme-Kopplung
dem wurden Gesetze erlassen, die der Ener- Vorbildfunktion von Kommunen, z. B.
giewende und dem Klimaschutz dienen sollen. klimaneutrale Verwaltung
Und auch auf internationaler Ebene gibt es
energie- und klimaschutzbetreffende Abkom-
men. Längerfristige Ziele - Energiekonzept 2050 der
Bundesregierung:
Reduzierung des Energieverbrauchs
Politische Zielsetzungen: um 50 % gegenüber 2008
Erhöhung der regenerativen Stromer-
Ziele der Bundesregierung bis 2020: zeugung auf 80 %
Reduzierung der CO2-Emissionen um
Reduzierung des Primärenergiever- 80 bis 95 % gegenüber 1990
brauchs um 20 % gegenüber 2008
Reduzierung des Stromverbrauchs um
10 % gegenüber 2008 Kyoto-Protokoll:
Erhöhung der regenerativen Stromer-
zeugung von 17 auf 35 % Reduzierung der Treibhausgas-
Erhöhung der regenerativen Wärmeer- Emissionen um 21 % gegenüber 1990
zeugung von 6 auf 14 % (bis 2012 – wurde erreicht)
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung von weitere Reduktionsziele sollen Ende
12 auf 25 % 2012 auf der UN-Klimakonferenz in Ka-
Reduzierung der CO2-Emissionen um tar festgelegt werden
40 % gegenüber 1990
Steigerung der Biogaseinspeisung ins
Erdgasnetz von 1 auf 6 %
Verdoppelung der Energieproduktivität Relevante gesetzliche Regelungen:
gegenüber 1990
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz
Energiewende 2022 (Bundesregierung): (KWKG)
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
schrittweise Abschaltung aller Kern- Erneuerbare Energien Wärme Gesetz
kraftanlagen bis 2022 (EEWärmeG)
Erneuerbare Wärme Gesetz (EWär-
meG)
Klimaschutzkonzept 2020plus, Baden- Energieeinspargesetz und -verordnung
Württemberg: (EnEG und EnEV)
Gesetz zur Beschleunigung des
Reduzierung der CO2-Emissionen um Stromnetzausbaus
30 % gegenüber 1990 Verordnung zu Strom- und Gaszählern
HeizkostenverordnungRegionalverband Bodensee-Oberschwaben 9
3 Energiemanagement und Klimaschutz in der Region Bodensee-
Oberschwaben
Die Region Bodensee-Oberschwaben ist eine Im Folgenden wird dargestellt, welche An-
von zwölf Raumordnungs- und Planungsregio- strengungen in der Region Bodensee-
nen in Baden-Württemberg. Sie setzt sich aus Oberschwaben bereits unternommen werden,
den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg um zur Erreichung eines sinnvollen Energiemi-
und Sigmaringen zusammen und umfasst der- xes und zum bestmöglichen Schutz des welt-
zeit mehr als 617.000 Einwohner. weiten Klimas beizutragen.
Übersicht über ausgewählte kommunale Energie- und Klimaschutzaktivitäten in der Region:
European Energy Energie- und Klima- Bioenergiedörfer
Award schutzkonzepte
Landkreis 6 Teilnehmer 1 Konzept 1 Bioenergiedorf
Bodenseekreis
1 Auszeichnung
Landkreis 20 Teilnehmer 1 Konzept
Ravensburg
10 Auszeichnungen
Landkreis 5 Teilnehmer 4 Bioenergiedörfer
Sigmaringen
1 Auszeichnung
Region 31 Teilnehmer 2 Konzepte 5 Bioenergiedörfer
Bodensee-
Oberschwaben 12 Auszeichnungen
Im September 2012 haben die Städte Ravens- unterzeichnet. Darin enthalten sind feste Ziele
burg und Weingarten sowie die Gemeinden für CO2-Einsparung und regenerative Strom-
Baienfurt, Baindt und Berg eine gemeinsame und Wärmeerzeugung bis zum Jahr 2020, die
Erklärung für ein „CO2-neutrales Schussental“ die Bundes- und Landesziele nochmals über-
treffen.10 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben Der European Energy Award ist ein Quali- bereits Erreichten. Besonders wirkungsvoll bei tätsmanagementsystem und Zertifizierungsver- der Teilnahme am European Energy Award fahren, mit dem Energie- und Klimaschutzakti- sind seine breite Themenabdeckung und die vitäten von Kommunen und Landkreisen er- Öffentlichkeitswirkung für die Bürger der teil- fasst, bewertet, geplant, gesteuert und regel- nehmenden Gemeinden. mäßig überprüft werden. Die Auszeichnung der Städte, Gemeinden und Landkreise mit Die folgende Übersicht zeigt die Teilnehmer dem European Energy Award (50 % Umset- am European Energy Award in Baden- zung) oder European Energy Award Gold Württemberg. (75 %) dient der besonderen Anerkennung des Die Grafik stammt aus dem Juli 2012. Inzwischen haben sowohl die Stadt Friedrichshafen als auch Landkreis und Stadt Ravensburg den European Energy Award in Gold beantragt. Ein Bioenergiedorf ist eine Gemeinde, die ei- Energieversorgung stellt häufig eine Biogasan- nen großen Teil ihres Strom- und Wärmebe- lage oder ein Biomasseheizkraftwerk, die so- darfs aus überwiegend regional bereitgestellter wohl Strom als auch Wärme bereit stellen. Biomasse selbst deckt. Es gibt keine klaren Auch weitere regenerative Energien, wie Pho- Vorgaben, aber gängig ist die Definition, dass tovoltaik, Solarthermie und andere, können mindestens so viel Strom erzeugt, wie von der zum Einsatz kommen. Bioenergiedörfer in der Gemeinde benötigt wird, mindestens die Hälfte Region sind Lippertsreute (Lkr. Bodensee- der Wärme bereitgestellt wird (möglichst durch kreis) sowie Leibertingen, Meßkirch, Lauten- Kraft-Wärme-Kopplung) und dass mehr als die bach und Lampertsweiler (Lkr. Sigmaringen). Hälfte der Anlagen in Besitz von Wärmeab- nehmern und Landwirten ist. Die Basis der
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 11 Energie- und Klimaschutzkonzepte bieten grundlage für die Umsetzung von Effizienz- eine gute Grundlage für die Einführung eines und Klimaschutzprojekten. So kann ein sol- Energie- und Klimaschutzmanagementsys- ches Konzept als Leitfaden für eine langfristig tems und für die Umsetzung von Energie- und angelegte Energiepolitik dienen. Kommunale Klimaschutzprojekten. Ein solches Konzept be- Energie- und Klimaschutzkonzepte wurden be- inhaltet mehrere Teilschritte eines Energie- reits für die Stadt Friedrichshafen (Lkr. Boden- und Klimaschutzmanagements von der Analy- seekreis) und die Gemeinde Amtzell (Lkr. Ra- se über das Formulieren von Zielen bis hin zu vensburg) angefertigt. einem Maßnahmenkatalog als Entscheidungs-
12 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
4 Grundlagen und Methodik der Datenerhebung und Potenzialermittlung
4.1 Status Quo des Energiebedarfs und der Energieversorgung
Zur Ermittlung des Strombedarfs in den Erhebung der Energieagentur wurde der Anteil
Landkreisen der Region Bodensee- der Kachelöfen ermittelt.
Oberschwaben wurden zum einen Angaben
des Energieversorgers EnBW (Lkr. Bodensee- Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wer-
kreis, Lkr. Sigmaringen), zum anderen Anga- den sowohl elektrischer Strom als auch Wär-
ben der Kreisgemeinden (Lkr. Ravensburg) me in einem sogenannten Blockheizkraftwerk
herangezogen, jeweils aus dem Jahr 2010. In (BHKW) erzeugt. Der Anteil der fossilen Kraft-
beiden Fällen sind die Summen nicht vollstän- Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung im
dig, da die EnBW nicht alle Verbraucher er- Jahr 2010 wurde den Angaben der EnBW ent-
fasst und die Gemeinden wiederum jene Ver- nommen. Der Wert für die Wärmeerzeugung
bräuche nicht erfassen, für die keine Konzes- wurde aus diesen Daten errechnet. Dabei
sionsabgabe1 gezahlt wird. Zudem sind all jene wurde für die Stromerzeugung ein Wirkungs-
Verbraucher nicht erfasst, die ihren Strom grad von 35 % und für die Wärmeerzeugung
selbst erzeugen und direkt nutzen (z. B. kleine von 55 % bei stromgeführten4 Anlagen ange-
Wasserkraftwerke). nommen. Für wärmegeführte5 Anlagen wurden
30 % für Strom und 60 % für Wärme ange-
Zur Darstellung des Strommixes in der Regi- setzt.
on Bodensee-Oberschwaben wurden die Da-
ten des Energieversorgers EnBW über die in- Es wurden folgende Durchschnittswerte für die
stallierten Leistungen betrachtet und durch Da- Volllaststunden der Bestandsanlagen6 ange-
tenerhebungen aus den Landratsämtern der nommen:
einzelnen Landkreise ergänzt. Aus diesen
Leistungsdaten (in kW) wurden mit Hilfe gän- Photovoltaikanlagen 1.000 h/a
giger Werte für die Volllaststunden2 (h) der
entsprechenden Energiearten die erzeugten Windenergieanlagen 1.300 h/a
Energiemengen (in kWh3) berechnet.
Wasserkraftanlagen 3.000 h/a
Zur Ermittlung des Wärmebedarfs wurden Er-
fahrungswerte der Energieagentur Ravensburg Biogasanlagen 7.000 h/a
für den Wärmebedarf pro Einwohner in unter-
schiedlichen Gemeinden der verschiedenen
Öl- und Gasheizkessel 1.800 h/a
Landkreise verwendet und jeweils ein realisti-
(fossile Energien)
scher Durchschnittswert gebildet.
Die Zusammensetzung des Wärmemixes für Erdwärmeanlagen 2.500 h/a7
das Jahr 2010 ergibt sich aus Daten der
Schornsteinfeger (Öl- und Gaskessel bis 1.000 Holz 2.000 h/a
kW), dem Solaratlas (solarthermische Anla-
gen) und der BAFA (geförderte Biomassekes- Kachelöfen 1.000 h/a
sel). Weitere Daten (z. B. Geothermie, Biogas)
lieferten die Landratsämter. Aus einer früheren KWK-Anlagen fossil 6.500 h/a
1
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die z. B. ein Ener-
gieversorgungsunternehmen an Gemeinden zahlt, um öf-
4
fentliche Wege für Strom- und Gasleitungen zu nutzen. Stromerzeugung im Vordergrund
2 5
theoretische Betriebsstunden über ein Jahr bei ständiger Wärmeerzeugung im Vordergrund
6
voller Leistung keine Angaben für Solarthermie, Thermalwasser
3 7
stündlich erzeugte Energiemenge bei 1 kW in Kombination mit einem PufferspeicherRegionalverband Bodensee-Oberschwaben 13
4.2 Energieverbrauchsentwicklung und -einsparung
Strombedarfsentwicklung
In Deutschland entfielen im Jahr 2005 1 % des Auch in den Gemeinden der Region Boden-
Bruttostrombedarfs1 auf die Landwirtschaft, see-Oberschwaben ist der Einfluss der Indust-
3 % auf den Verkehr, 8 % auf öffentliche Ein- rie auf die Strombedarfsentwicklung klar er-
richtungen, 14 % auf Handel und Gewerbe, kennbar. Je nach Industrieanteil ist auch hier
27 % auf die Haushalte und der deutlich größ- in den Stromverbrauchsdaten der vergange-
te Anteil mit 47 % auf die Industrie. Dieser ho- nen Jahre die Finanz- und Wirtschaftskrise
he Anteil und damit der Einfluss der Industrie deutlich erkennbar.
auf den Stromverbrauch zeigt sich auch im
Vergleich der Entwicklung des Bruttostrombe- Die Entwicklung des Strombedarfs in Deutsch-
darfs2 mit der des Bruttoinlandsprodukts3 (BIP) land und der Region ist also zu großen Teilen
in Deutschland: von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.
Diese jedoch ist für die nächsten zehn Jahre
Zeitraum Entwicklung Entwicklung nur schwer vorherzusagen. Nach einem ver-
Strombedarf BIP hältnismäßig hohen Wachstum zwischen 2009
und 2011 (3 – 6 %), direkt nach der Krise,
1996 – 2005 + 1,4 %/a + 1,9 %/a zeigt sich aktuell ein Abwärtstrend, der sich im
Moment auf dem Niveau der Zeit vor der Wirt-
2005 – 2007 + 1,0 %/a + 3,6 %/a schaftskrise (etwa 2 %) befindet. Die Progno-
sen für die Zukunft gehen in diesem Bereich
2007 – 2008 - 0,6 % + 1,9 % weit auseinander und die Einflüsse sind vielfäl-
tig: Konsum, Energiepreise, Ressourcenver-
2008 – 2009 -6% - 4,0 % fügbarkeit und mehr spielen dabei eine Rolle
und beeinflussen sich wiederum auch gegen-
2009 – 2010 +4% + 3,8 % seitig.
2010 – 2011 k. A. + 5,8 % Der Einfluss des Strombedarfs von öffentlichen
Einrichtungen, Handel und Gewerbe sowie von
Haushalten, die insgesamt einen Anteil von
49 % am Bruttostrombedarf ausmachen, ist
Nachdem zwischen 1996 und Ende 2004 das deutlich schwieriger in der Entwicklung aus-
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Schnitt zumachen. Es ist davon auszugehen, dass der
einen jährlichen Zuwachs von 1,9 % verzeich- Bedarf in diesem Bereich aufgrund verstärkter
nete, gab es in den Jahren 2005 und 2006 ei- Technisierung (Computer, Touchscreens, digi-
nen deutlichen Anstieg, gefolgt von einem tale Visualisierung, Smartphones) in den letz-
starken Einbruch in den Jahren 2008 und 2009 ten Jahren angestiegen ist. Eine weitestge-
und daran anschließend wiederum eine große hende Sättigung in diesem Bereich ist aktuell
Zunahme 2010. Dies kann auf den Pro- jedoch bereits anzunehmen. Auch werden
duktionsrückgang und die -wiederzunahme im nach und nach immer mehr alte Geräte durch
Verlauf der Finanz- und Wirtschaftskrise zu- effizientere neue ersetzt (besonders Kühl- und
rück geführt werden, die ihren Anfang 2007 in Gefriergeräte, Wasch- und Trockenmaschi-
den USA hatte und besonders im Jahr 2008 nen).
auch für die Unternehmen in Deutschland
spürbar wurde. Allgemein ist zu beachten, dass in den ver-
gangenen Jahren bereits in verschiedenen Be-
reichen Einsparmaßnahmen umgesetzt wur-
1
den. Der sogenannte „Rebound-Effekt“ ist
Quelle: Wikipedia hierbei nicht zu unterschätzen. Demzufolge
2
Quelle: Statistisches Bundesamt (laut Wikipedia) werden etwa effizientere Geräte oftmals
3
Quelle: Statistisches Bundesamt14 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
weniger effizient genutzt. Zudem führen Ener- Für diese Studie wurde in Anbetracht der ge-
gieeinsparungen oft zu finanziellen Einsparun- nannten Umstände und Entwicklungen für die
gen, woraufhin wiederum andere Investitionen nächsten Jahre eine durchschnittliche Strom-
möglich werden, was sowohl die Produktnach- bedarfssteigerung von 1 % pro Jahr ange-
frage als auch den Energieverbrauch durch die nommen, was bis zum Jahr 2022 einer Steige-
zusätzlichen Geräte erhöht. rung von gut 10 % im Vergleich zum Jahr 2010
entspricht. Dieser Wert bezieht sich auf die Be-
Die Elektromobilität ist dem Bereich Verkehr reiche Landwirtschaft, öffentliche Einrichtun-
zuzuordnen, welcher innerhalb dieser Studie gen, Handel und Gewerbe, Haushalte sowie
nicht betrachtet wird. Die Abgrenzung könnte die Industrie.
sich in Zukunft jedoch schwieriger gestalten,
da gerade Pedelecs und Elektrofahrräder, aber
auch Elektroautos, zuhause oder auf Firmen-
gelände geladen werden. Stromtankstellen Wärmeverbrauchsentwicklung
werden hingegen abgrenzbar sein. Es ist hier-
bei zu beachten, dass die Elektromobilität in Für die Wärmeverbrauchsentwicklung in
der Regel keinen zusätzlichen Bedarf darstellt, Deutschland und der Region liegen aktuell
sondern hierbei Öl und Gas durch Strom er- keine belastbaren Daten vor. Auszugehen ist,
setzt werden. Je nach Herkunft des Stromes aufgrund immer höherer Anforderungen bei
kann durch weniger Umwandlungsschritte so- der Gebäudedämmung, von einer tendenziel-
wie effizientere Umsetzung (besserer Wir- len Abnahme in diesem Bereich.
kungsgrad), der Primärenergiebedarf1 sogar
sinken. Die genaue Entwicklung der Elektro-
mobilität ist aus heutiger Sicht schwer einzu-
schätzen, anzunehmen ist jedoch eine Steige-
rung.
1
Die Primärenergie entspricht dem Energiegehalt vor
etwaigen Umwandlungsschritten.Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 15
Energieeinsparung
Zur Einschätzung der Energieeinsparpotenzia- Für Wärme:
le wurden für diese Studie zum einen diverse
Werte aus vorangegangenen Studien und Minderung der Raumtemperatur
Prognosen herangezogen, zum anderen aus
den Erfahrungswerten der Energieagentur gezieltes, kurzes Lüften
heraus realistische Annahmen getroffen.
Richtige Einstellung der Heizungsrege-
Die Einsparung von Energie ist das größte und lung und Warmwasserbereitung; Hyd-
günstigste „Kraftwerk“. Jede Kilowattstunde die raulischer Abgleich
nicht verbraucht wird, muss auch nicht erzeugt
werden. Oftmals reichen schon geringfügige
Veränderungen beim Nutzerverhalten und in
der Technik, um bereits beachtliche Einspa- Zu den mittel- und längerfristigen Maßnah-
rungen zu erzielen. Im Rahmen dieser Studie men gehören jene, für die gezielte Investitio-
wurde zwischen kurzfristig erreichbaren Ein- nen nötig sind, die sich aber in der Regel be-
sparpotenzialen (schnell umsetzbar, geringe reits nach wenigen Jahren amortisieren.
Investitionen) und mittel- und längerfristigen
Einsparpotenzialen (Planung und gezielte In- Für Strom:
vestition notwendig) unterschieden.
Erfassung der Verbrauchsdaten und
Es ergaben sich daraus folgende prozentuale Einführung eines Energiemanagements
Einsparpotenziale bis 2022:
Ersatz älterer Elektrogeräte durch effi-
Strom Wärme zientere Varianten
Einfache Maßnahmen 5 - 10 % 5 - 10 % Beleuchtung: Präsenzmelder, LED
Mittel- und längerfristige 20 - 30 % 40 - 50 % Lüftung: Anpassung an Benutzungs-
Maßnahmen struktur
Austausch von Heizungspumpen
Zu den einfachen Maßnahmen zählen jene, Effizienzsteigerung bei Produktionsma-
für die keine oder nur geringe Investitionen ge- schinen und Druckluftanlagen
tätigt werden müssen. Sie sind außerdem
schnell umsetzbar und amortisieren sich oft
schon nach kurzer Zeit.
Für Wärme:
Für Strom:
Erfassung der Verbrauchsdaten und
Information und Schulung Einführung eines Energiemanagements
Vermeidung von Stand-By- Dämmung von Heizungs- und Warm-
Verbräuchen wasser-Leitungen
Vermeidung unnötigen Betriebs Gebäudedämmung und –sanierung
Abwärmerückgewinnung16 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
Da sich die geschätzten prozentualen Ein- Zusammenfassung
sparpotenziale für Strom und Wärme in den
verschiedenen Bereichen nur geringfügig un- Bis zum Jahr 2022 ergibt sich mit einer ange-
terscheiden, wurden für alle Kreise, unabhän- nommenen Strombedarfserhöhung von insge-
gig von ihrer jeweiligen Aufteilung in Industrie, samt 10 % und bei Ausnutzung aller theoreti-
Haushalte und so weiter, insgesamt dieselben schen Einsparpotenziale von insgesamt 35 %
Mittelwerte angesetzt. Diese sind für Strom eine mögliche Einsparung von 25 % gegen-
10 % für einfache und zusätzlich 25 % für mit- über dem Jahr 2010.
tel- und längerfristige Maßnahmen und für den
Bereich Wärme 10 % und 45 %. Für den Bereich Wärme ergibt sich bis zum
Jahr 2022 bei Ausnutzung aller theoretischen
Potenziale eine mögliche Einsparung von bis
zu 55 % gegenüber 2010.
4.3 Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien und für die Energieeffizienz
Zur Einschätzung der Ausbaupotenziale der ben, wurde die bisherige Entwicklung betrach-
erneuerbaren Energien wurden für diese Stu- tet sowie über Erfahrungswerte und Satelliten-
die sehr vielfältige Datenquellen herangezo- bilder die noch zur Verfügung stehenden, ge-
gen. Im Folgenden wird die Vorgehensweise eigneten Dachflächen analysiert.
zur Potenzialeinschätzung für die einzelnen
Energiearten erläutert. Es wurde folgender Durchschnittswert für die
Volllaststunden der möglichen Neuanlagen
Im Bereich Photovoltaik sind die theoreti- angenommen:
schen Potenziale immens. Weltweit gesehen
übertrifft die eintreffende Sonnenenergie den Photovoltaikanlagen 1.000 h/a
aktuellen Strombedarf um ein Vielfaches.
Im Jahr 2010 hat der Regionalverband eine
Planungshinweiskarte zur Festlegung von Der Teilregionalplan Windenergie 2006 des
Standorten für großflächige Photovoltaikanla- Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben
gen im Rahmen der kommunalen Bauleitpla- wird zur Zeit fortgeschrieben. Die 24 geplanten
nung erstellt und im Internet veröffentlicht1. Vorranggebiete für Windenergie bieten Platz
Obwohl ein Vergütungsanspruch für Strom aus für 130 Windenergieanlagen. Diese Anlagen-
Freiflächenanlagen gemäß § 32 EEG nur noch zahl wurde als Potenzial für den Ausbau der
im Rahmen der dort genannten Kriterien be- Windenergie bis 2022 im Rahmen dieser Stu-
steht (u.a. nur noch auf Konversionsflächen die zugrunde gelegt. Der Kriterienkatalog für
und längs von Autobahnen und Schienenwe- die Festlegung der Vorranggebiete umfasst
gen in einer Entfernung von bis zu 110 m) und neben den Themen Windhöffigkeit, Siedlungs-
zudem der Flächenbedarf erheblich ist (siehe abstände, Natur- und Artenschutz, Denkmal-
Kapitel 7.3), ist auch in den kommenden Jah- schutz etc. auch eine Bewertung der Anbin-
ren mit der Realisierung weiterer Freiflächen- dung an das Stromnetz. Die Netzanbindung
anlagen zu rechnen. Der Schwerpunkt der Po- wird zudem durch die Bündelung der Wind-
tenziale im Bereich Photovoltaik liegt dennoch energieanlagen in den Vorranggebieten er-
im Bereich Dachflächen, Häuserfassaden und leichtert. Die Fortschreibung des Teilregional-
sonstigen Überdachungen. plans Windenergie befindet sich derzeit in der
Offenlage, daher sind Änderungen im weiteren
Um eine Prognose für das Jahr 2022 abzuge- Verfahren nicht ausgeschlossen.
1
www.rvbo.deRegionalverband Bodensee-Oberschwaben 17
Zusätzliches Potenzial im Bereich Windenergie stände laut Statistischem Landesamt Baden-
besteht darin, bestehende Anlagen durch neue Württemberg betrachtet. Hier gibt es noch Po-
zu ersetzen (Repowering). Von den sechs be- tenziale. Auch andere „Energiepflanzen“ soll-
stehenden Anlagen in der Region ist eine ten in Betracht gezogen werden, um eine ge-
(Blochingen) aufgrund von Flugbeschränkun- wisse Vielfalt beim Anbau zu gewährleisten.
gen nicht durch eine größere Anlage aus- Große Potenziale bieten außerdem die Nut-
tauschbar. Bei den anderen beiden Gebieten zung der anfallenden Abwärme durch Nach-
wären nach dem Repowering durch geänderte schaltung zum Beispiel eines Organic-
Abstandskriterien nur noch 2 statt 5 Anlagen Rankine-Prozesses1 (Effizienzsteigerung), als
möglich. Deshalb wurde für die Windenergie- Heizwärme vor Ort und im Nahwärmenetz so-
anlagen in der Region das Repowering nicht wie die Aufbereitung des Biogases auf Erd-
als zusätzliches Potenzial mitbetrachtet. gasqualität und die anschließende Einspei-
sung ins Gasnetz.
Es wurde folgender Durchschnittswert für die
Volllaststunden der möglichen Neuanlagen Es wurde folgender Durchschnittswert für die
angenommen: Volllaststunden der möglichen Neuanlagen
angenommen:
Windenergieanlagen 1.600 h/a
Biogasanlagen 7.000 h/a
Zur Abschätzung der Potenziale für Wasser-
kraft wurden Daten der Landratsämter ver- Für eventuell noch offene Potenziale im Be-
wendet sowie aus der Studie „Potenziale der reich Holz wurden bislang keine belastbaren
Wasserkraftnutzung im Bodenseekreis“ und Daten erhoben. Insgesamt ist hier aber davon
der OEW-Potenzialstudie „Erneuerbare Ener- auszugehen, dass das größte Potenzial aus
gien“ entnommen. Möglichkeiten für Repowe- den Wäldern, unter Zurückhaltung einer ge-
ring wurden ebenfalls betrachtet. Zu beachten wissen Vorratsmenge, bereits ausgenutzt wird.
ist, dass sich an einigen Anlagen aufgrund in- Zu beachten ist, dass bei den bestehenden
zwischen erhöhter Anforderungen für den Anlagen nicht nur Holz aus der Region Boden-
Schutz der Gewässer und der Tierwelt gerin- see-Oberschwaben, sondern auch aus ande-
gere Durchlaufmengen, also geringere Erträge ren Regionen verwendet wird. Potenziale gibt
ergeben können. es noch im Bereich der schnellwachsenden
Hölzer. Hier sollten die ökologischen Auswir-
Es wurde folgender Durchschnittswert für die kungen geprüft und beachtet werden.
Volllaststunden der möglichen Neuanlagen
angenommen: Da die Holzverbrennung / -vergasung grund-
lastfähig ist und damit zur Versorgungssicher-
Wasserkraftanlagen 4.000 h/a heit und Netzstabilität beiträgt, wurde für die
Potenziale zur Stromversorgung der Ersatz
von großen Holzheizkesseln (ab 100 kW, reine
Wärmebereitstellung) durch BHKWs mit Holz-
In den eher land- und viehwirtschaftlich struk- vergasung (Strom und Wärme) in die Berech-
turierten Landkreisen Ravensburg und Sigma- nungen mit einbezogen. Diese Anlagen befin-
ringen trägt Biogas bereits mit hohem Anteil den sich derzeit noch im Versuchsstadium.
zur Stromversorgung bei. Insgesamt sind die
Potenziale in allen Landkreisen, unter Berück-
sichtigung der „nachhaltigen Obergrenze“ von
35 % für den Anteil von Silomais auf Ackerflä-
chen, bereits fast vollständig ausgeschöpft.
Um die verfügbaren Gülle- und Mistmengen in 1
siehe Abschnitt „Organic Rankine Cycle“ in diesem
der Region abzuschätzen, wurden die Viehbe- Kapitel18 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
Es wurde folgender Durchschnittswert für die ben hat im Jahr 2005 in Zusammenarbeit mit
Volllaststunden der möglichen Neuanlagen dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und
angenommen: Bergbau Baden-Württemberg die Nutzung der
Erdwärme in der Region Bodensee-
Holz-BHKWs 7.000 h/a Oberschwaben untersucht und die Ergebnisse
veröffentlicht. Zur oberflächennahen Geother-
mie geben insbesondere die Karten „Hydroge-
ologische Kriterien zur Anlage von Erdwärme-
sonden“ wichtige Hinweise für die Beurteilung
der örtlichen Gegebenheiten.
Unter Erdwärme oder Geothermie versteht
man die in Form von Wärme gespeicherte Es wurde folgender Durchschnittswert für die
Energie im Untergrund. Volllaststunden der möglichen Neuanlagen
angenommen:
Bei der oberflächennahen Geothermie (bis
ca. 400 m Tiefe) wird die Wärme in der Re- Erdwärmepumpen 2.500 h/a2
gel über Erdwärmesonden gewonnen und mit-
tels einer Wärmepumpe zur Gebäudebehei-
zung genutzt. Die Abschätzung der Potenziale
in diesem Bereich erfolgte nur im groben Maß Bei der Tiefengeothermie besteht neben der
und über Prognosen verschiedener Studien Wärmebereitstellung auf höherem Tempera-
zum Thema sowie über die bisherige Entwick- turniveau auch die Möglichkeit, die gewonnene
lung. Es ist davon auszugehen, dass die rea- Wärme zur Stromerzeugung zu nutzen. Hierfür
len Potenziale in diesem Bereich höher liegen sind Temperaturen von mindestens 150 °C
als hier angenommen. beziehungsweise etwa 100 °C bei ORC not-
wendig. Diese Technik ist jedoch wegen Um-
Zu beachten ist bei dieser Technologie zum welt- und Sicherheitsbedenken stark umstrit-
einen die Jahresarbeitszahl1 (diese ist im rea- ten. Die Abschätzung der Tiefengeothermie-
len Betrieb oft zu niedrig) und zum anderen Potenziale beschränkt sich innerhalb dieser
der Bezug des Stroms. Sinnvoll ist hier eine Studie daher auf den Bereich Thermalwasser.
Kopplung der Erdwärmepumpe mit einer Pho- Hierfür wurden bislang nur einzelne Quellen
tovoltaikanlage. Jedoch geht dieses Konzept in untersucht. Die realen Potenziale liegen si-
unseren Breitengraden in der Regel nur im cherlich höher.
Sommer auf, wenn die Sonneneinstrahlung
hoch genug ist. Eine weitere sinnvolle, jahres- Im Rahmen des Interreg-Projekts „GEOMOL“,
zeitunabhängigere Anwendungsmöglichkeit an dem der Regionalverband Bodensee-
bietet die Kombination mit einem entsprechend Oberschwaben als Projektpartner beteiligt ist,
großen Pufferspeicher. In dieser Variante kann werden derzeit Untersuchungen zur Abschät-
die Anlage dann betrieben werden, wenn zung der Potenziale im Molassebecken durch-
überschüssiger Strom vorhanden ist, und in geführt, die unter anderem weitergehende
dieser Zeit den Speicher füllen (aufheizen). Kenntnisse für die zukünftige Nutzung der Tie-
Nach Bedarf kann die Wärme dann wieder fengeothermie (Temperaturmodell), einschließ-
entnommen werden. Wichtig ist hierbei, dass lich der Thermalwassernutzung, bringen sol-
der Speicher groß genug ist und möglichst ver- len.
lustarm arbeitet.
Der Regionalverband Bodensee-Oberschwa-
Die Abschätzung der Potenziale im Bereich
1 der Solarthermieanlagen erfolgte auf ähnli-
Die Jahresarbeitszahl zeigt, wie viel elektrische Energie
che Weise wie im Bereich Photovoltaik, vor al-
benötigt wird um eine gewisse Menge thermische Ener-
gie bereitzustellen. Sie sollte bei mindestens 4 liegen: 1
2
Teil Strom, 4 Teile nutzbare Wärme. in Kombination mit einem PufferspeicherRegionalverband Bodensee-Oberschwaben 19
lem auf Basis der bisherigen Entwicklung und für das Stadtgebiet Friedrichshafen. Für weite-
unter Betrachtung geeigneter Dachflächen. re Teile des Landkreises Bodenseekreis sowie
für die Landkreise Ravensburg und Sigmarin-
gen liegen derzeit noch keine vergleichbaren
Potenzialerhebungen vor.
Saftige und holzige Abfälle werden bislang
nur wenig zur Strom- und Wärmeerzeugung Für die vorliegenden Potenziale wurde auch
genutzt. Zu ihnen zählen Bioabfälle, Speise- die Möglichkeit mit einberechnet, aus der Ab-
reste und überlagerte Lebensmittel (saftig) so- wärme bei der Stromerzeugung mit Verbren-
wie Grünschnitt, Landschaftspflegematerial nung (z. B. Biogasanlagen, Abfallvergärung),
(teils saftig, teils holzig) und Holzabfälle zum weiteren Strom zu erzeugen. Beispielhaft wur-
Beispiel aus Sägereien (holzig). Die Potenzial- de hier der sogenannte Organic-Rankine-
abschätzung in diesem Bereich erfolgte auf Cycle (ORC) betrachtet. Die Abwärme kann
Grundlage von Daten der Landratsämter sowie hierbei über eine dem BHKW nachgeschaltete
der Machbarkeitsstudie „Biogasanlagen - Anlage zur weiteren Stromerzeugung genutzt
Oberschwaben“ der Schöttle Consulting GmbH werden.
in Zusammenarbeit mit der Energieagentur
Ravensburg. Die Funktionsweise ist grundsätzlich dieselbe
wie bei einem herkömmlichen Dampfkraftpro-
Es wurde folgender Durchschnittswert für die zess, jedoch reichen durch spezielle Thermo-
Volllaststunden der möglichen Neuanlagen öle schon wesentlich niedrigere Temperaturen
angenommen: (etwa 100 – 400 °C) um den Prozess in Gang
zu bringen. Bei diesem Prozess fällt noch im-
Abfallvergärungsanlagen 7.000 h/a mer ein Teil Abwärme an, allerdings auf nied-
(Biogasanlagen) rigerem Temperaturniveau, der zur Heizung
nahegelegener Gebäude und zur Warmwas-
serbereitung dienen kann. Zu beachten ist,
dass durch die teilweise Nutzung der Anlagen-
Die dargestellten Potenziale im Bereich der Wärme zur Stromnutzung, die theoretischen
industriellen Abwärme im Landkreis Boden- Potenziale im Wärmebereich geringer werden.
seekreis entstammen einer Potenzialerhebung Dies wurde innerhalb der Potenzialbetrachtung
in dieser Studie berücksichtigt.20 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
4.4 Potenziale für den Ausbau der fossilen Kraft-Wärme-Kopplung
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die kombi- kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung. In
nierte Erzeugung und Nutzbarmachung von den nächsten zehn Jahren werden in dieser
Strom und Wärme in einem Kraftwerk. Größenordnung gut 1.500 Ölheizungen und
1.600 Gasheizungen ersetzt werden müssen.
Bislang wird in Deutschland der Strom in gro- Es sollten hier Volllastzeiten von mindestens
ßem Maß aus fossilen Brennstoffen und ohne 5.500 h/a angestrebt werden, was mit einer
besondere Nutzung der bei dieser Kraftstoff- etwas geringer ausgelegten thermischen Leis-
verbrennung anfallenden Wärme erzeugt. Da- tung in Kombination mit einem Pufferspeicher
bei wird der Brennstoff nur zu 30 – 35 % ge- und einem zusätzlichen Spitzenlastkessel er-
nutzt. Sowohl bei der rein thermischen Nut- reicht werden kann. Sinnvoll ist es hierbei,
zung (Heizkessel), als auch bei der Nutzung in nicht bis zum Versagen des bisherigen Kes-
Kraft-Wärme-Kopplung kann der Brennstoff sels zu warten, sondern das BHKW bereits
hingegen zu über 90 % ausgenutzt werden. vorher zu installieren und den alten Kessel als
Eine Effizienzsteigerung durch KWK ergibt Spitzenlastkessel einzusetzen. Besondere
sich also nur im Vergleich zur reinen Stromer- Vorteile dieser Auslegung sind die dadurch er-
zeugung, nicht im Vergleich zur rein thermi- reichbaren höheren Volllastzeiten der BHKWs
schen Nutzung. Dennoch stellt die KWK – so- und die damit einhergehende effizientere
wohl bei regenerativen als auch bei fossilen Brennstoffausnutzung.
Brennstoffen – aus heutiger Sicht einen wichti-
gen Pfeiler in der zukünftigen Energieversor- Es wurde folgender Durchschnittswert für die
gung dar, da sie durch ihre Grundlastfähigkeit Volllaststunden der möglichen Neuanlagen
und variable Regulierbarkeit zur Netzstabilität angenommen:
beiträgt und je nach benötigter Last geregelt
werden kann. KWK-Anlagen fossil 5.500 h/a
In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt
es laut Schornsteinfeger-Statistik 61.827 Öl-
und 33.864 Gasfeuerungsanlagen unter 1.000 Der Bereich der Kälte (Kühl- und Klimageräte)
kW zur reinen Wärmeerzeugung. Über 25 % ist bislang in der Regel dem Strom zuzuord-
der Ölfeuerungsanlagen und über 30 % der nen. Gerade im Zusammenhang mit der Kraft-
Gasfeuerungsanlagen sind schon heute älter Wärme-Kopplung könnte in Zukunft jedoch
als 20 Jahre und müssen bereits in naher Zu- vermehrt Kälte auch „aus Wärme“ erzeugt
kunft ausgetauscht werden. Weitere 53 % (Öl) werden. In Industriebetrieben, aber auch in Bü-
und 54 % (Gas) der aktuell bestehenden Anla- rogebäuden, ist in der Regel im Winter ein ho-
gen werden voraussichtlich bis zum Jahr 2022 her Wärmebedarf vorhanden, während in den
ausgetauscht werden müssen. Insgesamt gibt Sommermonaten Wärme meist nur in gerin-
es bis zum Jahr 2022 also einen Austausch- gem Maß (z. B. Warmwasserbereitung) benö-
aufwand von 78 % (Öl) und 84 % (Gas). Es ist tigt wird. Mit sogenannten Adsorptionskälte-
hierbei zu beachten, dass gerade ältere Anla- maschinen kann an dieser Stelle angesetzt
gen oft überdimensioniert sind und der eigent- und Kälte aus der überschüssigen Wärme be-
liche Wärmebedarf vor Ort deutlich geringer reit gestellt werden. Die Wärme dient hier da-
ist. zu, den Prozess der Kältebereitstellung in
Gang zu halten. Dabei werden Gesamtwir-
Sowohl beim Ersatz von Öl- als auch von Gas- kungsgrade von bis zu 95 % erreicht. Diese
feuerungsanlagen sind Neu-Anlagen mit einer Vorgehensweise bietet sich sowohl für fossile
Leistung von über 50 kW interessant für die als auch regenerative KWK-Anlagen an.Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 21
4.5 Treibhausgas-Emissionen
Status Quo Für die Region Bodensee-Oberschwaben lie-
gen aktuell keine Gesamtbetrachtungen zu
Treibhausgase sind strahlungsbeeinflussende, den Treibhausgasen, sondern nur zu einzel-
gasförmige Stoffe, die zum sogenannten nen Gasen vor. Aufgrund seiner großen Be-
Treibhauseffekt beitragen und somit das Klima deutung für das Klima wurden in dieser Studie
auf der Erde beeinflussen können. Die im Kyo- besonders die Emissionswerte für CO2 be-
to-Protokoll reglementierten Gase sind trachtet. Die Informationen hierfür stammen
aus dem Online-Archiv des Statistischen Lan-
Kohlenstoffdioxid (CO2), desamtes Baden-Württemberg.
Methan (CH4), Die CO2-Emissionen bei der Nutzung ver-
schiedener Energiequellen stellen sich folgen-
Stickstofftrifluorid (NF3), dermaßen dar:
Distickstoffmonoxid (Lachgas, N2O),
Schwefelhexafluorid (SF6) und Energiequelle CO2-Ausstoß1 Einsparung
Fluorkohlenwasserstoffe.
Strommix fossil 0,6 kg/kWh 0 % (Referenz)
Heizöl 0,32 kg/kWh 47 %
Die Treibhausgasemissionen in Baden-
Württemberg bestehen zu rund 91 % aus Koh- Erdgas 0,25 kg/kWh 58 %
lendioxid (CO2), rund 4 % der Emissionen,
gemessen in CO2-Äquivalenten, entfallen auf Holzpellets 0,03 kg/kWh 95 %
Methan (CH4) und weitere gut 4 % auf Lach-
gas (N2O). Dabei ist berücksichtigt, dass eine Stückholz 0,02 kg/kWh 97 %
Tonne Methan einen um den Faktor 21, Lach-
gas sogar um den Faktor 310 höheren Treib- Photovoltaik, Wind- 0 kg/kWh 100 %
hauseffekt in der Atmosphäre bewirkt als eine energie, Wasserkraft
Tonne CO2. Die außerdem zu den im Kyoto-
Protokoll reglementierten Treibhausgasen ge-
hörigen F-Gase sind in den Betrachtungen des
Landes nicht enthalten, sie machen deutsch-
landweit knapp 2 % aus.
1
Quelle: Landesweite Förderrichtlinie Klimaschutz-
Plus!22 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
5 Status Quo der Energieversorgung und Emissionen
5.1 Landkreis Bodenseekreis
Aktueller Strommix im Lkr. Bodenseekreis Aktueller Wärmemix im Lkr. Bodenseekreis
Der Stromverbrauch im Landkreis Bodensee- Der Wärmeverbrauch im Landkreis Bodensee-
kreis betrug im Jahr 2010 über 1.640 Mio. kreis betrug im Jahr 2010 über 3.230 Mio.
kWh1 bzw. 7.871 kWh pro Einwohner. Der An- kWh bzw. 15.501 kWh pro Einwohner. Der An-
teil der regenerativen Energien an der Strom- teil der regenerativen Energien an der Wärme-
erzeugung lag bei ca. 6 %. erzeugung lag bei ca. 5 %.
KWK fossil KWK fossil
0,2 % Kachelöfen
0,2 % 2%
Photovoltaik
Fossile 4% Fossile
Energien
Energien 5% Holz 1 %
und 6%
Atomkraft
95 %
94 % Solarthermie
Biogas 1 % 1%
Erdwärme 1 %
Holz 1 % Biogas 0,2 %
Wasserkraft 0,1 %
1
davon fast 10 % für die Bodensee-Wasserversorgung
5.2 Landkreis Ravensburg
Aktueller Strommix im Lkr. Ravensburg Aktueller Wärmemix im Lkr. Ravensburg
Der Stromverbrauch im Landkreis Ravensburg Der Wärmebedarf im Landkreis Ravensburg
betrug im Jahr 2010 über 1.520 Mio. kWh betrug im Jahr 2010 über 3.625 Mio. kWh
bzw. 5.488 kWh pro Einwohner. Der Anteil der bzw. 13.088 kWh pro Einwohner. Der Anteil
regenerativen Energien an der Stromerzeu- der regenerativen Energien an der Wärmeer-
gung lag bei ca. 25 %. zeugung lag bei ca. 7 %.
KWK fossil
1%
Biogas KWK fossil Holz 2 %
10 % 1%
Fossile Kachelöfen
Energien Fossile 2%
und 25 % Energien 7%
Photovoltaik
Atomkraft 9% 92 % Biogas 1 %
74 %
Erdwärme 1 %
Wasserkraft 3 %
Holz 2 % Solarthermie 1 %
Windkraft 1 % Thermalwasser 0,2 %
Abfälle 0,3 % Abfälle 0,1 %Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 23
5.3 Landkreis Sigmaringen
Aktueller Strommix im Lkr. Sigmaringen Aktueller Wärmemix im Lkr. Sigmaringen
Der Stromverbrauch im Landkreis Sigmaringen Der Wärmebedarf im Landkreis Sigmaringen
betrug im Jahr 2010 über 675 Mio. kWh bzw. betrug im Jahr 2010 über 1.563 Mio. kWh
5.184 kWh pro Einwohner. Der Anteil der re- bzw. 12.003 kWh pro Einwohner. Der Anteil
generativen Energien an der Stromerzeugung der regenerativen Energien an der Wärmeer-
lag bei ca. 38 %. zeugung lag bei ca. 8 %.
KWK fossil
0,1 %
KWK fossil
0,5 %
Biogas Holz 3 %
18 %
Fossile
Energien Fossile
8% Biogas 2 %
und 38 % Energien
Atomkraft Photovoltaik 91 %
62 % Kachelöfen
13 %
2%
Holz 3 % Solarthermie 1 %
Wasserkraft 3 % Thermalwasser 0,3 %
Erdwärme 0,1 %
Windkraft 1 %
5.4 Region Bodensee-Oberschwaben
Aktueller Strommix in der Region Boden- Aktueller Wärmemix in der Region Boden-
see-Oberschwaben see-Oberschwaben
Der Stromverbrauch in der Region Bodensee- Der Wärmeverbrauch in der Region Boden-
Oberschwaben betrug im Jahr 2010 über see-Oberschwaben betrug im Jahr 2010 über
3.835 Mio. kWh bzw. 6.230 kWh pro Einwoh- 8.418 Mio. kWh bzw. 13.676 kWh pro Ein-
ner. Der Anteil der regenerativen Energien an wohner. Der Anteil der regenerativen Energien
der Stromerzeugung lag bei ca. 20 %. an der Wärmeerzeugung lag bei ca. 7 %.
KWK fossil
0,5 %
Biogas KWK fossil Holz
8% 0,5 %
Fossile
2%
Energien
und 20 % Fossile Kachelöfen
Photovoltaik
Atomkraft Energien 7% 2%
8%
80 % 93 %
Biogas 1 %
Wasserkraft 2 %
Solarthermie
Holz 1 % 1%
Windkraft 0,5 %
Abfälle 0,1 % Erdwärme 0,5 %
Thermalwasser Abfälle 0,1 %
0,1%24 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
Vergleich des Strom- und Wärmemixes in der Region im Jahr 2010
Die folgenden Grafiken zeigen die verschiede- linken Grafik mit den absoluten Werten pro
nen Strom- und Wärmemixe der Landkreise Jahr, in der rechten Grafik mit den spezifi-
Bodenseekreis (1), Ravensburg (2), Sigmarin- schen Werten pro Einwohner und Jahr.
gen (3) und der Region Bodensee-
Oberschwaben (4) im Vergleich, jeweils in der
Vergleich des Strommixes in der Region im Jahr 2010
Gesamtstrommix: Spezifischer Strommix:
4.000 8.000 Abfälle
Abfälle
3.500 7.000
Windkraft Windkraft
3.000 6.000
Holz Holz
2.500 5.000
Wasserkraft Wasserkraft
2.000 4.000
Photovoltaik Photovoltaik
1.500 3.000
Biogas
1.000 Biogas 2.000
1.000 KWK fossil
500 KWK fossil
0 Fossile Energien 0 Fossile Energien
und Atomkraft
1 2 3 4 und Atomkraft 1 2 3 4
(in Mio. kWh pro Jahr) (in kWh pro Einwohner und Jahr)
Sowohl beim Gesamtstromverbrauch und fördern. Der spezifische Vergleich zeigt auch,
mehr noch beim spezifischen Verbrauch pro dass die Landkreise Ravensburg und Sigma-
Einwohner zeigt der Bodenseekreis die höchs- ringen annähernd gleich auf sind. Während der
ten Werte. Neben dem hohen Industrieanteil Landkreis Ravensburg insgesamt die höchste
im Kreis spielt hierbei auch die Bodensee- regenerative Stromerzeugung aufweist, liegt
Wasserversorgung eine Rolle, die fast 10 % der Landkreis Sigmaringen im Bezug auf die
des gesamten Stroms benötigt, um Trinkwas- Einwohnerzahl deutlich vorne.
ser für große Teile Baden-Württembergs zuRegionalverband Bodensee-Oberschwaben 25
Vergleich des Wärmemixes in der Region im Jahr 2010
Gesamtwärmemix: Spezifischer Wärmemix:
9.000 16.000
Abfälle
8.000 14.000 Abfälle
Thermalwasser Thermalwasser
7.000 12.000
Erdwärme Erdwärme
6.000
Solarthermie 10.000 Solarthermie
5.000
Biogas 8.000 Biogas
4.000
Kachelöfen
Kachelöfen 6.000
3.000 Holz
Holz
4.000
2.000 KWK fossil
KWK fossil
1.000 2.000 Fossile Energien
Fossile Energien
0 0
1 2 3 4 1 2 3 4
(in Mio. kWh pro Jahr) (in kWh pro Einwohner und Jahr)
Im Wärmebereich ist der Gesamtverbrauch im Auffällig ist außerdem die sehr ähnliche Men-
Landkreis Ravensburg am höchsten, während genverteilung bei Strom und Wärme. Die
bei den spezifischen Werten auch hier der Bo- Haushalte und Kommunen spielen hierbei eine
denseekreis den höheren Verbrauch aufweist. untergeordnete Rolle, da sich die Verbräuche
Ganz deutlich zeigt sich auch der hohe Anteil dort von Kreis zu Kreis nicht wesentlich unter-
der fossilen Energien an der Wärmebereitstel- scheiden. Der Grund für die Unterschiede im
lung. Wärmeverbrauch ist vor allem auf die ver-
schiedenen Industrieanteile zurück zu führen.
Auch der Tourismusanteil spielt eine Rolle.26 Energie- und Klimaschutzkonzept für die Region Bodensee-Oberschwaben
Treibhausgas-Emissionen
Kohlenstoffdioxid ist das bekannteste und Landkreis Bodenseekreis: 8,0 t/Ea3
mengenmäßig am meisten emittierte Gas un-
ter den Treibhausgasen und soll deshalb ge- Landkreis Ravensburg: 8,39 t/Ea
sondert betrachtet werden.
Landkreis Sigmaringen: 6,94 t/Ea
Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung
der CO2-Emissionen aus der Verbrennung Zum Vergleich: Der Weltklimarat fordert ein
fossiler Energieträger in der Region Bodensee- weltweites Ziel von höchstens 2 Tonnen pro
Oberschwaben von 20051 bis 2009 (Verursa- Person und Jahr. Die Gesamtregion sowie alle
cherbilanz2): einzelnen Landkreise liegen noch weit darü-
ber.
6,0 100 % 98 % 96 % 94 % 92 %
Emissionen in Millionen
5,0 Die Anteile der verschiedenen Bereiche im
4,0 Jahr 2009 gliederten sich wie folgt:
Tonnen CO2
3,0
2,0
Haushalte, öffentl.
1,0 Einrichtungen, Gewerbe
25,5 %
0,0 Industrie
2005 2006 2007 2008 2009 51,0 %
23,5 %
Verkehr
In der Region Bodensee-Oberschwaben wurde
von 2005 bis 2009 eine CO2-Einsparung von
8 % erreicht, im Landkreis Bodenseekreis von
1 %, im Landkreis Ravensburg von 14 % und
im Landkreis Sigmaringen von 5 %. Die innerhalb dieses Energie- und Klima-
schutzkonzeptes behandelten Bereiche, also
Im Jahr 2008 betrug der durchschnittliche jähr- Haushalte, öffentliche Einrichtungen, Handel
liche CO2-Ausstoß pro Person in Deutsch- und Gewerbe sowie Industrie, besitzen insge-
land etwa 9,8 Tonnen, in Baden-Württemberg samt einen Anteil von 74,5 % des CO2-
7,2 Tonnen und in der Region Bodensee- Ausstoßes in der Region. Der Verkehr liegt mit
Oberschwaben 7,9 Tonnen. 25,5 % deutlich darunter. Der größte Anteil an
CO2 wird also bei der Bereitstellung von Strom
und Wärme emittiert.
1
statistische Erhebungen liegen hier erst ab 2005 vor
2
bezieht sich auf die Verursacher / Verbraucher (End-
3
energie) pro Einwohner (E) und Jahr (a)Sie können auch lesen