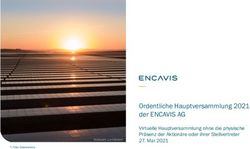Regionale Arbeitsmarktstrategie für die Umsetzung des ESF im Main-Tauber-Kreis für das Jahr 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
1. Vorbemerkung 3
1.1 Eckpunkte zur ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 3
1.2 Anpassung der regionalen Förderstrategie 4
2. Ziel B 1.1: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der
Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Armut und
Ausgrenzung bedroht sind 4
2.1 Regionale Ausgangslage für das spezifische Ziel B1.1 4
2.2 Definition der Zielgruppen 9
2.3 Anforderung an die Projekte 9
3. Ziel C.1: Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der
Ausbildungsfähigkeit
3.1. Regionale Ausgangslage für das spezifische Ziel C 1.1 9
3.2. Definition der Zielgruppen 10
3.3. Anforderungen an die Projekte 11
4. Querschnittsziele 12
5. Umsetzung der Ziele 13
5.1. Budget 13
5.2. Untergrenze für Projektkosten 13
5.3. Auswahl der Projekte 13
6. Festlegung der Schritte zur Evaluation 14
Frau Krug
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit
Landratsamt Main-Tauber-Kreis
Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Tel.: 0 93 41 / 82 57 07
Email: elisabeth.krug@main-tauber-kreis.de
21. Vorbemerkung
1. 1 Eckpunkt e zur ESF - För der per i ode 2014 bi s 2020
Die ESF-geförderte Arbeitsmarktpolitik der aktuellen Förderperiode orientiert sich
an den EU-weiten Vorgaben einer stringenten Ergebnisorientierung und der finan-
ziellen Konzentration der Mittel. Diese beiden Prämissen erfordern eine abge-
stimmte Steuerung in der Planung und Umsetzung von spezifischen Zielen zwi-
schen Land und regionalen Arbeitskreisen. Daher konzentrieren sich die Mittel
einerseits auf weniger Ziele, andererseits strukturieren innerhalb dieser Ziele Ori-
entierungswerte für Teilnehmerzahlen und Budgets die Ausrichtung der regionalen
Förderung. In den regionalen Arbeitskreisen werden demnach nur noch die fol-
genden zwei Ziele umgesetzt:
B 1.1: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen
von Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind (In-
tegrationsziel) und
C 1.1: Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfä-
higkeit (Bildungsziel).
Vor diesem Hintergrund hat der regionale ESF-Arbeitskreis Main-Tauber-Kreis in
seiner Sitzung am 16. Mai 2019 die bestehende regionale Strategie überarbeitet
und mit empirischen Befunden zur Arbeitsmarktlage aktualisiert.
Im Integrationsziel stehen Gruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Mit-
telpunkt wie z.B. Arbeitslose und Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnis-
sen, Menschen ohne Berufsausbildung und Migranten. Bei ihnen stehen nicht in
erster Linie die Integration in Beschäftigung im Vordergrund, sondern die soziale
und persönliche Stabilisierung unter Berücksichtigung des familiären und häusli-
chen Umfeldes, Aktivierung, die Hinführung zu einer Ausbildung, Qualifizierung
oder Teilqualifizierung und ergänzende Sprachförderung.
Im Bildungsziel werden jugendliche Schulverweigerer unter 25 Jahren, auch mit
Migrationshintergrund, angesprochen, die sich nicht mehr auf die Systeme schuli-
scher oder beruflicher Ausbildung einlassen, sowie junge Menschen nach Beendi-
gung der Schulpflicht, die von den Regelsystemen der Jugendberufshilfe und des
Übergangs- und Ausbildungsbereichs nicht ausreichend erreicht werden.
31. 2 An passun g der r egi onal en För der st r at egi e
Um die Situation der Zielgruppen im SGB II zu beschreiben, wurden Daten einer
Sonderauswertung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim
mit Zeitreihen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2011 bis März 2019 aus-
gewertet. Zu einzelnen Fragen wurden die Daten mit aktuellen Informationen aus
dem Jobcenter ergänzt.
Die Zielgruppe der jugendlichen Schulverweigerer dagegen ist statistisch nicht
erfasst. Der ESF-Arbeitskreis hat sich deswegen dafür entschieden, Expertinnen
und Experten aus den Regelsystemen der Schule, Jugendberufshilfe, Jugendar-
beit und des Übergangssystems zu konsultieren und in die Beratung miteinzube-
ziehen.
Auf der Grundlage der verfügbaren Daten zum regionalen Arbeitsmarkt und den
empirischen Befunden zur Entwicklung insbesondere der Arbeitslosigkeit im SGB
II wurden die Zielgruppen für die Förderung bestimmt. Gleichstellungspolitische
Ziele sind integraler Bestandteil der Strategie und wurden sowohl bei der Analyse
als auch bei der Zielentwicklung berücksichtigt.
2. Ziel B 1.1: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit
und der Teilhabechancen von Menschen, die
besonders von Armut und Aus grenzung bedroht sind
2. 1 Regi onal e Ausgan g sl age f ür das spezif i sche Zi el B1. 1
Allgemeine Lage auf dem Arbeitsmarkt
Insgesamt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Main-Tauber-Kreis entspannt und
insbesondere im Rechtskreis SGB II deutlich besser als im Landesdurchschnitt. Im
März 2019 betrug die Arbeitslosenquote in beiden Rechtskreisen zusammen 2,5%;
gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Quote erneut gesunken (um 0,3 Prozent-
punkte).
1.928 Personen waren im März 2019 arbeitslos gemeldet. Im SGB III lag die Ar-
beitslosenquote bei 1,5 % im SGB II bei 1,0%.
Entwicklungen im SGB II
Im SGB II sank die Arbeitslosenquote von 2 % in 2011 auf 1,2 % in 2018. Bei den
Männern lag sie 2011 bei 1,8 % und somit leicht unter dem Wert der Frauen von
42,1%. Zwischen 2011 und 2018 fiel die Arbeitslosenquote bei den Frauen von
2,1% auf 1,2% und bei den Männern von 1,8% auf 1,2%.
Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt
Jüngere - Ältere Arbeitslose
Bei Personen mit besonderen Vermittlungshemmnissen verfestigt sich die Lang-
zeitarbeitslosigkeit. Ein gravierendes Hindernis für den Wiedereintritt in den Ar-
beitsmarkt bleibt das Alter. Abbildung 1 macht deutlich, dass sich die Arbeitslo-
senquote unter den SGB II–Beziehern im Main-Tauber-Kreis im Gegensatz zum
Land insgesamt bei den Arbeitslosen über 55 Jahren seit 2013 deutlich verringert
hat. Seit 2017 verläuft die Entwicklung parallel, aber deutlich unter dem Landes-
schnitt.
Die Arbeitslosenquote jüngerer Arbeitslosen unter 25 Jahren im SGB II-Bezug in
Baden-Württemberg hat sich nach der leichten Erhöhung 2016 wieder auf das
niedrige Niveau von 1,1 % gesenkt. Im Main-Tauber-Kreis hat sich diese Quote
bereits 2013 auf 1,2 % und 2016 auf 1,6 % erhöht. Hier ist ebenfalls eine Absen-
kung, allerdings nur auf 1,2 % seit Jahresbeginn auf 1,0% erreicht worden.
Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitslosenquoten im SGB II bei Älteren und Jün-
geren; Main-Tauber-Kreis im Vergleich mit Baden-Württemberg
2,5
2,3
2,1
1,9
U 25 BW
1,7
in Prozent
U 25 MTK
1,5
Ü55 BW
1,3
Ü55 MTK
1,1
0,9
0,7
0,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan. 19 Feb. 19 Mrz 19
Quelle: Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, eigene Darstellung
5Personen mit Migrationshintergrund (Ausländer)1
Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind Personen mit Migrationshinter-
grund bzw. Ausländer (Abb. 2). Die Arbeitslosenquote bei den Ausländern hat sich
im Main-Tauber-Kreis zwar von 2011 mit 10,6 % auf 9,9 % in 2014 reduziert, steigt
aber seit 2015 wieder an und betrug 2016 11,0 %. Auffallend ist, dass die Quote
nicht wie sonst besser im Vergleich zum Landesschnitt, sondern deutlich über den
Werten für Baden-Württemberg insgesamt liegt.
Der Bestand an ausländischen Arbeitslosen im SGB II hat sich von 7,4 % in 2011
auf 6,5 % in 2014 verringert und steigt seither wieder an. 2016 waren es 7,1 %.
Der Anteil der ausländischen Arbeitslosen im SGB III hat sich im Zeitraum 2011
bis 2016 von 3,1 % auf 3,9 % erhöht.
Abbildung 2: Arbeitslosenquoten von ausländischen Frauen und Männern und
insgesamt im Main-Tauber-Kreis und Baden-Württemberg
8
7
Ausl. SGB III BW
6
5
in Prozent
Aus. SGB III MTK
4
3 Ausl. SGB II BW
2
Ausl. SGB II MTK
1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, eigene Darstellung
Die Anzahl der arbeitslosen Flüchtlinge unter den SGB II – Beziehern im Main-
Tauber-Kreis ist seit Januar 2016 von 151 auf 592 Personen im Januar 2017, 819
Personen im Januar 2018 angestiegen und ist nun im Januar 2019 auf 643 Perso-
nen gesunken.
1
Statistisch erfasst sind in der Auswertung nur Personen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Sie sind eine Untergruppe der Personen mit Migrationshintergrund, die zwar
die deutsche Staatsangehörigkeit haben, häufig aber dennoch mit vergleichbaren
Problemen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert sind, wie Nicht-Deutsche.
6Langzeitarbeitslose
Der Bestand an Arbeitslosen hat sich nach dem Tiefstand von 2.422 Personen im
Jahr 2015, im Jahr 2016 gering auf 2.431 Personen erhöht, ist dann 2017 auf
2.226 Personen zurückgegangen und 2018 auf 2.009 gefallen. Der Anteil an
Langzeitarbeitslosen, die 2018 SGB II - Leistungen erhalten haben, betrug 378
Personen. Davon waren 110 Personen (29,1 %) bereits seit mehr als 4 Jahren im
Bezug von SGB II- Leistungen, 135 Personen (35,7 %) waren zwischen 2 und 4
Jahren und 133 Personen (35,2 %) waren zwischen 1 und 2 Jahren Leistungsbe-
zieher.
Abbildung 3: Anzahl der Langzeitarbeitslosen im Main-Tauber-Kreis nach Dauer im
SGB II
1 bis unter 2 Jahren 2 bis unter 4 Jahren 4 Jahre und länger
170 161 178 162 150 152 142 110 95 86 81
206 221 201 173 166
231 188 135 122 109 99
280 279 237 261 209 232 211 110 103
133 114
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan. 19 Feb. 19 Mrz. 19
Quelle: Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, eigene Darstellung
Der Anteil von langzeitarbeitslosen Männern im SGB II an allen arbeitslosen Män-
nern im SGB II bewegt sich in den Jahren 2011 bis 2017 auf etwa demselben Ni-
veau zwischen 48,3 % (Höchststand 2012) und 41,9 %. Der Tiefstand von 38,7 %
konnte 2018 erreicht werden. Der Anteil ist im I. Quartal 2019 weiter gesunken. Bei
den langzeitarbeitslosen Frauen konnte 2018 ein Tiefstand von 43,2 % erreicht
werden. Der Höchststand betrug 51,7 %. Hier ist auffallend, dass nach einer Stei-
gerung in 2017 ein Rückgang in 2018 auf 43,2% erfolgte und in den ersten drei
Monaten des Jahres 2019 ein Sinken auf unter 40% festzustellen ist.
Von den 2.009 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis, zählen 531 Personen (26,4%)
zu den Langzeitarbeitslosen. Hiervon wiederum waren Jahr 2018 10,8 %, das sind
217 Personen, zwischen 55 und 65 Jahre. Davon wiederum haben 98 Personen
Leistungen nach dem SGB II erhalten.
7Die Zahl der Alleinerziehenden unter den Langzeitarbeitslosen im SGB II - Bezug
ist von 101 im Jahr 2011 auf 45 im Jahr 2018 gesunken.
Der Anteil langzeitarbeitsloser Personen ohne deutschen Pass hat sich in den letz-
ten Jahren von 14,1 % (101 Personen in 2016) auf 15,1 % (80 Personen in 2018)
kaum verändert.
Personen ohne abgeschlossener Berufsausbildung
Im Jahr 2018 hatten im Landkreis Main-Tauber-Kreis 951 der insgesamt 2.009
Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung Im Vorjahr waren es ledig-
lich 849 Personen von 2.226. Die Anzahl arbeitsloser Menschen ohne abge-
schlossener Ausbildung im SGB II - Bezug beträgt 2018 im Main-Tauber-Kreis 623
Personen.
Personen mit einer Schwerbehinderung
Eine anerkannte Schwerbehinderung wiesen im Main-Tauber-Kreis im Jahr 2018
insges. 300 arbeitslose Personen, das sind 14,9% aller Arbeitslosen (2.009 Perso-
nen), auf. Die Anzahl ist seit 2011 (377 Personen) kontinuierlich gesunken. Die
Anzahl arbeitsloser Menschen mit einer Schwerbehinderungen im SGB II – Bezug
hat sich von 166 Personen im Jahr 2011 auf 106 Personen im Jahr 2018 reduziert.
Zusam m enf assung der w i cht i gst en Befunde
Ältere Personen über 55 Jahren konnten von der Erholung auf dem Arbeits-
markt und den intensiven Bemühungen profitieren. Hier ist die absolute Anzahl
im dritten Jahr in Folge zurückgegangen, ihr Anteil an allen Arbeitslosen ist je-
doch von 2017 auf 2018 von 22,6 % auf 26,4 % angestiegen.
Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 im SGB II – Bezug ist im vergangenen Jahr
ebenfalls rückläufig gewesen. Die Quote im Main-Tauber-Kreis liegt seit dem
ersten Quartal 2019 erstmals nicht mehr über dem Landesdurchschnitt.
Ein besonderer Handlungsbedarf besteht bei arbeitslosen Personen ohne
deutschen Pass, ggf. auch bei Deutschen mit Migrationshintergrund. Ihre Ar-
beitslosenquoten sind wesentlich höher als die deutscher Arbeitsloser.
Die absolute Anzahl Langzeitarbeitsloser Frauen im SGB II-Bezug liegt 2017
und 2018 minimal unter den Männern. Dennoch sind Frauen länger im SGB II
arbeitslos. Sie sind von Langzeitarbeitslosigkeit stärker betroffen als Männer.
Die Zahl der langzeitarbeitslosen alleinerziehenden Frauen im SGB II -Bezug
ist zurückgegangen.
31 % aller Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis sind ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung.
8Der Bestand Arbeitsloser mit einer anerkannten Schwerbehinderung hat eben-
falls von der Erholung auf dem Arbeitsmarkt profitieren und abgebaut werden
können.
2. 2 Def i ni t i on der Zi el gr uppen auf gr und d er Dat enanal yse:
Arbeitslose und Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen
Menschen ohne Berufsausbildung
Migranten im SGB II – Bezug
2. 3 Anf or d er ungen an Pr ojekt e
Aufgrund der vielschichtigen und multiplen Vermittlungshemmnisse wird die Ar-
beitsmarktintegration dieser Zielgruppen nur über Zwischenschritte der gesell-
schaftlichen, psychosozialen und gesundheitlichen Stabilisierung möglich sein. Ein
familienzentrierter Ansatz, Beratungsangebote, das Aufschließen von weiterfüh-
renden Hilfeangeboten, tagesstrukturierende und sozialintegrative Maßnahmen
(Aktivierung), sowie eine ergänzende Sprachförderung können Module einer nied-
rigschwelligen Ansprache dieser Zielgruppen sein. Zwischenstufen, z. B. über Ein-
richtungen des geförderten Arbeitsmarkts, können erforderlich sein, um Potenziale
für einen Einstieg, Wiedereinstieg oder eine Wiedereingliederung in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt auszuloten. Die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, kann
bei diesen Zielgruppen bereits als erster Erfolg gelten.
Wegen Art und Umfang der Integrationsprobleme sollten die Projekte möglichst
intensive individuelle und bedarfsgerechte Hilfen anbieten. Ggf. kann ein Projekt
für Migranten einen ergänzenden Sprachkursanteil umfassen.
Motivation und gezielte Hinführung zu Ausbildung, Qualifizierung oder Teilqualifi-
zierung (möglich in den Bereichen Lager, Lagerlogistik, Hotel, Gastronomie).
Wegen der besonderen Schwere der Vermittlungshemmnisse können auch länger-
fristig angelegte 2-jährige Projekte gefördert werden.
3. Ziel C 1.1: Vermeidung von Schulabbruch und
Verbesserung der Aus bildungs fähigkeit
3. 1 Regi onal e Ausgan g sl age f ür das spezif i sche Zi el C 1. 1
Die Förderung in diesem Ziel konzentriert sich auf schulmüde und schulverwei-
gernde Jugendliche im Schulalter sowie auf junge Menschen nach Beendigung der
9Schulpflicht, beim Übergang von Schule in Ausbildung oder Beruf, die von den
Regelsystemen nicht ausreichend begleitet und erreicht werden.
Schulverweigerung und Schulabbruch wird statistisch nicht erfasst, somit ist die
Datenlage zu diesem Ziel sehr eingeschränkt. Schüler und Schülerinnen ohne
Schulabschluss werden zwar dokumentiert, sind aber nicht gleichzusetzen mit
Mädchen und Jungen, die sich der Schule verweigern. Daher wurde dieses Ziel
nicht auf der Grundlage von statistischen Daten beraten, sondern auf der Basis
von Einschätzungen von Fachleuten aus Schule, Jugend- und Jugendsozialarbeit.
Die Beratungen in der Strategiesitzung des Arbeitskreises am 16.05.2019 bestätig-
ten einen Bedarf zur Unterstützung der Schulen im Umgang mit Schulverweige-
rern, der allerdings nicht in Zahlen konkretisiert werden konnte. Die Ursachen für
Schulverweigerung sind vielschichtig und von Fall zu Fall unterschiedlich. Überfor-
derungen der Schüler und Schülerinnen im familiären Umfeld können ebenso die
Ursache sein wie Mobbing in der Klasse oder längere krankheitsbedingte Ausfall-
zeiten und Probleme beim Wiedereinstieg in den regulären Unterricht. Eine wichti-
ge Rolle spielt das Elternhaus. Wenn Eltern die Bedeutung von Schule nicht er-
kennen und aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit oder Antriebslosigkeit den Kindern kein
Vorbild sein können, vergrößert dies das Risiko der Kinder, den Anschluss an die
Schule zu verlieren. Die Gruppe der jungen Flüchtlinge hat große Probleme, sich
überhaupt in einen geregelten Schulbetrieb einzugliedern. Wegen fehlender
Sprachkenntnisse besteht das Risiko eines Schulabbruchs sowie auch einer
Schulverweigerung.
Das Problem der Schulverweigerung betrifft Mädchen wie Jungen, mit oder ohne
Migrationshintergrund gleichermaßen, allerdings sind die Ursachen häufig ge-
schlechterspezifisch differenziert. Eine wirksame Unterstützung sollte daher ge-
schlechtersensibel agieren und auf die jeweils individuellen Probleme der Mäd-
chen und Jungen sowie ihres schulischen und familiären Umfeldes eingehen.
3. 2 Def i ni t i on der Zi el gr uppen
Die Förderung in diesem Ziel ist auf junge Menschen - in der Regel im Alter bis zu
25 Jahren - ausgerichtet, die aufgrund ihres erheblichen Förderbedarfs nicht von
anderen Maßnahmen des Übergangssystems erreicht werden können. Sie kon-
zentriert sich auf folgenden Personenkreis:
Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe, die von Schulversagen
und Schulabbruch bedroht sind und die von schulischen Regelsystemen nicht
oder nicht mehr ausreichend erreicht werden können,
10Ausbildungsferne, schwer zu erreichende und z. T. marginalisierte junge Men-
schen, die von regelhaften Angeboten der Übergangs- und Ausbildungssyste-
me bzw. der Jugendsozialarbeit und der Jugendberufshilfe nicht oder nicht
mehr ausreichend erreicht werden können.
Junge Menschen, evtl. auch ohne Schulabschluss, die arbeitslos sind, sich
aber den regulären Beratungs- und Integrationsangeboten der Jobcenter bzw.
Arbeitsagenturen entziehen.
Gerade bei der problembehafteten und oft schwer erreichbaren Zielgruppe ist eine
geschlechtersensible Ausrichtung der Förderung von besonderer Bedeutung. An-
gesichts der hohen Relevanz von geschlechterstereotypen Orientierungen der
Zielgruppe können in diesem Förderziel auch geschlechterspezifische Konzepte
zum Einsatz kommen.
3. 3 Anf or d er ungen an Pr ojekt e
Ziel der Förderung ist die individuelle und soziale Stabilisierung der Jugendlichen.
Im Vordergrund stehen dabei das Erreichen eines Schulabschlusses und/oder die
Integration in Maßnahmen der Berufsvorbereitung oder in eine berufliche Ausbil-
dung.
Es bietet sich an, Projekte, die der Unterstützung, Stabilisierung und Förderung
schwer zu erreichender junger Menschen dienen, auf der Grundlage des § 16h
SGB II und in enger Kooperation mit dem Jobcenter zu entwickeln und abzustim-
men, sowie die Kooperation mit Jugendhilfe und Arbeitsförderung in diesem Ziel
zu nutzen.
Die Ziele sollen über folgende Maßnahmen erreicht werden:
Sozialpädagogische Begleitung, die auch das familiäre und häusliche Umfeld
sowie die lebensweltlichen Bezüge der jungen Menschen im Blick hat, um die
Schüler/innen wieder an die Schule heranzuführen und sie so zu integrieren,
dass sie einen regulären Schulabschluss erreichen. Bei Teilnehmer/innen ohne
Schulabschluss ist die nachträgliche Erlangung des Schulabschlusses ein we-
sentliches konzeptionelles Merkmal der Förderung.
Durch konkrete Hilfestellung und Beratung und Begleitung sollen arbeitslose
Jugendliche, die sich den Beratungs- und Integrationsangeboten der Jobcenter
bzw. Arbeitsagenturen entziehen, wieder in einen geregelten Beratungs- und
Vermittlungsprozess eingegliedert werden.
11Niedrigschwellige und praxisbezogene Angebote sollen zur individuellen und
sozialen Stabilisierung beitragen und auf eine realistische Perspektive für Aus-
bildung und Beruf hinwirken. Junge Menschen, die ihre Schulpflicht bereits er-
füllt haben, können auch im Rahmen berufsvorbereitender Bildungsmaßnah-
men mit produktionsorientiertem Ansatz gefördert werden.
Der Schwerpunkt liegt auf eine individuelle Förderung. Berufsorientierung kann
lediglich ein Bestandteil einer Maßnahme sein.
4. Querschnittsziele
Für beide spezifischen Ziele sind die folgenden Querschnittsziele in den Projekten
zu berücksichtigen:
Gleichstellung von Frauen und Männern: Frauen und Männern soll ein glei-
cher Zugang zu Leistungen der Arbeitsmarktpolitik und ins Erwerbsleben ge-
währleistet werden. Der Projektaufruf will hierzu einen spezifischen Beitrag
leisten. Bei der Planung und Durchführung der Projekte sollen die spezifischen
Bedarfe und Ausgangssituationen von alleinerziehenden Frauen berücksichtigt
werden. Beispiele für Instrumente und Methoden finden Sie in der Online-
Materialsammlung der Agentur für Gleichstellung im ESF auf der Webseite
www.esf-gleichstellung.de.
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung: Durch die Fokussierung auf
bildungsferne und z. T. gesellschaftlich marginalisierte junge Menschen, darun-
ter insbesondere solche mit Migrationshintergrund, soll die Förderung in die-
sem spezifischen Ziel einen besonderen Beitrag zur Chancengleichheit und
Nichtdiskriminierung leisten.
Ökologische Nachhaltigkeit: Bereits in der Förderperiode 2007-2013 hat sich
gezeigt, dass Themen der ökologischen Nachhaltigkeit bei dieser Zielgruppe
gut in das Maßnahmenangebot integriert werden können, etwa im Rahmen na-
turnaher erlebnispädagogischer Module. Der expandierende Markt der Green
Jobs kann zudem für Teilnehmende an den geförderten Maßnahmen Berufs-
perspektiven auf unterschiedlichen Qualifikationsebenen bieten.
Soziale Innovation: Der ESF dient der Entwicklung von innovativen arbeits-
marktpolitischen Ansätzen, z.B. durch neue Wege der Zielgruppenerreichung
oder neue Kooperations- und Kommunikationsformen.
125. Umsetzung der Ziele
5. 1 Budget
Dem Main-Tauber-Kreis stehen für den Förderzeitraum 2014 – 2020 jährlich
180.000 € an ESF-Mitteln zur Verfügung. Resultierend aus der letztjährigen Aus-
schreibung sind für das Förderjahr 2020 Mittel in Höhe von rd. 137.182 € verfüg-
bar.
Es werden sowohl im Ziel B1.1 als auch im Ziel C1.1 zweijährige Projekte geför-
dert.
Der regionale Arbeitskreis ist gehalten, eine Verteilung der bereitstehenden För-
dermittel im Verhältnis von 58% im Ziel B1.1 und 42% im Ziel C1.1 zu berücksich-
tigen. Dies stellt aber keine zwingende Vorgabe für die Projektauswahl dar.
5. 2 Unt er gr enze f ür Pr ojekt kost en
In der diesjährigen Ausschreibungsrunde 2020 gilt eine Mindestgrenze von
30.000 € an öffentlicher Unterstützung und eine Förderung von mindestens 10
Teilnehmenden. Das bedeutet, dass nur regionale Anträge bewilligt werden, deren
öffentliche Unterstützung oberhalb der Schwelle von 30.000 € liegt. Als öffentliche
Unterstützung zählen dabei ESF-Mittel sowie aktive Kofinanzierungen aus Mitteln
des Bundes, Landes oder der Kommunen (nicht von Dritten an Teilnehmer gezahl-
te Beiträge, z. B. Alg II-Leistungen).
Entscheidend sind hierbei die im Bewilligungsbescheid aufgeführten Beiträge.
Falls sich dann im Schlussverwendungsnachweis aufgrund von Abweichungen
des realen Projektverlaufs abweichende Beträge ergeben, ist dies unschädlich.
5. 2 Au sw ahl der Pr ojekt e
Auf der Basis der im ESF Arbeitskreis beschlossenen ESF- Arbeitsmarktstrategie
wird die Ausschreibung für die Projektanträge 2020 veröffentlicht. Geeignet für die
Gesamtdarstellung der Strategie sind die Internet-Website des Landratsamtes,
sowie ein Verweis darauf in der Regionalzeitung. Die eingehenden Projektanträge
werden in der Rankingsitzung des Arbeitskreises auf der Grundlage der regionalen
Arbeitsmarktstrategie und eines standardisierten Ranking-Verfahrens bewertet.
Entscheidende Kriterien für die Auswahl der Projekte sind
13die Übereinstimmung der Projektanträge mit den regionalen
Arbeitskreiszielen und den Zielgruppen,
sowie den Querschnittszielen.
Erwartet werden gendersensible Projektanträge sowie der Einsatz von Personal
mit Genderkompetenz bzw. der Bereitschaft, dies zeitnah durch Fort- und Weiter-
bildungen zu erwerben.
6. Festlegung der Schritte zur Evaluation
Die Erreichung der festgelegten Ziele des Arbeitskreises, der Projektziele ein-
schließlich des Querschnittsziels der Gleichstellung wird überprüft durch das fol-
gende Vorgehen:
Den Abgleich des bewilligten Antrags mit dem Sachbericht im Verwendungs-
nachweis des jeweiligen ESF-Projekts. Die Geschäftsstelle leitet den Arbeits-
kreismitgliedern die Sachberichte zu.
Vorstellen der Projektergebnisse im Rahmen der regionalen Ergebnissiche-
rung bzw. Rankingsitzung bei laufenden Projekten
Vor-Ort Besuche bei den Projektträgern durch die ESF-Geschäftsstelle
14Sie können auch lesen