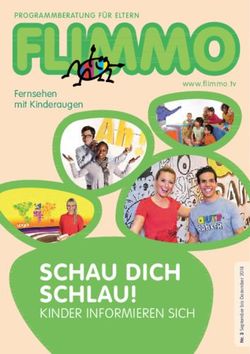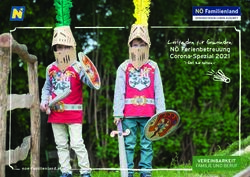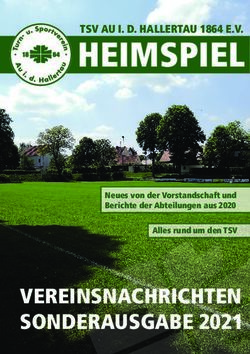Richtlinien zur interkulturellen Arbeit - mit dem Schwerpunkt "Sprachförderung in Kindertagesstätten"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stadt Koblenz
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Jugendamt
Richtlinien zur interkulturellen Arbeit
mit dem Schwerpunkt „Sprachförderung in Kindertagesstätten“
für Kinder ohne ausreichende DeutschkenntnisseAmt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
Richtlinien zur interkulturellen Arbeit
mit dem Schwerpunkt
„Sprachförderung in Kindertagesstätten“
für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse
Impressum
Herausgeber Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
- Jugendamt -
Schängel-Center
Rathauspassage 2
56068 Koblenz
Telefon (0261) 129-2329
Fax (0261) 129-2300
E-Mail jugendamt@stadt.koblenz.de
Herstellung Hausdruckerei der Stadt Koblenz
Auflage 250
Koblenz, im März 2011
-2-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
Inhalt
RICHTLINIEN ZUR INTERKULTURELLEN ARBEIT ....................................................................................................... 1
MIT DEM SCHWERPUNKT „SPRACHFÖRDERUNG IN KINDERTAGESSTÄTTEN“ FÜR KINDER OHNE AUSREICHENDE
DEUTSCHKENNTNISSE ........................................................................................................................................... 1
I. Allgemeines ............................................................................................................................................ 6
II. Konzeptionelle Anforderungen............................................................................................................. 6
II.1. Ziele und Aufgaben interkultureller Arbeit .......................................................................................... 6
II.2. Menschen mit Migrationshintergrund – Begriffsverwendung........................................................... 8
II.3. Sprache und Sprachförderung ............................................................................................................. 8
II.3.1. Bedeutung der Anderssprachigkeit für die interkulturelle Arbeit in Kindertagesstätten............... 8
II.3.2. Die Bedeutung der Familiensprache.................................................................................................... 9
II.3.3. Die Bedeutung der deutschen Sprache für den Erziehungs- und Bildungsprozess ...................... 9
II.3.4. Sprachförderung im Alltag.................................................................................................................. 10
II.4. Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ Rheinland-Pfalz ............ 10
II.5. Förderung der Zweitsprache Deutsch durch Sprachförderprogramme......................................... 11
II.5.1. SISMIK – Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindergärten
(Sprachstanderfassungsbogen) ......................................................................................................... 12
II.5.2. SELDAK – Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern...... 12
II.5.3. Würzburger Trainingsprogramm ........................................................................................................ 12
II.5.4. Zweitspracherwerb im Kindergarten nach Roger Loos ................................................................... 13
II.5.5. Sprachförderprogramm „Wir verstehen uns gut – Spielerisch Deutsch lernen“.......................... 13
II.5.6. Landesinformationen........................................................................................................................... 14
II.6. Zusammenarbeit mit den Eltern ......................................................................................................... 14
II.7. Zusammenarbeit mit der Grundschule .............................................................................................. 14
II.8. Vernetzung............................................................................................................................................ 15
II.8.1. Vernetzung im Stadtteil ....................................................................................................................... 15
II.8.2. Kooperation und Vernetzung im Programm „Soziale Stadt“ .......................................................... 15
II.8.3. Kooperation und Vernetzung mit der Arbeitsgruppe Kindertagesstätten und dem
Jugendhilfeausschuss der Stadt Koblenz......................................................................................... 15
II.8.4. Kooperation und Vernetzung mit den Migrationsdiensten der Wohlfahrtsverbände ................... 15
II.8.5. Kooperation und Vernetzung mit den Mitgliedern des Beirats für Migration und Integration..... 16
II.8.6. Kooperation mit den Bildungsträgern in der Stadt Koblenz ........................................................... 16
II.8.7. Gemeinsamer Arbeitskreis der Fachkräfte für interkulturelle Arbeit ............................................. 16
II.8.8. Kooperation und Vernetzung mit der Wissenschaft ........................................................................ 16
III. Rahmenbedingungen für die interkulturelle Arbeit .......................................................................... 16
III.1. Räume ................................................................................................................................................... 17
III.2. Arbeitsmaterial ..................................................................................................................................... 17
III.3. Rolle und Selbstverständnis der Fachkräfte für interkulturelle Arbeit........................................... 17
III.4. Rolle und Aufgaben der Leitung......................................................................................................... 19
III.5. Ausgewogene Verteilung der Migrantenkinder im Sozialraum....................................................... 19
IV. Rechtliche Grundlagen........................................................................................................................ 21
IV.1. UN-Kinderrechtskonvention ............................................................................................................... 21
-3-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
IV.2. Bundesgesetze ..................................................................................................................................... 22
IV.3. Landesgesetz und -verordnung.......................................................................................................... 22
V. Kriterien zur Bemessung des Personalbedarfs an Fachkräften für interkulturelle Arbeit in
Kindertagesstätten ............................................................................................................................... 24
VI. Finanzierung ......................................................................................................................................... 24
VI.1. Finanzierung der Zusatzkraft für interkulturelle Arbeit nach der Landesverordnung .................. 24
VI.2. Weitere Fördermöglichkeiten.............................................................................................................. 25
VI.3. Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ .................................................................... 25
VII. Antragsverfahren.................................................................................................................................. 25
VIII. Bewilligung ........................................................................................................................................... 25
IX. Verwendungsnachweis........................................................................................................................ 26
X. Inkrafttreten........................................................................................................................................... 26
Anlagen............................................................................................................................................................ 27
KONTAKTADRESSEN ........................................................................................................................................... 35
-4-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
-5-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
evangelischen Träger unterstützt wurde. Die
I. Allgemeines gemeinsam erarbeitete Neufassung wird hiermit
vorgelegt.
Am 26.05.2004 hat der Jugendhilfeausschuss die
Richtlinien zur Integrationsarbeit mit Kindern ohne
ausreichende Deutschkenntnisse in Kindertages-
stätten mit dem Schwerpunkt der II. Konzeptionelle
Sprachförderung beschlossen und damit ein Anforderungen
Zeichen dafür gesetzt, dass die Integration und
Förderung dieser Kinder ein besonderes II.1. Ziele und Aufgaben
Augenmerk verdient. Gleichzeitig wurde die interkultureller Arbeit
Anzahl der in den Koblenzer Einrichtungen be-
schäftigten Fachkräfte für interkulturelle Arbeit Im Leitbild der Stadt Koblenz ist die Förderung
von 4 auf 8 erhöht. Seither wurde dieses interkulturellen Lebens festgeschrieben. Dies
Kontingent, zuletzt durch Beschluss des JHA vom meint einerseits die Integration in die
03.09.2008, auf 15 Personalstellen aufgestockt. Aufnahmegesellschaft und die Partizipation der
Einwanderer am Leben in der
Die Arbeit der Fachkräfte für interkulturelle Arbeit Aufnahmegesellschaft, andererseits das Lernen
wurde im Zusammenwirken aller Träger und Ein- von Offenheit und Achtung vor anderen Kulturen
richtungen und mit Unterstützung des und Religionen durch die Aufnahmegesellschaft.
Jugendamtes evaluiert. Hierbei wurde deutlich, Ein Leitziel des Jugendamtes zielt darauf ab, die
dass die Richtlinien, deren Beachtung bei der Integration zu verstärken, ohne die eine Chan-
fachlichen und sachgerechten Ausgestaltung der cengleichheit im gesellschaftlichen Miteinander
Arbeit vorausgesetzt wird, die aber auch nicht zu erreichen ist.
Bewilligungs- und Bemessungsgrundlage für die
Genehmigung des Zusatzpersonals sind, in Im Verständnis eines interkulturellen Lernens wird
einigen Punkten überarbeitet werden sollten. Integration nicht als einseitige Anpassung oder
Assimilation bestimmt, sondern als ein
Am 26.02.2006 verabschiedete der wechselseitiger gegenseitiger Lernprozess, der
Landesjugendhilfeausschuss seine Empfehlungen auch die dominierende Kultur verändert.
„Zusätzliche Fachkräfte für interkulturelle Arbeit in Integration soll als ein offener Austausch
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“, auf die in verstanden werden, in dem vor allem die positiven
einigen Kapiteln Bezug genommen wurde. Elemente beider Kulturen erhalten bleiben.
Im Zuge des Landesprogramms „Zukunftschance Auf diesem Hintergrund hat die interkulturelle
Kinder – Bildung von Anfang an“ legte das Land Arbeit in Kindertageseinrichtungen eine immer
ein Sprachförderprogramm vor, das sich größere Rolle. Sie richtet sich an alle Kinder,
schwerpunktmäßig an Kinder im letzten deutsche und ausländische. Ein wichtiges Ziel
Kindergartenjahr wendet. Die Verbindung dieses und eine wichtige Aufgabe dabei ist die
Programms mit der interkulturellen Arbeit musste Entwicklung einer interkulturellen Kompetenz.
daher in den Blick genommen werden. Inländer und Migranten, Kinder und Erwachsene
(Eltern, pädagogische Fachkräfte, Verwandte
Von daher wurde eine Überarbeitung der usw.) sind dabei wichtige Zielgruppen. Konkret
Richtlinien notwendig, bei der die Verwaltung von geht es darum jedes einzelne Kind auf dem
Vertreterinnen und Vertreter der katholischen und Hintergrund seiner familiären Erfahrungen und
-6-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
Möglichkeiten anzunehmen, es in seiner Sprache schafft den Zugang zu anderen
Entwicklung zu unterstützen und zu fördern und Bildungsbereichen, ermöglicht die Stärkung
die multikulturelle Zusammensetzung der Gruppe sozialer Kompetenz und führt zu einer größeren
als Erfahrungsfeld und Lernort für einen positiven Teilhabe an Bildung. Dies hat positive
respektvollen und selbstverständlichen Auswirkungen auf die Erziehungskompetenz der
alltäglichen Umgang zu nutzen. Interkulturelle Kinder als zukünftige Eltern, sowie auf die
Arbeit will damit zu einem produktiven beruflichen Chancen und führt zu einer höheren
Miteinander verschiedener Kulturen und Ethnien Lebensqualität.
anregen und bei der Wahrung und Pflege jeder
eigenen kulturellen Tradition Formen einer neuen Im jüngeren Alter erlernen Kinder besonders
gemeinsamen Alltagskultur entwickeln. leicht und dazu spielerisch die deutsche Sprache.
Der pädagogische Alltag im Kindergarten bietet
Dem Erwerb der deutschen Sprache einerseits im Besonderen Kindern aus Migrantenfamilien die
und dem respektvollen, wertschätzenden Umgang Möglichkeit, im sozialen Umgang mit Kindern und
mit anderen Mutter- oder Familiensprachen Erwachsenen spielerisch die deutsche Sprache
andererseits kommt dabei eine große Bedeutung zu erlernen.
zu.
Daher sind Kindergarten (und Schule) besonders
„Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Be- bedeutsame Orte für den Spracherwerb.
ziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen und diese
dadurch zu verstehen. Von besonderer Deshalb fördert die Stadt Koblenz mit diesen
Bedeutung ist dabei das soziale Umfeld. Über die Richtlinien und den darin festgeschriebenen
Beziehung zu besonders vertrauten Personen Voraussetzungen im Integrationsprozess
wird Sprache erworben, über Sprache bildet das besonders die Vermittlung der deutschen Sprache
Kind seine Identität aus und entwickelt seine für Kinder in den Kindertagesstätten. Gemeint
Persönlichkeit weiter. …“ 1 sind hierbei insbesondere die Kindergärten; eine
Förderung in Horten und Spiel- und Lernstuben
In diesem Kontext steht es außer Frage, dass der kann nur in begründeten Einzelfällen genehmigt
Kenntnis der deutschen Sprache bei der werden.
Integration eine herausragende Bedeutung
zukommt. Sprachkenntnisse sind nicht nur die Wenn Eltern selbst oder nur unzureichend
Voraussetzung für Lernen, sondern auch für Deutsch können, können sie ihre Kinder beim
Kommunikation, Verständigung, für gegenseitiges Zweitsprachenerwerb nicht unterstützen. Die
kennen lernen. Sprache ebnet den Weg in die Familie wird durch dieses Spannungsfeld
Aufnahmegesellschaft und lässt an ihr teilhaben. zusätzlich belastet.
Eine größtmögliche Teilhabe aber lässt eine
soziale Benachteiligung durch Ausgrenzung und Kindertagesstätten und Schulen haben als
mangelnde Partizipation erst gar nicht entstehen Kontaktstellen zu Familien mit
und kann dazu beitragen, vorhandene Migrationshintergrund eine besondere
Benachteiligungen abzubauen. Schlüsselposition. Sie sind die zentrale Instanz,
über die der Kontakt mit der Aufnahmege-
sellschaft stattfindet. Deshalb soll mit der
Sprachförderung für Kinder auch eine
1 Sprachförderung der Eltern einhergehen.
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend: Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland- Geeignete Maßnahmen sollen in Zusammenarbeit
Pfalz, Kap. 2.1.
-7-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
mit anderen Institutionen ortsnah durchgeführt Kinder lernen zunächst die Sprache, die in der
werden. Sie sind eine sinnvolle Familie gesprochen wird und treten häufig erst in
Unterstützungsmaßnahme für den den Kindertagesstätten mit der deutschen
Integrationsprozess. Sprache in Kontakt, wobei das Sprachvermögen
der Kinder in ihren Familiensprachen ganz
Deshalb verbindet die Stadt Koblenz bei der erheblich divergiert. Selten kommen Kinder mit
Sprachförderung in Kindergärten die Erwartung Bilingualität hinzu.
an die Träger, auch begleitende
Sprachförderangebote für Eltern zu vermitteln. Weiterhin befinden sich im überwiegenden Teil
der Kindertagesstätten eine Vielzahl von Kindern
Die Förderung nach diesen Richtlinien erfolgt im unterschiedlicher Nationalitäten oder Ethnien mit
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts- einer Vielzahl von Sprachen.
mittel und setzt voraus, dass die formellen,
inhaltlichen und fachlichen Vorgaben dieser Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Arbeit
Richtlinien erfüllt werden. Nähere Einzelheiten in Kindertagesstätten.
sind den entsprechenden Kapiteln zu entnehmen.
Wesentlicher Faktor beim Spracherwerb ist die
Zeit. Ein Kind braucht sowohl beim Erst- wie auch
beim Zweitspracherwerb oder auch bei
II.2. Menschen mit zeitgleichem Erwerb von zwei Sprachen Zeit, um
Migrationshintergrund – eine Sprache zu erlernen und durchläuft anfangs
häufig eine Zeit der scheinbaren Sprachlosigkeit
Begriffsverwendung
bis es über Reproduktionsmöglichkeiten verfügt.
Es wird auf das Kapitel 1.1., Seite 6 der Landes-
Zum grundlegenden Spracherwerb hinsichtlich
empfehlungen verwiesen. Die dortige Begriffsklä-
der Einschulung von Kindern sind sowohl ein
rung wird als Grundlage für diese Richtlinien über-
mehrjähriger regelmäßiger Aufenthalt in einer
nommen.
Kindertagesstätte sowie eine hohe Qualität der
Förderung wesentliche Erfolgsfaktoren.
Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Beziehung
II.3. Sprache und Sprachförderung des Kindes zu seinem Umfeld, die Sprache und
II.3.1. Bedeutung der Anderssprachig- Spracherwerb erst ermöglicht und die sowohl den
Eltern, der Erzieherin/dem Erzieher wie auch den
keit für die interkulturelle Arbeit in
anderen Kindern der Gruppe eine enorme Bedeu-
Kindertagesstätten
tung zuweist.
Anderssprachig zu sein bedeutet eine andere
Hier zeigt sich einerseits die gegenseitige
Muttersprache zu haben, als die Sprache des
Akzeptanz und Wertschätzung der
Landes in dem man lebt oder sich zum
Anderssprachigkeit auf Seiten des Fachpersonals
gegebenen Zeitpunkt aufhält.
wie der Eltern als wesentlich für den
Spracherwerb durch das Kind. Der Erzieherin /
Bei den Kindern mit Migrationshintergrund, die die
dem Erzieher kommt die Rolle zu, eine Beziehung
Kindertagesstätten besuchen, handelt es sich in
und Bindung zu ermöglichen die den Sprach-
den meisten Fällen um Kinder mit einem so
erwerb aktiv fördert. Es zeigt sich auch immer
genannten zeitversetzten Spracherwerb, d.h. die
-8-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
wieder deutlich, dass Beziehungen zwischen II.3.3. Die Bedeutung der deutschen
Kindern bedeutsam für das sprachliche Verhalten Sprache für den Erziehungs- und
sind, und dass Kinder sowohl von Älteren als Bildungsprozess
auch von Jüngeren lernen.
In diesem Kontext steht es außer Frage, dass der
II.3.2. Die Bedeutung der Kenntnis der deutschen Sprache bei der
Familiensprache Integration eine herausragende Bedeutung
zukommt. Der Erwerb der deutschen Sprache ist
Die Erst- oder Familiensprache ist die Sprache, ein Garant für erfolgreiches Lernen, für
die man als Kind zuerst erlernt, weil sie von den Kommunikation und Verständigung und
Hauptbezugspersonen als einzige oder erste gegenseitiges kennen lernen. Der Erwerb der
Sprache gesprochen wird. Es handelt sich also deutschen Sprache trägt damit vor allem im
um die Sprache, mit deren Hilfe die Bereich der Bildung wesentlich zur Chancen-
Persönlichkeitsentwicklung (Identität, Werte und gleichheit bei.
Kultur) gesteuert wird, und zwar in Richtung einer
Aneignung der Handlungsweisen, Der pädagogische Alltag in der Kindertagesstätte
Handlungsnormen, Wertvorstellungen, geistigen bietet im Besonderen Kindern aus
Inhalte und Strukturen, die für die Gesellschaft Migrantenfamilien die Möglichkeit, im sozialen
typisch sind, die diese Sprache als Umgang mit Kindern und Erwachsenen
sozialkulturelles Produkt hervorgebracht hat und spielerisch die deutsche Sprache zu erlernen.
die diese Sprache als Handlungsmittel im Gezielte Förderung durch die Erzieherinnen und
Rahmen ihrer spezifischen Verhältnisse benutzt. Erzieher sind begleitend im Alltag der
Vom Sprachlernergebnis her gesehen ist die Kindertagesstätte verankert. Voraussetzung für
Erstsprache die Sprache, die man sich eindeutig eine gelingende interkulturelle Verständigung und
vollständiger und richtiger angeeignet hat als Teilhabe aller Kinder an Bildung ist die
irgendeine andere Sprache. Die Erstsprache ist Wertschätzung der jeweils eigenen Muttersprache
schließlich die Sprache, die man spontan am in Kindertagesstätten, ggf. deren Förderung.3
ehesten anwendet, in der man vorrangig denkt
und träumt.2 Aus entwicklungs- und lernpsychologischen Grün-
den ist bekannt, dass jüngere Kinder besonders
Die Familiensprache gehört für fremdsprachige leicht die deutsche Sprache erlernen. Sorgfältig
Kinder zu ihrer Identität, sie stellt die Verbindung ausgewählte Sprachförderprogramme, die mit der
zu den Eltern und der Herkunft dar und darf jeweiligen konzeptionellen Arbeit im Kindergarten
deshalb nicht vernachlässigt oder abgewertet harmonieren, unterstützen dabei das Erlernen der
werden. Sprache. Hierauf wird in Kapitel II.5 gesondert
eingegangen.
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse spielt
im Interesse einer gelingenden kulturellen Kindergärten sind deshalb besonders
Verständigung die Wertschätzung, Akzeptanz, ja bedeutsame Orte für den Spracherwerb und
sogar Pflege einer jeweils eigenen Muttersprache haben als Kontaktstellen zu Familien mit
eine wichtige Rolle. Migrationshintergrund eine besondere
Schlüsselposition. Sie sind die zentrale Instanz,
3
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend: Bildungs- und
2
Roger Loos; Zweitspracherwerb im Kindergarten; S. 10, Pkt. Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-
1.41 Pfalz (Diskussionsentwurf 2003), Kap. 2.7.
-9-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
über die der Kontakt mit der Aufnahmege- II.4. Landesprogramm
sellschaft stattfindet. „Zukunftschance Kinder –
Bildung von Anfang an“
Rheinland-Pfalz
II.3.4. Sprachförderung im Alltag
Nach § 2 a Absatz 2 KitaG soll im letzten Kinder-
Viele Ressourcen der Sprachförderung liegen in gartenjahr nach Maßgabe der jeweiligen
der Kommunikation und Begleitung der Kinder Konzeption insbesondere der Übergang zur
durch die pädagogischen Fachkräfte, in der Schule vorbereitet und über die allgemeine
Begegnung der Kinder untereinander, in der Förderung nach § 2 hinaus die Sprachentwicklung
Zusammenarbeit mit den Eltern, aber auch in der der Kinder beobachtet und durch gezielte
Gemeinwesenorientierung und der Gestaltung Bildungsangebote gefördert werden.
des Tagesablaufes. Selbst die Raumgestaltung
kann zur Sprachförderung genutzt werden, indem Im Rahmen des Landesprogramms
sie sprachanregend gestaltet wird. Insgesamt „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“
geht es darum Sprachförderung in die hat das Ministerium für Bildung, Frauen und
Gesamtkonzeption der interkulturellen Erziehung Jugend ein eigenes Programm zur
der Kindertageseinrichtung zu integrieren. Sprachförderung und Maßnahmen des
Übergangs zur Grundschule aufgelegt. Dabei
handelt es sich um
Förderung der Zweitsprache Deutsch
Landeszuschüsse, für
Individuelle Förderung
Maßnahmen zur
Weckung von Interesse für andere Sprachen
pädagogischen Auf-
bei deutschen Kindern
wertung des letzten
positives Einbeziehen der Familiensprache(n)
Kindergartenjahres, unter
in den Alltag der Einrichtung durch
besonderer Be-
muttersprachliche Angebote und Förderung
rücksichtigung der Sprachförderung. Die Förder-
maßnahmen richten sich an Kinder, die in der
Als Grundsatz der Sprachförderung gilt das
deutschen Sprache Förderbedarf haben,
Prinzip der ganzheitlichen Förderung der Kinder,
insbesondere an Kinder nicht deutscher
d.h. der Schwerpunkt „Sprachförderung“ ist
Herkunftssprache.
eingebettet und verzahnt mit anderen
Schwerpunkten, die sich gegenseitig bedingen
Anträge für diese Landesförderung stellt der
und stützen, wie z.B. Sprachförderung in der
Träger jeweils zum 15. Januar eines jeden Jahres
Musik- und Bewegungserziehung. Sprach-
für das darauf folgende Kindergartenjahr und stellt
förderung ist Inhalt eines jeden Lernszenariums
in diesem Antrag den Bedarf an Sprachförderung
im Elementarbereich und ist ein unverzichtbarer
für Basis- bzw. Intensivmodule dar. Die
Baustein in allen pädagogisch begleiteten
Voraussetzungen für die Beantragung und
Handlungen des Kindes und damit als
Umsetzung sind in der Verwaltungsvorschrift des
Querschnittsaufgabe zu verstehen.
Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend vom
28. Dezember 2005 über die Förderung von
Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten sowie
von Maßnahmen der Vorbereitung des
- 10 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Der Einsatz einer Fachkraft für interkulturelle
festgelegt. Arbeit schließt den Einsatz einer
Sprachförderfachkraft über das Landesprogramm
Es werden verschiedene Module gefördert: nicht aus. In Kindertagesstätten, in denen beide
Fachkräfte beschäftigt sind, ist eine enge
Modul 1: Basiskurs Kooperation zwingend erforderlich. Die
zusätzliche Sprachförderkraft ist zuständig für die
100 Förderstunden zur Förderung der Kinder in Kinder im letzten Kindergartenjahr. Dies eröffnet
Kleingruppen. der Fachkraft für interkulturelle Arbeit die
Möglichkeit, sich in der Sprachförderung stärker
Der Basiskurs ist ein Angebot für Kinder mit gerin- auf die anderen Altersgruppen zu konzentrieren.
gem Förderbedarf; die Höhe der Förderung Daraus ergibt sich, dass in der Einrichtung
beträgt 2.000,- € für Personalkosten und 50,- € für verbindliche Absprachen zum Übergang in die
Materialkosten. Sprachfördermaßnahmen im letzten
Kindergartenjahr getroffen werden müssen. Die
Modul 2: Intensivkurs Fachkräfte stimmen sich über das
Gesamtkonzept der Sprachförderung und die
200 Stunden zur Förderung der Kinder jeweilige methodische Durchführung ab.
Kleingruppen sowie Einzelförderung. Unabhängig von der Anstellungsträgerschaft
untersteht die zusätzliche Sprachförderkraft der
Den Intensivkurs besuchen Kinder mit größerem Einrichtungsleitung und bindet ihre Arbeit in das
Förderbedarf; die Höhe der Förderung beträgt bestehende pädagogische Konzept ein.
4.000,- € für Personalkosten und 50,- € für
Materialkosten. Die konkrete Verteilung der Module auf die einzel-
nen Kindertagesstätten erfolgt jährlich in
Modul 3: Maßnahmen zum Übergang vom Absprache zwischen dem Jugendamt der Stadt
Kindergarten zur Grundschule. Koblenz und den Fachberatungen der
Kindertagesstätten. Die Anträge müssen jährlich
Diese Maßnahmen können individuell beantragt bis zum 15. Januar beim Jugendamt der Stadt
und konzipiert werden. Koblenz gestellt werden.
Die Auswahl eines geeigneten Instrumentes oder
Programms zur gezielten Sprachförderung obliegt
dem jeweiligen Träger der Kinder- II.5. Förderung der Zweitsprache
tageseinrichtung. Wichtig bei der Entscheidung Deutsch durch
für ein Sprachförderprogramm ist die schlüssige
Sprachförderprogramme
Einordnung des Programms in den
pädagogischen Ansatz der Kindertagesstätte und
Sprachförderprogramme bieten eine Möglichkeit
das Verständnis der interkulturellen Arbeit.
den Erwerb der deutschen Sprache systematisch
Pädagogischen Prinzipien wie Ganzheitlichkeit,
zu erlernen.
Ressourcenorientierung und die Berücksichtigung
individueller Entwicklungs-, Bildungs- und
Ob und welches Programm ausgewählt wird,
Lernprozesse werden dabei nicht aufgegeben.
bleibt der Einrichtung und dem Träger überlassen.
Auf jeden Fall muss das Sprachförderprogramm
in die Konzeption der Kindertageseinrichtung
- 11 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
integriert werden. Nachfolgend werden Der Bogen gibt den Mitarbeiterinnen über eine ge-
verschiedene Sprachförderprogramme, die in der zielte Beobachtung von sprachrelevanten
Fachöffentlichkeit zurzeit diskutiert werden, zur Situationen die Möglichkeit, Kinder in ihrem
Orientierung genannt und beispielhaft erläutert. sprachlichen Verhalten kennen zu lernen,
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Einige einzuschätzen und die Stärken zu entdecken.
Programme werden kurz erläutert.
Der Bogen ist darauf ausgerichtet Entwicklungen
SISMIK (Sprachstandserfassungsbogen): in den Blick zu nehmen und keine
Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Momentaufnahme zu spiegeln.
Migrantenkindern in Kindergärten.
SELDAK: Sprachentwicklung und Literacy bei
deutschsprachig aufwachsenden Kindern
Würzburger Trainingsprogramm II.5.2. SELDAK – Sprachentwicklung
Krefelder Sprachförderprogramm und Literacy bei deutschsprachig
Sprachförderung nach Roger Loos aufwachsenden Kindern
Wir verstehen uns gut – spielerisch Deutsch
lernen Dieser Sprachbeobachtungsbogen wurde vom
GASPER: Ganzheitliche Sprach-Erziehung, Staatsinstitut für Frühpädagogik in München für
KitagGmbH Koblenz deutsche Kinder bzw. Kinder, die mit Deutsch als
PES: Programm für elementare Erstsprache (Muttersprache) aufwachsen, entwi-
Sprachförderung, UNI Koblenz ckelt. Er ist in seiner Struktur mit SISMIK
Weitere Sprachstandserhebungsverfahren und vergleichbar und zielt auf eine langfristige,
Sprachförderprogramme in: prozessorientierte Beobachtung und Begleitung
K. Jampert, P. Best, A. Gaudatiello, D. Holler, der Sprachentwicklung. Im Hinblick auf die
A. Zehnbauer: Schlüsselkompetenz Sprache. Zielgruppe für diesen Beobachtungsbogen, die
Verlag „das netz“ nur bedingt auch Zielgruppe im Rahmen der
interkulturellen Arbeit ist, wird darauf verzichtet,
an dieser Stelle auf nähere Einzelheiten
einzugehen.
II.5.1. SISMIK – Sprachverhalten und
Interesse an Sprache bei
Migrantenkindern in Kindergärten
(Sprachstanderfassungsbogen) II.5.3. Würzburger Trainingsprogramm
Der Titel macht deutlich, dass es sich hier um „Würzburger Trainingsprogramm zur phonologi-
einen Beobachtungsbogen handelt, der die schen Bewusstheit und Sprachprogramm zur
sprachliche Kompetenz von Kindern mit einer Buchstaben-Laut-Verknüpfung“
nicht deutschen Familiensprache in den Blick
nimmt. Der Unterschied zu vielen anderen zurzeit Die Spiele und Übungen des Würzburger
eingesetzten Bögen zur Sprachstandserfassung Trainingsprogramms vermitteln den Kindern einen
liegt vor allem darin, dass es hier um „die Lust an Einblick in die Struktur der gesprochenen
Sprache“ geht. Kinder lernen grundsätzlich in Sprache. Sie lernen ihre Aufmerksamkeit von der
Situationen, in denen sie sich ganz und gar darauf Bedeutung der Mitteilung abzuwenden und auf
einlassen, sich engagieren. die formalen Eigenschaften zu lenken, also auf
den Klang der Wörter beim Reimen, auf Wörter
- 12 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
als Teile von Sätzen, auf Silben und letztendlich den Sprachlernspielen
vor allem auf einzelne Laute (Phoneme). Die
Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für Das Sprachtraining erfolgt in Kleingruppen, die
den Erfolg eines Kindes beim Lesen- und nach folgenden Kriterien eingeteilt werden:
Schreibenlernen konnte in den letzten Jahren in
einer Reihe von wissenschaftlichen Studien nach- sprachliche Kompetenz
gewiesen werden. Beziehungen der Kinder untereinander
(Freundschaften, Bekannte)
Das Training wird bereits in vielen Kindergärten Entwicklungsstand
von Erzieherinnen mit Kleingruppen durchgeführt.
Voraussetzung für den Erfolg des Das Training erfolgt täglich für ca. 10 Minuten mit
Gruppentrainings ist die Einhaltung der Struktur derselben Kleingruppe. Die Kinder verbleiben in
des Programms, die eine Durcharbeitung aller diesen Gruppen für mindestens ein Jahr, bis
Trainingseinheiten in täglichen Sitzungen von 10 wieder neue Kinder aufgenommen und die
Minuten über einen Zeitraum von insgesamt 20 Gruppen bei Bedarf und Notwendigkeit neu
Wochen vorsieht. zusammengesetzt werden. Dies ist z.B. abhängig
vom Lerntempo des einzelnen Kindes. Die
Dokumentation über den Entwicklungsverlauf
eines jeden Kindes wird in Beobachtungsbögen
II.5.4. Zweitspracherwerb im festgehalten und stichwortartig nach jeder
Kindergarten nach Roger Loos Lernsequenz eingetragen.
Leitziel des Deutschlernens mit ausländischen
Kindern kann nur die möglichst umfassende,
differenzierte und richtige Aneignung der II.5.5. Sprachförderprogramm „Wir
deutschen Sprache sein. Denn nur auf der Basis verstehen uns gut – Spielerisch
einer phonetisch, begrifflich und grammatikalisch Deutsch lernen“
möglichst vollständig und möglichst richtig
angeeigneten deutschen Sprache erwerben die Dieses Sprachprogramm ist eine Antwort auf den
Kinder die Fähigkeiten, Förderbedarf von Kindern, die nicht Deutsch spre-
chen. Es wurde im Baustein-System entwickelt
unsere gesellschaftliche Wirklichkeit und ihre und ist so angelegt, dass es in den Praxisalltag
eigene Situation möglichst umfassend und der Einrichtungen eingebunden werden kann. Es
möglichst objektiv zu erkennen versetzt pädagogische Fachkräfte in die Lage,
kompetent im Rahmen dieser sprachliche Förderung zu integrieren. Neben dem
gesellschaftlichen Wirklichkeit zu handeln Sprachprogramm bieten die didaktischen
und sich aktiv an der Veränderung dieser Kapitelteile reichhaltige Informationen zum
gesellschaftlichen Wirklichkeit zu beteiligen. Fachgebiet „Interkulturelle Pädagogik und
(entnommen aus: Roger Loos – Seminare) Mehrspracherwerb“. Es beinhaltet viele praktische
Hinweise, z. B. für die Planung und Durchführung
Der unterstützende Spracherwerb besteht im We- von Elternabenden. Die umfangreiche
sentlichen aus drei einander zugeordneten Teilen: Materialsammlung als Ringordner, als
Arbeitsordner mit Kopiervorlagen erleichtert die
den Strukturen tägliche Arbeit.
dem Wortschatz
- 13 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
II.5.6. Landesinformationen unterstützt werden, die Familiensprache auch im
Alltag zu pflegen. Denn jeder Mensch ist Experte
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend für seine eigene Erstsprache und daher hierfür
und Kultur der beste Sprachvermittler.
Auf dem „Kita-Server“ des Landes Rheinland-
Pfalz wird unter www.kita.rlp.de, Stichwort
„Sprachförderung“, eine kommentierte II.7. Zusammenarbeit mit der
Literaturliste für folgende Bereiche bereitgestellt: Grundschule
Literatur zum Spracherwerb des Kindes Um den Übergang vom Kindergarten zur Grund-
Literatur zur Sprachbildung und schule vor allem für die ausländischen Kinder flie-
Sprachförderung im Kindergarten ßend zu gestalten, ist ein früher und kontinuierlich
gepflegter Kontakt mit der Grundschule für einen
II.6. Zusammenarbeit mit den Eltern guten Start in einen neuen Lebensabschnitt von
großer Bedeutung. Insbesondere in Bezug auf
Durch die Vielzahl der unterschiedlichen die Sprachförderung ist hier ein großer
Herkunftsländer der Familien in den Abstimmungs- und Kooperationsbedarf von
Kindertageseinrichtungen verändert sich die Bedeutung. Sowohl das Kindertagesstättengesetz
Zusammenarbeit. Herkömmliche Elternabende als auch das Schulgesetz fordern eine
weichen Begegnungen; zum Aufbau von Kooperation der beiden Institutionen, so dass sich
Beziehungen als Basis für die gemeinsame nicht die Frage des „Ob“ sondern allenfalls die
Verantwortung und Wahrnehmung der Bildungs- Frage des „Wie“ stellt.
und Erziehungsarbeit z.B. durch gemeinsame
Ausflüge, interkulturelle Feste etc. Dadurch öffnet Die in Koblenz eingerichtete Arbeitsgemeinschaft
sich der Kindergarten zum Stadtteil und erschließt Jugendhilfe – Schule und die Arbeitsgruppe
über die Einrichtung hinaus verschiedenartige Kindertagesstätten haben sich dafür
Ressourcen, die insbesondere den ausländischen ausgesprochen, Empfehlungen für die
Kindern und ihren Eltern nutzen können. Die Zusammenarbeit von Kindergärten und
Lebenssituation der Familien ist konzeptioneller Grundschulen zu erarbeiten. Vertreter/innen der
Bestandteil der Einrichtung. Deshalb werden Grundschulen und Kindergärten, die
Informationen so aufbereitet, dass die Ziele und Fachberaterinnen der kirchlichen Einrichtungen
Inhalte der pädagogischen Arbeit verständlich an und Mitarbeiter/innen des Jugendamtes haben in
die Eltern weiter gegeben werden. 2006 eine umfangreiche Arbeitshilfe erstellt, die
am 02.03.07 im Jugendhilfeausschuss und am
Sprachförderkurse für Eltern von 14.03.07 vom Schulträgerausschuss beschlossen
Migrantenkindern in Zusammenarbeit mit anderen wurde. An dieser Stelle wird daher nicht näher auf
Institutionen, die auch in den Räumen der die Thematik eingegangen. Die Arbeitshilfe kann
Kindertageseinrichtung durchgeführt werden, sind beim Jugendamt angefordert werden und ist im
eine sinnvolle Unterstützungsmaßnahme für den Internet unter www.stadt.koblenz.de abrufbar.
Integrationsprozess.
Als Integrations- und Bildungsangebot für Eltern
sind diese Kurse wichtige Lernvorbilder für die
Kinder. Dennoch sollten Eltern immer wieder
- 14 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
II.8. Vernetzung Mitbürger und Mitbürgerinnen etwas „machen“ zu
wollen, sondern zusammen mit ihnen den
Eine übergeordnete Vernetzung von Angeboten Lebens- und Sozialraum für alle Bewohner und
zur Förderung und Integration von Migranten Bewohnerinnen im Stadtteil erfahrbar, transparent
erfolgt in Abstimmung des Amts für Jugend, und dadurch interessant werden zu lassen. Die
Familie, Senioren und Soziales mit dem Chancen des interkulturellen Zusammenlebens
Ordnungsamt als Anstellungsträger der Leitstelle stehen dabei im Mittelpunkt.
Integration.
Im Interesse von Weiterentwicklung und Stärkung
der interkulturellen Kompetenz der II.8.2. Kooperation und Vernetzung im
Kindertagesstätten mit hohem Migrantenanteil Programm „Soziale Stadt“
vernetzen sich diese mit den verschiedenen
Diensten, Institutionen und Personen. Dabei ist Auch in Gesprächen, Treffen, Runden Tischen,
die pädagogische Konzeption für die Kooperationen und Aktionen, die im Rahmen des
interkulturelle Arbeit mit dem Schwerpunkt der Bund/Länderprogramms „Soziale Stadt“ in den
Sprachförderung auf die spezifischen Beson- ausgewiesenen Fördergebieten stattfinden,
derheiten der jeweiligen Einrichtung abzustellen werden Themen des interkulturellen
und obliegt der Trägerhoheit. Der individuelle Zusammenlebens eingebracht und
Charakter einer Kindertageseinrichtung bleibt so angesprochen. Dabei ist eine aktive Beteiligung
erhalten und berücksichtigt das originäre von Kindertagesstätten mit Fachkräften für die
Gestaltungsrecht eines jeden Trägers. interkulturelle Arbeit erwünscht.
Gemeinsam mit der Leitung übernimmt die
Zusatzkraft für interkulturelle Arbeit die Sorge und
Verantwortung für eine bedarfsgerechte II.8.3. Kooperation und Vernetzung mit
Vernetzung und Kooperation. Insbesondere der Arbeitsgruppe
können folgende Kooperationen und Kindertagesstätten und dem
Vernetzungen von Bedeutung sein:
Jugendhilfeausschuss der Stadt
Koblenz
Beide Gremien werden nach Bedarf über wichtige
II.8.1. Vernetzung im Stadtteil
Entwicklungen der interkulturellen Arbeit in
Kindergärten informiert und bei
Die Kindergärten im Stadtteil kooperieren in
Weiterentwicklungen informiert.
Fragen der interkulturellen Arbeit untereinander
und mit anderen hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Gruppen und Personen, deren
Anliegen es ist, die Integration ausländischer
II.8.4. Kooperation und Vernetzung mit
Mitbürger und Mitbürgerinnen zu unterstützen und
zu fördern. Es wird daher angeregt, die
den Migrationsdiensten der
stadtteilbezogene Zusammenarbeit vor Ort an Wohlfahrtsverbände
einem „Runden Tisch“ zu organisieren und abzu-
stimmen. Handlungsleitendes Prinzip der Zusam- Die freien Wohlfahrtsverbände in Koblenz bieten
menarbeit ist dabei nicht, für die ausländischen mit ihren Migrationsdiensten eine umfangreiche
- 15 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
Kompetenz zu allen Fragen, die ausländische Neben der Möglichkeit des Austauschs, werden
Mitbürger und Mitbürgerinnen beschäftigen. Diese fachliche Impulse für die Weiterentwicklung der
Angebote werden von den Kindergärten genutzt interkulturellen Arbeit gegeben. Der Arbeitskreis
wird trägerübergreifend angeboten und trifft sich 3
x im Jahr. Die regelmäßige Teilnahme der
Fachkräfte für interkulturelle Arbeit wird erwartet.
II.8.5. Kooperation und Vernetzung mit
den Mitgliedern des Beirats für
Migration und Integration
II.8.8. Kooperation und Vernetzung mit
Die Mitglieder des Beirats für Migration und der Wissenschaft
Integration kennen als politische Vertreter/innen
der Mitbürger und Mitbürgerinnen mit Es sollte dafür geworben werden, dass Projekte
Migrationshintergrund auf kommunaler Ebene an der Uni Koblenz-Landau und der
deren Lebenssituationen. Sie sind auf der poli- Fachhochschule Koblenz, die sich mit der
tischen Ebene Anwälte und Fürsprecher bezogen Thematik „Interkulturelles Zusammenleben“
auf Themen, Fragen und Probleme der ausländi- beschäftigen, auch die interkulturelle Arbeit in
schen Kinder und Familien in Kindergärten. Damit Kindergärten im Blick haben.
werden auch sie wichtige Ansprechpersonen für
Kindertageseinrichtungen. Die pädagogische Konzeption für die
interkulturelle Arbeit mit dem Schwerpunkt der
Sprachförderung ist auf die spezifischen
Besonderheiten der jeweiligen Einrichtung
II.8.6. Kooperation mit den abzustellen und obliegt der Trägerhoheit. Der
Bildungsträgern in der Stadt individuelle Charakter einer Kinderta-
geseinrichtung bleibt so erhalten und
Koblenz
berücksichtigt das originäre Gestaltungsrecht
eines jeden Trägers.
Die kath. Familienbildungsstätte, die Volkshoch-
schule und das Regionale Bildungswerk sind Bil-
Es bedarf im Sinne dieser Förderrichtlinien der
dungseinrichtungen, die u.a. bei der
bewussten Erweiterung um integrative Aspekte.
Unterstützung der ausländischen Eltern beim
Die interkulturelle und integrative Pädagogik sollte
Erlernen der deutschen Sprache eine wichtige
fundamentaler Bestandteil der Einrichtung
Rolle spielen.
werden.
II.8.7. Gemeinsamer Arbeitskreis der
Fachkräfte für interkulturelle III. Rahmenbedingungen für die
Arbeit interkulturelle Arbeit
Auf Stadtebene bieten die Fachberaterinnen der Für die Umsetzung der interkulturellen Arbeit mit
evangelischen und katholischen ihren zahlreichen inhaltlichen Facetten als eine
Kindertagesstätten einen gemeinsamen pädagogische Dimension im pädagogischen
Arbeitskreis für interkulturelles Arbeiten an. Alltag der Kindertagesstätte ist es wichtig, dass in
- 16 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
der jeweiligen Kindertagesstätte entsprechende Material für die Zusammenarbeit mit den
Rahmenbedingungen vorgehalten werden. Familien zu interkulturellen Koch- und
Backtagen
III.1. Räume
III.3. Rolle und Selbstverständnis
Für die Arbeit in Kleingruppen und mit einzelnen der Fachkräfte für
Kindern sollten Nebenräume vorhanden sein, die
interkulturelle Arbeit
der zuständigen Fachkraft zur Verfügung stehen.
Zusätzliche Fachkräfte für interkulturelle Arbeit
Sind solche Nebenräume nicht vorhanden, ist das
haben in erster Linie die Aufgabe, die Anliegen
einrichtungsspezifische Konzept so zu gestalten,
und Bedürfnisse der Migrantenkinder in der
dass trotzdem Kleingruppen- und Einzelarbeiten
Kindertageseinrichtung wahrzunehmen,
möglich sind. Im Kontext der Bespielbarkeit und
konzeptionelle Konsequenzen mit dem Team
Erfahrbarkeit aller Räume im Haus für die Kinder
abzuleiten und diese didaktisch/methodisch
wird dies sicher möglich sein.
adäquat umzusetzen. Dabei wirken sie im
Integrationsprozess unterstützend, initiierend und
Bietet die Kindertagesstätte diese Möglichkeit nur
geben Entwicklungshilfen. Auf diesem
im geringen Maße oder nicht, sollte auf Räume
Hintergrund nimmt die Zusatzkraft verantwortlich
zurückgegriffen werden können, die sich eventuell
folgende Aufgaben wahr:
in unmittelbarer Nähe zur Einrichtung befinden,
wie z.B. Räume im
die Koordinierung interkultureller
Pfarrheim/Gemeindehaus/Rathaus.
pädagogischer Angebote
sie ist Ansprechpartnerin und Beraterin für die
Teammitglied
sie verfügt über gutes Hintergrundwissen zu
III.2. Arbeitsmaterial den einzelnen im Kindergarten vorkommenden
Kulturen und Religionen (dabei hat sie auch
Der Träger des Kindergartens berücksichtigt in rechtliche Aspekte im Blick)
seinem jährlichen Haushalt den Sachbedarf, der sie ist verantwortlich für die interkulturelle
sich aus der interkulturellen Arbeit ergibt. Dazu Erziehung im Rahmen der Gesamtkonzeption
gehören: der Einrichtung mit dem Schwerpunkt der
Sprachförderung
einschlägige Fachliteratur sie arbeitet familienunterstützend, vermittelt
pädagogisches Material für die direkte Arbeit Übersetzungen, bietet Sprechstunden an
mit den Kindern sie arbeitet mit Behörden, einschlägigen
Bücher und CDs/Kassetten in anderen Institutionen, sozialen Diensten und
Sprachen, Fachdiensten im Stadtteil zusammen
Spiele zum Thema sie ist Multiplikatorin auf Trägerebene
Material zum kreativen Gestalten unter sie arbeitet mit den aufnehmenden
kulturspezifischen Aspekten Grundschulen zusammen und führt
Rollenspielmaterial, Alltagsgegenstände aus insbesondere die Abstimmung über gelebte
den verschiedenen Herkunftsländern
- 17 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
und durchgeführte Sprachförderkonzepte Grammatik,
herbei Akzentuierung
sprachliche Ausdrucksvielfalt und
Darüber hinaus ist sie gemeinsam mit der Leiterin Formulierung gefühlsbetonter Wahrnehmung
und dem Team verantwortlich für:
Darüber hinaus setzt sie sich mit den in Kap. V
die interkulturellen Aktivitäten und dargestellten Sprachförderprogrammen
Sprachförderung auseinander.
die Zusammenarbeit mit den Familien der
Migrantenkinder Die Beschäftigung und Integration zugewanderter
die Vernetzung gem. Kapitel II.8 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in den Teams
die Öffentlichkeitsarbeit zur interkulturellen der Kindergärten ist empfehlenswert, weil sie
Arbeit aufgrund ihrer eigenen Migrationserfahrungen
eine Art Fremdheitskompetenz mitbringen. Sie
Der Einsatz der Fachkräfte für die interkulturelle können nachvollziehen, was Auswanderung aus
Arbeit erfolgt in einer Kombination einer ihnen vertrauten Umgebung, die Heimat
unterschiedlicher sozialpädagogischer Arbeits- war, und Neubeginn in einer ihnen fremden
formen: Umgebung psychisch, sozial, sprachlich und
wirtschaftlich bedeutet. Diese Erfahrungen,
in der Gruppe reflektiert in die Integrationsarbeit eingebracht,
gruppenübergreifend, können Kindern der unterschiedlichsten Her-
in der offenen Arbeit, kunftsländer und Nationalitäten im
in thematischen Kleingruppen und Integrationsprozess hilfreich sein.
in der Einzelförderung von Kindern
Die Kompetenzen der Fachkräfte werden durch
Nach der Landesverordnung: den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen und
Arbeitsgemeinschaften kontinuierlich gepflegt und
ist die Zusatzkraft eine geeignete weiterentwickelt.
Erziehungskraft, ausländischer oder
deutscher Nationalität Die Fachberatungen für die katholischen und
sie verfügt über gute Kenntnisse der evangelischen Kindertagesstätten stellen auf
Herkunftsländer und Anfrage Materialien und Arbeitshilfen zur
über entsprechende interkulturellen Arbeit zur Verfügung. Darüber
Fremdsprachenkenntnisse hinaus unterstützen sie die Einrichtungen bei der
Erstellung des interkulturellen Konzeptes der
Die Wahrnehmung dieser Aufgaben und Kindertageseinrichtung.
Zuständigkeiten erfordert nachfolgendes
Fachlichkeitsprofil. Es beschreibt die Merkmale Da 60 % der Personalkosten über das Land
für die fachliche und persönliche Eignung einer gefördert werden, ist eine Abstimmung über die
Fachkraft mit interkultureller Kompetenz. Einstellung der Fachkräfte mit dem
Landesjugendamt einzuholen. An dieser Stelle
Sie verfügt über gute Deutschsprachkenntnisse in wird auf die Landesempfehlungen und die
Bezug auf: dortigen Ausführungen in Kapitel 5 verwiesen.
Lautbildung,
- 18 -Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales - Jugendamt -
Richtlinien Interkulturelle Arbeit in KiTas
III.4. Rolle und Aufgaben der Die Leitung unterstützt die Fachkräfte für
Leitung4 interkulturelle Arbeit mit Weiterqualifizierung
und dem fachlichen Austausch in
Arbeitsgemeinschaften.
Die interkulturelle Arbeit ist eine gesamtkonzeptio-
nelle Aufgabe. Die Erfüllung dieser Aufgabe Die Leitung vernetzt die interkulturelle Arbeit
gelingt so gut, wie das gesamte Team im Stadtteil, mit den Wohlfahrtsverbänden und
miteinander kooperiert und die interkulturelle den zuständigen Gremien.
Arbeit als gemeinsame Aufgabe versteht. Hierbei Gemeinsam mit dem Team entwickelt die
kommt der Leitung eine besondere Rolle zu: Leitung eine Konzeption, in der die
interkulturelle Grundhaltung zum Ausdruck
Die Leitung stärkt das Team in seiner Vielfalt kommt und die von allen getragen wird.
und vertritt diese Vielfalt bewusst nach innen Die Leitung fördert einen respektvollen
und außen. Umgang miteinander, gegenseitige Akzeptanz,
Die Leitung erkennt und unterstützt die Empathie, Kompromissfähigkeit, Flexibilität,
verschiedenen, auch multikulturellen Selbstreflexion und eine urteilsbewusste
Potentiale der Kolleginnen und Kollegen. Dies Haltung.
umfasst auch fachfremde berufliche Die Leitung nutzt fachliche Unterstützung und
Abschlüsse, Berufserfahrung, Beratung
Migrationserfahrungen und weitere besondere
Kenntnisse und Interessen.
Die Leitung fördert die Identifikation des
III.5. Ausgewogene Verteilung der
Teams mit der interkulturellen Arbeit:
Migrantenkinder im Sozialraum
o Wir sind ein Team.
o Wir sind für die gesamte Kindertagesstätte Kulturelle Aufgeschlossenheit und kulturelles
mit allen Kindern und Eltern verantwortlich. Selbstbewusstsein sind Kompetenzen, die im
o Wir arbeiten intensiv zusammen und europäischen Kontext immer wichtiger werden.
unterstützen uns in unseren Für Migrantenkinder gehört der Umgang mit
unterschiedlichen Möglichkeiten. unterschiedlichen kulturellen Milieus zum Alltag.
o Wir nutzen spezifische, sprachliche Auch deutsche Kinder müssen sich zunehmend in
Fähigkeiten und kulturelle einer kulturell pluralen Gesellschaft bewegen. Sie
Erfahrungshintergründe der Kolleginnen brauchen ein Umfeld, das ihnen einen
und Kollegen auf der Ebene gegenseitigen selbstbewussten und selbstverständlichen
Vertrauens und wechselseitiger Umgang mit fremden Sprachen und Kulturen
Information. ermöglicht.
Die Leitung gibt allen Teammitgliedern die
Da der Anteil der Personen mit
Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Sie
Migrationshintergrund in den Koblenzer
unterstützt eine Kultur des Zuhörens und
Stadtteilen unterschiedlich ist und dies sich auch
macht Mut zur sprachlichen
in den Kindertagestätten widerspiegelt, ist im
Weiterentwicklung.
Sinne einer gelingenden Integration auf eine
möglichst ausgewogene Verteilung der Kinder mit
Migrationshintergrund zu achten. Dabei wird das
4
Vgl.: Zusätzliche Fachkräfte für interkulturelle Arbeit in Wunsch- und Wahlrecht der Eltern berücksichtigt.
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz, Beschluss des LJHA
vom 20.2.2006 Die Kindertagesstätten mit einer Fachkraft für
- 19 -Sie können auch lesen