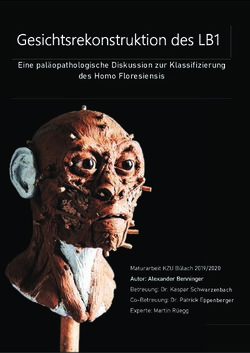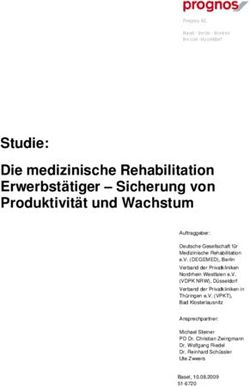Swiss Issues Branchen Am Puls der Gesundheitslandschaft
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Economic Research
Impressum
Herausgeber
Martin Neff, Head Credit Suisse Economic Research
Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zürich
Kontakt
branchen.economicresearch@credit-suisse.com
Telefon +41 (0)44 334 74 19
Autoren
Nicole Brändle
Dr. Merja Hoppe
Frédéric Junod
Manuela Merki
Mitwirkung
Viktor Holdener
Boris Meier
Druck
Dfmedia, Druckerei Flawil AG, Burgauerstrasse 50, 9230 Flawil
Titelbild
©iStockphoto.com/melhi
Redaktionsschluss
15. Juli 2010
Besuchen Sie uns auf dem Internet
www.credit-suisse.com/research
Disclaimer
Dieses Dokument wurde vom Economic Research der Credit Suisse hergestellt und
ist nicht das Ergebnis einer/unserer Finanzanalyse. Daher finden die "Richtlinien zur
Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankier-
vereinigung auf vorliegendes Dokument keine Anwendung.
Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken. Die darin vertretenen Ansichten
sind diejenigen des Economic Research der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Druck-
legung (Änderungen bleiben vorbehalten).
Die Publikation darf mit Quellenangabe zitiert werden.
Copyright © 2010 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unterneh-
men. Alle Rechte vorbehalten.
Swiss Issues BranchenEconomic Research
Inhalt Editorial 5
1 Struktur und Umfeld 6
1.1 Kostenblock und Wachstumsbranche 6
1.2 Beschäftigung und Struktur 8
1.3 Wichtigste Anbieter 9
1.3.1 Krankenhäuser 9
1.3.2 Ärzte 12
1.3.3 Zahnärzte 14
1.3.4 Alters- und Pflegeheime 15
2 Regionale Bedeutung 17
2.1 Regionale Spezialisierungen 17
2.2 Regionaler Wirtschaftsfaktor 21
3 Versorgung und Erreichbarkeit 23
3.1 Regionale Versorgungsdichte 23
3.2 Erreichbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen 28
4 Ausblick Gesundheitslandschaft Schweiz 32
4.1 Bestimmungsfaktoren der Nachfrage 32
4.2 Bestimmungsfaktoren des Angebots 34
4.3 Zukünftige Versorgung in den Regionen 36
4.4 Entwicklungspotenzial in den Regionen 41
5 Schlussfolgerungen 44
Swiss Issues Branchen 3Economic Research
Editorial
"Der Gesunde weiss nicht, wie reich er ist", lautet ein wohlbekanntes Sprichwort. Mindestens
einmal pro Jahr, wenn die neuen Krankenkassenprämien ins Haus flattern, wissen wir aber alle,
dass Gesundheit nicht gratis ist. Das Schweizer Gesundheitssystem ist qualitativ hochstehend,
aber auch teuer. Die Gesundheitskosten machen mehr als 10% des Schweizer Bruttoinland-
produkts aus.
Der Gesundheitssektor ist jedoch weit mehr als ein beachtlicher Kostenblock. Unsere Gesund-
heit liegt uns am Herzen. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für unser Wohlergehen und be-
friedigt ein wachsendes gesellschaftliches Bedürfnis. Der Gesundheitssektor ist zudem ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor, mit rund 365'000 Vollzeitstellen ein wichtiger Arbeitgeber und ein
Treiber von Innovationen in verschiedenen Bereichen.
Die Emotionen schlagen oft hoch, wenn der Zustand oder die Perspektiven des Schweizer Ge-
sundheitswesens diskutiert werden. Politiker, Lobbyisten, Leistungserbringer und nicht zuletzt
die Patienten vertreten ihre Interessen vehement und mit Nachdruck. In der vorliegenden Studie
wollen wir nicht in den Chor einstimmen und zu den aktuellen Reformvorschlägen Stellung neh-
men oder Empfehlungen abgeben. Vielmehr möchten wir aus der Sicht eines externen Beob-
achters Informationen erschliessen, Fakten zusammentragen und verdichten, um so dem Leser
eine Auslegeordnung zu ermöglichen.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der regionalen Betrachtung. Die räumliche Vertei-
lung der Gesundheitsdienstleistungen innerhalb der Schweiz ist aus unterschiedlichen Gesichts-
punkten von Interesse. Einerseits stellt sich die Frage nach kantonaler und regionaler Arbeitstei-
lung, andererseits hängt die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen von der regionalen
Bevölkerungsentwicklung ab.
Der Gesundheitssektor befindet sich im Spannungsfeld von Konzentration bzw. Spezialisierung
und der Nähe zu Kunden bzw. Patienten. Arbeitsteilungs- und Effizienzüberlegungen wirken da-
bei oftmals in Richtung Konzentration der Leistungserstellung, während die notwendige Nähe
zum Konsumenten und der Versorgungsauftrag der Konzentration entgegenwirken. Im Vergleich
zu anderen Wirtschaftsbereichen – auch anderen Dienstleistungsbranchen – spielen Zugangs-
und Versorgungsgesichtspunkte im Gesundheitsbereich eine besonders gewichtige Rolle.
Die Publikation startet mit einem Überblick über die wichtigsten Eckdaten des Gesundheitswe-
sens. Danach betrachten wir die Branche als regionalen Wirtschaftsfaktor sowie aus dem Blick-
winkel der regionalen Versorgung und der Erreichbarkeit der Gesundheitsdienstleister. Ab-
schliessend wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie ist die aktuelle Gesundheitslandschaft
Schweiz auf die Nachfrageentwicklung vorbereitet? Und welches Entwicklungspotenzial eröffnet
sich künftig für die Regionen und Gesundheitsdienstleister?
Das Autorenteam wünscht Ihnen eine anregende Lektüre.
Swiss Issues Branchen 5Economic Research
1 Struktur und Umfeld
1.1 Kostenblock und Wachstumsbranche
Hohe und stark wachsende Mit einem Anteil am BIP von über 10% ist die Schweizer Gesundheitsbranche ein eigentliches
Gesundheitskosten in der Schwergewicht. 20071 beliefen sich die Kosten des Gesundheitswesens auf rund 55 Mrd. CHF
Schweiz oder beachtliche 7'247 CHF pro Einwohner. Heute dürften sie bereits deutlich über 63 Mrd.
CHF betragen. Im Durchschnitt sind die Gesundheitsausgaben in den letzten 10 Jahren um
3.8% gewachsen. Dank der besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer etwas ge-
zähmteren Preisentwicklung haben sie sich gemessen am BIP im Zeitraum 2004–2007 zwar
stabilisiert. Absolut wachsen die Gesundheitsausgaben indes nach wie vor stark.
Grösster Leistungserbringer Mit einem Anteil an den gesamten Gesundheitsausgaben von 35% stellen die Leistungen der
sind mit etwas mehr als Krankenhäuser den grössten Kostenblock dar (Abbildung 1). An zweiter Stelle folgt die medizi-
einem Drittel der Kosten nische Versorgung durch Ärzte mit einem Anteil von 17.7%. Drittgrösster Leistungserbringer –
die Krankenhäuser nur knapp dahinter – sind die sozialmedizinischen Institutionen (Pflegeheime und Institutionen
für Behinderte) mit einem Anteil von 17%. Die Gesundheitsausgaben im Bereich des Detail-
handels, d.h. die Ausgaben für Medikamente und therapeutische Apparate, beliefen sich 2007
auf rund 5 Mrd. CHF oder 9% der Gesamtkosten.
Starker Ausbau der Leis- Die Ausgabenentwicklung der verschiedenen Leistungserbringer über die Zeit deutet auf Ver-
tungen im Bereich der Al- schiebungen hin (Abbildung 2). Besonders stark sind die Leistungen der Alters-, Behinderten-
ters-, Behinderten- und und Pflegeheime angewachsen (+4.5% p.a. zwischen 1998 und 2007). Unterdurchschnittlich
Pflegeheime zugenommen haben demgegenüber die Leistungen durch Zahnmediziner. Dies jedoch insbe-
sondere bis zur Jahrtausendwende, während sie in der jüngeren Vergangenheit auf den allge-
meinen Wachstumspfad eingeschwenkt sind. Beim Detailhandel (Ausgaben für Medikamente
und therapeutische Apparate) zeigt sich seit 2005 eine deutliche Verlangsamung des Ausga-
benwachstums.
Abbildung 1 Abbildung 2
Gesundheitsausgaben nach Leistungserbringern Ausgabenentwicklung nach Leistungserbringern
Anteil an den gesamten Gesundheitsausgaben, 2007 Entwicklung der Gesundheitsausgaben, Index 1998 = 100
Krankenhäuser 7.6% 170
Total
9.1% 160 Krankenhäuser
Sozialmedizinische Institutionen
Sozialmedizinische Institutionen
35.1% 150 Detailhandel
Ärzte nichtärztliche ambulante Versorger
6.9%
140 Ärzte
Zahnärzte Zahnärzte
130
6.4%
nichtärztliche ambulante Versorger
120
Detailhandel 110
17.7%
Staat, Versicherer, Organisationen 100
17.2%
ohne Erwerbscharakter 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
1 Aktuellste verfügbare Zahlen der offiziellen Statistik "Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens" des Bundesamts für Statistik.
Swiss Issues Branchen 6Economic Research
Kosten stark getrieben Die Ursachen der massiven Erhöhung der Gesundheitskosten sind weitgehend mengen- und
durch Mengenausweitung nicht preisbedingt. Über den ganzen Gesundheitsbereich betrug die durchschnittliche Teuerung
pro Jahr zwischen 1998 und 2008 0.4%, mit markanten Unterschieden zwischen den einzelnen
Gesundheitsgütern und -dienstleistungen. Am stärksten sind die Preise für Spitalleistungen ge-
stiegen (+1.3% p.a.). Im Vergleich zum Wachstum zwischen 1988 und 1998 (+5% p.a.) hat
sich dieses aber abgeschwächt. Ungefähr im Gleichschritt mit der gesamten Teuerung entwi-
ckelten sich die Preise für zahnärztliche Leistungen (+0.9% p.a.). Die Preise für ärztliche
Dienstleistungen verzeichneten zwischen 1998 und 2008 ein Nullwachstum. Günstiger gewor-
den sind die Medikamente. Ihre Preise sind seit 1998 kontinuierlich gefallen (–1.8% p.a.) und
liegen seit 2006 sogar unter dem Niveau von 1990. Gründe hierfür sind die zunehmende
Verbreitung von Generika sowie Preisabschläge auf den Originalpräparaten.
Verschiebung von stationä- Die Aufschlüsselung der Kosten nach Leistungen legt offen, dass sich insbesondere die ambu-
ren hin zu ambulanten Leis- lanten Behandlungen in Krankenhäusern stark ausgeweitet haben, während im Gegenzug die
tungen Ausgaben für stationäre Behandlungen seit 2004 rückläufig sind. 2007 wurden rund 3.7 Mrd.
CHF für ambulante Spitalleistungen ausgegeben und somit mehr als doppelt soviel wie noch im
Jahr 1998 (+9.1% p.a.). Auch die Spitex-Pflege wuchs kräftig (+4.5% p.a.), ebenso wie die
Ausgaben für Langzeitpflege und Rehabilitation. Hierfür wurden 2007 insgesamt 8.1 Mrd. CHF
aufgewendet; 1998 waren es noch 5.3 Mrd. CHF. Bei den Arzneimitteln nahm insbesondere
der Verkauf von Medikamenten durch Ärzte stark zu (+5.2% p.a.).
Gesundheitswesen: Ein Das Gesundheitswesen ist weit mehr als nur ein "Kostenblock". Die Gesundheit ist den meisten
Wachstumstreiber Leuten das wichtigste Gut. Mit dem (langfristigen) Einkommens- und Wirtschaftswachstum
wächst daher auch die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, und zwar überproportional
zur Einkommensentwicklung. Innovationen aus verschiedensten Bereichen – etwa der Gentech-
nik, der Materialwirtschaft oder der Informations- und Kommunikationstechnologie – werden
durch die Bedürfnisse des Gesundheitswesens getrieben.
Grösster Arbeitgeber der Der Gesundheitssektor gehört zu den bedeutendsten Branchen der Schweizer Wirtschaft über-
Schweiz haupt. Das Gesundheits- und Sozialwesen zählt 2009 rund 365'000 Vollzeitstellen (VZÄ) oder
beinahe 500'000 Beschäftigte. In VZÄ sind dies fast drei Mal so viele Beschäftigte wie im ge-
samten Kredit- und Versicherungsgewerbe. Kein anderer Wirtschaftszweig bietet so viele Ar-
beitsplätze. In den letzten 10 Jahren wurden im Gesundheitsbereich zudem über 80'000 Voll-
zeitstellen geschaffen (Abbildung 3).
Abbildung 3 Abbildung 4
Beschäftigungsentwicklung Überblick: Struktur der Gesundheitsbranche
Vollzeitäquivalent Beschäftigte (VZÄ), Index 1998 = 100 Vollzeitstellen (VZÄ) und Arbeitsstätten in den einzelnen Subbranchen, 2008
Arbeits-
140
NOGA Bezeichnung VZÄ Anteil stätten
Gesundheits- und Sozialwesen
86 Gesundheitswesen 202'927 100.0% 17'564
130 Total Beschäftigte
861001 Allgemeine Krankenhäuser 99'490 49.0% 190
Industrie (ohne Bau)
861002 Spezialkliniken 33'561 16.5% 237
120 Dritter Sektor
862100 Arztpraxen für Allgemeinmedizin 17'772 8.8% 5'567
862200 Facharztpraxen 9'058 4.5% 2'602
110
862300 Zahnarztpraxen 13'046 6.4% 2'756
869001 Psychotherapie und Psychologie 1'135 0.6% 662
100
869002 Physiotherapie 4'980 2.5% 2'357
90
869003 Krankenschwestern, Hauspflege 13'843 6.8% 866
869004 Aktivitäten der Hebammen 120 0.1% 36
80
869005 Nichtärztliche Medizinalberufe 3'456 1.7% 1'756
1998 2000 2002 2004 2006 2008
869006 Medizinische Labors 4'302 2.1% 227
869007 Sonstiges Gesundheitswesen a.n.g. 2'164 1.1% 293
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Swiss Issues Branchen 7Economic Research
Abgrenzung des Gesund- Die vorliegende Studie konzentriert sich weitestgehend auf das Gesundheitswesen im engeren
heitswesens Sinne (Abbildung 4). Dieses umfasst die Tätigkeiten von Akut- und Langzeitkrankenhäusern,
allgemeinen und Fachkliniken, ferner Konsultations- und Behandlungstätigkeiten von prakti-
schen Ärzten, Fachärzten oder Zahnmedizinern sowie die Physiotherapie, die Psychotherapie,
die Hauspflege, Tätigkeiten von Hebammen und sonstiger nichtärztlicher Medizinalberufe. Auf-
grund der Datenverfügbarkeit wird in einigen Fällen vom Gesundheits- und Sozialwesen gespro-
chen, d.h. das Gesundheitswesen wird um die Branchen "Heime"2 und "Sozialwesen"3 erweitert.
Die Bedeutung des Gesundheitswesens geht aber weit über seinen Kernbereich hinaus.
1.2 Beschäftigung und Struktur
Hohe Dynamik bei der Fast alle Subbranchen des Gesundheitssektors hatten zwischen 1998 und 2008 einen über-
Hauspflege und bei nicht- durchschnittlichen Beschäftigungszuwachs zu verzeichnen. Sie haben vom allgemeinen Wachs-
ärztlichen Medizinberufen tum der Branche jedoch unterschiedlich profitiert. Am stärksten war der Beschäftigungsanstieg
im Bereich der Hauspflege (Abbildung 5). 2008 wurden in diesem Bereich beinahe 6'000 Voll-
zeitbeschäftigte mehr gezählt als 1998, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von
5.8% entspricht. Ein dynamisches Wachstum zeigten zudem die nichtärztlichen Medizinalberufe
(Ergotherapie, Homöopathie, Akupunktur, Ernährungsberatung etc.) mit einer durchschnittlichen
jährlichen Zunahme von 5.0%.
Abbildung 5
Beschäftigung im Gesundheitswesen
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Allgemeine Krankenhäuser Spezialkliniken
Arztpraxen für Allgemeinmedizin Facharztpraxen
250'000 Zahnarztpraxen Psychotherapie und Psychologie
Hauspflege Physiotherapie
Nichtärztliche Medizinalberufe Übrige Tätigkeiten im Gesundheitswesen
200'000
150'000
100'000
50'000
0
1998 2001 2005 2008
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Spezialmedizin wächst Auffallend ist weiter die starke Zunahme bei den Fachärzten um jährlich durchschnittlich 3.9%
stärker als Allgemeinmedi- oder insgesamt 2'859 Vollzeitstellen (1998–2008) (Abbildung 5). Die Anzahl Allgemeinpraktiker
zin hat demgegenüber um 1'723 (VZÄ) oder 0.9% p.a. abgenommen. Auch bei den Krankenhäu-
sern zeigt sich eine Verschiebung von allgemeinen Krankenhäusern hin zu Spezialkliniken, wenn
auch weniger ausgeprägt. Stark gestiegen ist im erweiterten Gesundheitssektor zudem die An-
zahl Beschäftigte in Pflegeheimen. Hier wurden zwischen 1998 und 2008 mehr als 33'000
Stellen geschaffen. Die Anzahl Stellen in Altersheimen ist hingegen zurückgegangen.
2 Diese Branche "Heime" (NOGA 87) setzt sich zusammen aus Pflegeheimen, Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung und Suchtbekämpfung sowie Alten- und Behin-
dertenwohnheimen.
3 Das Sozialwesen (NOGA 88) umfasst eine Vielzahl von Tätigkeiten im Rahmen der Betreuung von älteren und behinderten Personen (wie bspw. Besuchsdienste), die
Tagesbetreuung von Kindern sowie verschiedene sonstige Tätigkeiten privater oder öffentlicher Organisationen der Wohlfahrtspflege.
Swiss Issues Branchen 8Economic Research
Tendenz hin zu grösseren Während Ausgaben und Beschäftigung stetig wachsen, entwickelt sich die Anzahl Unterneh-
Betrieben, Praxen und Spi- men weit weniger dynamisch. Die Zahl der Arbeitsstätten im gesamten Gesundheitssektor ist
tälern zwischen 1998 und 2008 gar leicht zurückgegangen (Abbildung 6). Mit wenigen Ausnahmen
zeigt sich dabei in allen Teilbereichen ein Anstieg der durchschnittlichen Betriebsgrösse. Ein
wichtiger Treiber dieses Konsolidierungseffekts ist nicht zuletzt der wachsende politische Druck
zur Kostenreduktion, der die Leistungserbringer dazu veranlasst, Synergien zu nutzen und Ska-
leneffekte zu realisieren. Speziell in den anteilsmässig wichtigsten Subbranchen, den Allgemein-
und Spezialkliniken und den Allgemein- und Fachärzten sowie in der Hauspflege, ist die durch-
schnittliche Betriebsgrösse stark angestiegen. Während bei den allgemeinen Krankenhäusern
inzwischen rund zwei Drittel der Betriebe Grossunternehmen sind (mit mehr als 95% der Be-
schäftigten, VZÄ), sind andere Teilbereiche (allen voran die Psychotherapie/Psychologie und
die nichtärztlichen Medizinalberufe) sehr kleinbetrieblich organisiert.
Abbildung 6
Veränderung der Anzahl Arbeitsplätze und Arbeitsstätten im Vergleich
Durchschnittliche jährliche Veränderung der Anzahl Arbeitsplätze (VZÄ) und Arbeitsstätten 1998–2008
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
Gesundheitswesen
Gesundheitswesen total
Allgemeine Krankenhäuser
Spezialkliniken
Arztpraxen für Allgemeinmedizin
Facharztpraxen
Zahnarztpraxen
Psychotherapie und Psychologie
Physiotherapie
Hauspflege
Nichtärztliche Medizinalberufe VZÄ
Übrige Tätigkeiten im Gesundheitswesen Arbeitsstätten
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Unterschiedliches Wettbe- Unterschiede bestehen auch mit Blick auf die Wettbewerbssituation und das Marktumfeld. Die
werbsumfeld führt zu Un- Allgemeinmedizin wird, da sie vorwiegend Leistungen im Bereich der gesetzlichen Grundversor-
terschieden in der Entwick- gung erbringt, stark von gesundheitsplanerischen Vorgaben bestimmt. Andere Subbranchen
lung der einzelnen Sub- unterliegen wesentlich stärker den Marktkräften. Nichtärztliche Aktivitäten etwa werden häufiger
branchen als ärztliche aus der eigenen Tasche bezahlt. Falls eine Zusatzversicherung dafür aufkommen
sollte, existiert oftmals kein Vertragszwang, was die Leistungserbringer dazu zwingt, den Nutzen
und die Qualität ihrer Leistung stärker zu dokumentieren und bestimmte (Effizienz-)Vorgaben
der Krankenversicherer zu erfüllen. Die unterschiedlichen Marktsituationen führen dazu, dass die
einzelnen Gesundheitsdienstleister von den verschiedenen Veränderungen der politischen Rah-
menbedingungen ungleich betroffen sind. Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Teilbe-
reiche und ihr Marktumfeld detaillierter betrachtet.
1.3 Wichtigste Anbieter
1.3.1 Krankenhäuser
Krankenhäuser: Grösste Die wichtigste Subbranche im Gesundheitswesen ist mit 133'000 Arbeitsplätzen (VZÄ) der
und stark regulierte Spitalsektor. Das Spitalwesen ist stark reguliert, der Wettbewerb daher beschränkt. Er wird
Branche zudem verzerrt durch die gesetzlichen Vorgaben der Kantone, die gleichzeitig als Regulator,
Planer, Kontrollbehörde, Spitalbetreiber und Leistungseinkäufer auftreten. Diese Mehrfachrolle
Swiss Issues Branchen 9Economic Research
bringt verschiedene Interessenkonflikte mit sich. Ziele wie Kosteneffizienz oder Behandlungs-
qualität stehen dabei teilweise im Widerspruch zu Interessen der Regional- und Arbeitspolitik.
Subventionierte Spitäler: Die Schweizer Spitallandschaft präsentiert sich weitgehend zweigeteilt. Auf der einen Seite ste-
Weitgehende Kompetenzen hen durch die öffentliche Hand subventionierte Spitäler, auf der anderen nicht subventionierte
des Kantons engen Privatspitäler. Die subventionierten Spitäler erhalten zwar kantonale Beiträge an die Betriebs-
unternehmerischen Spiel- kosten und/oder profitieren von einer Defizitgarantie. Dafür ist ihr unternehmerischer Spielraum
raum ein durch die kantonalen Vorgaben eingeengt. Im Rahmen der Spitalplanung und der daraus her-
vorgehenden Leistungsvereinbarungen kann der Kanton Einfluss nehmen auf die Investitionen,
die Zahl der Betten, das angebotene Leistungsspektrum oder die Patientensegmente. Letztlich
entscheidet der Kanton auch darüber, ob ein Spital weitergeführt oder geschlossen wird. Dar-
aus resultieren für die subventionierten Spitäler Planungsunsicherheiten und eine Einschränkung
ihres Handlungsspielraums.
Privatspitäler: Kostennach- Den nicht subventionierten Privatspitälern auf der anderen Seite entsteht durch den fehlenden
teil versus Freiräume Kantonsbeitrag ein Finanzierungsnachteil. Diesen müssen sie wettmachen. Ansatzpunkte sind
der Verzicht auf eine Allgemeinabteilung, Quersubventionierung der Allgemeinabteilung über
(Halb-)Privatabteilung mit hohen Komfortleistungen, ein strikteres Kostenmanagement oder
Verhandlungsgeschick gegenüber den Versicherern in Bezug auf die (Halb-)Privattarife. Dem
Finanzierungsnachteil steht ein grösserer unternehmerischer Handlungsspielraum gegenüber.
Diesen nutzen die Privatkliniken aus, um sich gegenüber den subventionierten (öffentlichen)
Krankenhäusern durch Qualität insbesondere in Bezug auf Komfortleistungen in Unterbringung
und Verpflegung abzugrenzen. Ausgeprägter als die Chefarztspitäler müssen die Belegarztklini-
ken nicht nur die Patienten als spezifische Kundengruppe betrachten, sondern auch die (poten-
ziellen) Belegärzte, da diese wiederum Patienten bringen. Die bisweilen geringere Bettenauslas-
tung in den Privatspitälern ist dabei oftmals keine Folge von Nachfrageproblemen, sondern Ab-
sicht – es soll eine hohe Aufnahmebereitschaft gewährleistet sein, um die Wartezeiten für die
Patienten kurz zu halten.
Tendenz zu grösseren Be- Diese Zweiteilung der Spitallandschaft zeigt sich auch in der Betriebsstruktur. Während Allge-
trieben meinkrankenhäuser weitgehend eine Grössenstrategie verfolgen, sind die überwiegende Mehr-
heit der Spezialkliniken nach wie vor Unternehmen mittlerer (48%) oder gar kleiner (21%)
Grösse (Abbildung 7). In beiden Bereichen ist jedoch eine Tendenz hin zu grösseren Betrieben
feststellbar. Die mittlere Betriebsgrösse ist sowohl bei den allgemeinen Krankenhäusern als
auch bei den Spezialkliniken seit 1998 jährlich um 4.8 bzw. 5.0% angestiegen. Die durch-
schnittliche Allgemeinklinik zählt heute 195 (Spezialklinik 55) Vollzeitbeschäftigte mehr als noch
im Jahr 1998.
Abbildung 7 Abbildung 8
Struktur des Spitalsektors Allgemeine Krankenhäuser und Spezialkliniken
Anteil Unternehmen je Betriebsgrössenklasse Entwicklung Anzahl Betriebe
Mikro (1-9 VZÄ) Klein (10-49 VZÄ) Mittel (50-249 VZÄ) Gross (≥250 VZÄ) 200
Allgemeine 190
Krankenhäuser,
2008 180
Allgemeine
170
Krankenhäuser,
2001
160
Spezialkliniken, 2008 150
Allgemeine Krankenhäuser
140
Spezialkliniken
Spezialkliniken, 2001 130
120
0% 20% 40% 60% 80% 100% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Swiss Issues Branchen 10Economic Research
Anzahl Spitäler stark rück- Bereits seit 1999 ist die Anzahl Allgemeinspitäler rückläufig (Abbildung 8). Der Rückgang ist
läufig dabei ausschliesslich auf eine Konsolidierung im Bereich der Grundversorgung zurückzuführen.
Die Anzahl Betriebe im Bereich der Zentrumsversorgung ist stabil bzw. hat seit 1998 von 25 auf
29 Betriebe zugenommen. Die Anzahl Spezialkliniken ist insgesamt stabil. Innerhalb der Spezi-
alkliniken hat jedoch die Anzahl Rehabilitationskliniken zugenommen, währenddem die Anzahl
andere Spezialkliniken mit Spezialgebieten wie Chirurgie, Gynäkologie, Pädiatrie usw. abge-
nommen hat. Es ist anzunehmen, dass sich dieser Konsolidierungs- und Spezialisierungstrend
auch künftig fortsetzen wird.
Zwang zur Konsolidierung Besonders stark ist der Konsolidierungsdruck im Bereich der hochspezialisierten Medizin. Das
in der Spitzenmedizin Krankenversicherungsgesetz fordert von den Kantonen, die Spitzenmedizin zu koordinieren. Ein
Entscheid zur Konzentration auf höchstens zwei Zentren (aktuell sind es mit Zürich, Bern und
Lausanne drei) soll 2013 gefällt werden. Auswertungen des Bundesamts für Statistik zeigen
aber, dass Leistungen der hochspezialisierten Medizin in der Schweiz nicht auf die Universitäts-
spitäler begrenzt sind, sondern auch von zahlreichen Zentrumsspitälern erbracht werden. In vie-
len Bereichen liegen dabei die durchschnittlichen Fallzahlen pro Spital mit weniger als 20 Fällen
pro Betrieb verhältnismässig tief. Kostenersparnisse und Synergieeffekte durch Zusammen-
schlüsse, Kooperationen oder Spezialisierung sind daher wohl nach wie vor realisierbar.
Sparen durch kürzere Auf- Starkes Sparpotenzial dürfte bei der Länge der Spitalaufenthalte vorhanden sein.4 Insbesondere
enthaltsdauer und ambu- kleinere Allgemeinspitäler dürften in der Lage sein, die Kosten weiter zu senken. Die durch-
lante Behandlungen schnittliche Aufenthaltsdauer über alle Krankenhäuser ist von 13.7 Tagen im Jahr 1998 auf
10.7 Tage im Jahr 2008 gesunken (–2.5% p.a.). Die Ausgabenstatistik des Bundesamts für
Statistik dokumentiert zudem, dass die Ausgaben für stationäre Akutbehandlungen deutlich un-
terdurchschnittlich wachsen, während die Ausgaben für ambulante Spitalleistungen seit 1998
durchschnittlich um jährlich mehr als 9% angestiegen sind.
Flächendeckende Einfüh- Die Reform der Spitalfinanzierung sorgt für zusätzliche Bewegung im Spitalsektor. Ab 2012 soll
rung diagnosebezogener flächendeckend eine gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur (Swiss DRG) zur Anwen-
Fallpauschalen sorgt für dung gelangen. Viele Politiker erhoffen sich dadurch mehr Transparenz und in der Folge auch
zusätzliche Bewegung eine Kostendämpfung bei der allgemeinen Krankenversicherung. Swiss DRG sieht vor, sämtli-
che akut-somatischen Spitalleistungen mittels fixierter Tarife zu entschädigen. Weil Patienten
aufgrund ihres Krankheitsbildes unterschiedliche Kosten verursachen, werden die Patienten in
sogenannte diagnosebezogene Fallgruppen (engl. Diagnosis Related Groups, DRG) eingeteilt.
Die Fallgruppe richtet sich nach Diagnose, Nebendiagnosen, nötigen Behandlungen, dem Be-
handlungsstadium sowie demographischen Angaben zum Patienten (Alter und Geschlecht).
Daraus ergibt sich ein Kostengewicht für die einzelnen Patienten. Multipliziert mit einem Basis-
preis ergibt sich die leistungsbezogene Fallpauschale. Weil diese unabhängig von den tatsächli-
chen Kosten ausgerichtet wird, erzielen überdurchschnittlich effiziente Spitäler Gewinne. Es er-
geben sich Anreize für Kosteneinsparungen.
Erfolg von Swiss DRG Die Finanzierung via DRG kann jedoch auch unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringen –
hängt von konkreter Um- etwa Anreize, Patienten, welche überdurchschnittlich hohe Kosten verursachen, rasch loszu-
setzung ab werden, sogenannte "blutige" Entlassungen, oder Anreize, die Patienten sogleich als neuen Fall
wieder zu hospitalisieren (sog. "Drehtüreneffekt"). Zudem besteht grundsätzlich ein erheblicher
Spielraum bei der Codierung der Fälle und die Gefahr, Kostenersparnisse via Abstriche bei der
Qualität der Leistungen zu erreichen. Untersuchungen in Ländern, die bereits über ein derarti-
ges System verfügen, bestätigen sowohl die deutliche Abnahme der durchschnittlichen Verweil-
dauer, die Zunahme der ambulanten Leistungserbringung sowie auch die unerwünschten Ne-
beneffekte. Swiss DRG kann von diesen Erfahrungen profitieren. So wurde ein System ge-
schaffen, welches derartige Fehlanreize kompensieren soll und zudem die Spitäler für unter-
schiedliche Aufwendungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung ent-
schädigt.
4 Vgl. dazu die Studie von Farsi, Mehdi und Massimo Filippini (2006): An Analysis of Efficiency and Productivity in Swiss Hospitals. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirt-
schaft und Statistik, Vol. 142 (1), 1–37.
Swiss Issues Branchen 11Economic Research
1.3.2 Ärzte
Verschiebung von Die Ärzte sind nach den Krankenhäusern die grösste Gruppe der Gesundheitsdienstleister.
Allgemeinmedizinern zu 2008 wurden in allgemeinmedizinischen und Facharztpraxen rund 26'800 Vollzeitstellen gezählt.
Spezialärzten Dies waren rund 1'100 Vollzeitstellen mehr als noch 1998. Auffallend ist insbesondere die Ver-
schiebung innerhalb der Ärzteschaft: Die Allgemeinmediziner verzeichneten zwischen 1998 und
2008 einen leichten Stellenabbau von –0.9% p.a., während die Spezialarztpraxen um 3.9% p.a.
zulegten. Im Bereich der Allgemeinmedizin wurden im Jahr 2008 1'453 Praxen und 1'723 Voll-
zeitstellen weniger gezählt als 1998 (Abbildung 9). Im gleichen Zeitraum wurden 470 Facharzt-
praxen mit 2'859 Vollzeitstellen geschaffen.
Abbildung 9 Abbildung 10
Entwicklung Allgemeinmedizin- und Facharztpraxen Umsatz- und Preisentwicklung bei Ärzten 1998–2008
Anzahl Arbeitsstätten Durchschnittliche Veränderung 1998–2008 pro Jahr in Prozent; * Werte 2007
Arztpraxen für Allgemeinmedizin Facharztpraxen 5%
8'000
7'000 4%
6'000
3%
5'000
4'000
2%
3'000
2'000 1%
1'000
0%
0 Gesamtumsatz Preise für Anzahl Ärzte mit Umsatz pro Arzt mit
1998 2001 2005 2008 Ärzte* Arztleistungen Praxisbewilligung Praxisbewilligung*
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Jeder zugelassene Arzt darf Der Wettbewerb unter den Ärzten ist durch eine hohe Regulierungsdichte gekennzeichnet, wel-
seine Leistungen zulasten che die unternehmerische Freiheit einschränkt. Die Preise der ambulanten Einzelleistungen sind
der Grundversicherung im Tarmed festgelegt; der einzelne Arzt kann lediglich die Menge bzw. die aufgewendete Ge-
gemäss Tarmed abrechnen samtzeit der Behandlung bestimmen. Entsprechend der planerischen Vorgabe zeigt sich bei den
Preisen ein Nullwachstum (Abbildung 10). Zudem besteht der sogenannte Kontrahierungs-
zwang. Das bedeutet, dass jeder zugelassene Arzt Leistungen zulasten der Grundversicherung
erbringen darf und die Krankenkassen diese Leistungen entsprechend abgelten müssen. Ein
Preiswettbewerb unter den Ärzten findet somit nicht statt.
Kommunikation mit dem Wenn die Preise für eine Leistung fixiert respektive für den Konsumenten nicht erkennbar sind,
Patienten als zentraler sollte der Wettbewerb vor allem über die Qualität erfolgen. Diese ist aber schwer mess- und
Erfolgsfaktor daher nur beschränkt vergleichbar. Für den Patienten steht deshalb das Vertrauensverhältnis
zum Arzt im Zentrum. Dabei ist nebst der fachlichen Kompetenz die Kommunikation mit dem
Patienten zentral. Im Zeitalter des Internets können sich die Patienten viel einfacher Informatio-
nen über Krankheiten und Behandlungsmethoden beschaffen, als dies früher der Fall war. Kos-
tenlose Zweitmeinungsangebote und gute Informationsplattformen durch Versicherer unterstüt-
zen die Konsumenten in ihrer Entscheidungssouveränität. Darüber hinaus sind ein der Haupt-
kundschaft angepasster Standort, entsprechende Öffnungszeiten sowie eine gute Vernetzung
mit anderen Leistungserbringern des Gesundheitswesens wichtige Erfolgsfaktoren.
Einzelpraxis nach wie vor Zusammenschlüsse und Gemeinschaftspraxen, die derartigen Kundenbedürfnissen besser ent-
dominierend, aber Trend zu sprechen, liegen daher grundsätzlich auch im Interesse der Ärzteschaft. Eine leichte Tendenz
Gemeinschaftspraxen, in- hin zu grösseren Praxen ist bereits heute feststellbar. Unter den allgemeinmedizinischen Praxen
tegrierter Versorgung und ist die Einzelpraxis jedoch nach wie vor die dominierende Unternehmensform. 98.5% der Pra-
Budgetverantwortung xen sind Mikrounternehmen mit 1–9 Vollzeitstellen. Bei den Spezialarztpraxen ist dieser Anteil
mit 96.5% etwas geringer. Der Trend geht indes nicht nur in Richtung zunehmender Grösse,
Swiss Issues Branchen 12Economic Research
sondern ebenso in Richtung integrierter Versorgung und Budgetverantwortung (Stichwort: Ma-
naged Care, vgl. Box).
Veränderung der Ärzte- Weitere Themen, die die Branche momentan beschäftigen, sind die Auswirkungen der struktu-
schaft durch Gender- und rellen Verschiebungen innerhalb der Ärzteschaft. Der Ersatz von Ärzten im Pensionsalter durch
Generationenverschiebun- junge Mediziner ist nicht zuletzt auch durch den Ärztestopp ins Stocken geraten. Infolge des
gen sowie Migration zunehmenden Anteils an weiblichen Ärzten steigt der Wunsch zu Teilzeitarbeit. In den letzten
Jahren hat sich zudem die Einwanderung von Ärzten (insbesondere aus dem EU-Raum) ver-
stärkt. Zwischen 2002 und 2009 wurden im Durchschnitt pro Jahr mehr als 700 ausländische
Ärzte mit Weiterbildungstiteln anerkannt. Da der Kommunikation mit den Patienten eine zentrale
Bedeutung zukommt, überrascht es kaum, dass durchschnittlich beinahe 80% der ausländi-
schen Ärzte aus den Nachbarländern Deutschland (71%), Frankreich (4%) und Italien (5%)
stammen.
Box: Managed Care
Unter Managed Care werden Alternativen zur aktuellen Grundform der obligatorischen Krankenversicherung
verstanden, in denen die medizinische Versorgung von der Diagnose bis zur letzten Therapie aus einer Hand
gesteuert wird und die Versicherer und Leistungserbringer die finanzielle Verantwortung der Behandlung mit-
tragen. Als Gegenleistung für die eingeschränkte Arztwahl erhält der Patient vergünstigte Prämien. Die in der
Schweiz am häufigsten praktizierten Beispiele sind Health Maintenance Organizations (HMO) sowie Haus-
arztmodelle.
HMO werden entweder von den Krankenkassen selbst eingerichtet – die in den HMO tätigen Ärzte sind in
diesem Fall von der Krankenkasse angestellt – oder die Krankenkassen schliessen mit einem bestehenden
Ärztenetzwerk Verträge ab. Der Patient verpflichtet sich, ausser in Notfällen immer zuerst die HMO aufzusu-
chen. Diese leitet ihn bei Bedarf an andere Gesundheitsdienstleister, mit denen sie vernetzt ist, weiter. Die
HMO erhält ein Budget, mit dem sie alle Kosten decken muss. Der Arzt bzw. das Netzwerk wird bei Unter-
und Überschreitung des Budgets am Gewinn bzw. Verlust beteiligt. Auf diese Weise werden die Ärzte nicht
nur für Mengenausweitungen belohnt, sondern auch für Kosteneinsparungen. Dies nährt auf Patientenseite
allerdings die Befürchtungen, dass ihnen aus Spargründen Leistungen vorenthalten werden könnten. Erfah-
rungen zeigen jedoch, dass diese Ängste nicht berechtigt sind, sondern aufgrund der engeren Abstimmung
der Versorgung gar eine insgesamt bessere Versorgung resultieren kann.
HMO-Modelle unterscheiden sich vom einfachen Hausarztmodell. Bei den Hausarztmodellen verpflichtet sich
der Versicherte, im Krankheitsfall stets zuerst seinen Hausarzt aufzusuchen. Diesen hat er vorgängig aus
einer Liste von Ärzten ausgewählt, die sich an diesem Modell beteiligen. Bei Bedarf überweist der Hausarzt
den Patienten an einen Spezialisten oder ins Spital. Die Vergütung der Leistungen erfolgt nach den üblichen
Tarifen. Unterbunden wird in diesem Modell der freie Zugang zu Spezialärzten.
Die Zahl der Versicherten mit eingeschränkter Arztwahl hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen.
Angesicht der ständig steigenden Prämienlast der obligatorischen Krankenversicherungen suchen immer mehr
Versicherte nach Sparmöglichkeiten. In verschiedenen Regionen sind Ärztenetzwerke heute bereits gut veran-
kert, wobei die Verbreitung in der föderalistisch geprägten Schweiz regional sehr unterschiedlich ist. 2008
wählten bereits 30% der Versicherten eine Einschränkung ihrer Wahlmöglichkeiten. Da man sich von einer
stärkeren Verbreitung solcher Modelle substanzielle Kosteneinsparungen erhofft, diskutieren die eidgenössi-
schen Räte derzeit darüber, wie Managed Care gefördert werden soll. Geplant ist aktuell eine höhere Kosten-
beteiligung von Patienten, die nicht einem solchen Modell beitreten. Dabei könnte sich insbesondere das
diskutierte Obligatorium, in allen Regionen HMO-Modelle anzubieten, als Bumerang herausstellen. Ein sol-
ches Obligatorium macht in ländlichen Regionen wenig Sinn, weil es zu einer zwangsweisen Implementierung
führen würde und diese HMO gegenüber den Krankenversicherern faktisch eine Monopolposition einnehmen
würden. Ausserdem würde eine Vereinheitlichung der HMO-Modelle deren Kreativitäts- und Innovationspoten-
zial weitgehend zunichte machen.
Swiss Issues Branchen 13Economic Research
1.3.3 Zahnärzte
Der grösste Teil der Zahn- Im Gegensatz zu den ärztlichen Leistungen werden mehr als 90% der zahnärztlichen Behand-
arztkosten wird aus der lungen aus der eigenen Tasche bezahlt. Von der sozialen Krankenversicherung wird nur ein
eigenen Tasche bezahlt kleiner Teil aller Leistungen übernommen (ca. 4%). Die Krankenpflege-Leistungsverordnung
zählt rund 40 (seltene) Erkrankungen auf, die von der obligatorischen Grundversicherung ge-
deckt sind. Im Vergleich zu den Allgemeinmedizinern sind die Zahnärzte daher seit langem we-
sentlich stärker dem Wettbewerbsdruck ausgesetzt und entsprechend auf die Konsumentenbe-
dürfnisse ausgerichtet.
Geringe Zahnarztdichte im Mit ca. 5 Zahnärzten pro 10'000 Einwohner ist die Zahnarztdichte in der Schweiz für ein Indus-
internationalen Vergleich trieland eher tief (Abbildung 11). Der EU-15-Durchschnitt liegt 2006 bei gut 7 Zahnärzten pro
10'000 Einwohner. Es bestehen aber relativ grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Län-
dern. Griechenland weist unter den EU-15-Länder mit fast 13 Zahnärzten pro 10'000 Einwoh-
ner die höchste Zahnarztdichte auf.
Abbildung 11 Abbildung 12
Zahnarztdichte im internationalen Vergleich Entwicklung der Zahnarztpraxen-Landschaft
Anzahl Zahnärzte pro 10'000 Einwohner Anzahl Zahnärzte, Zahnarztpraxen und Beschäftigte (VZÄ) in Zahnarztpraxen
Index 1998 = 100
EU-15 Min/Max EU-15-Durchschnitt 115
Schweiz Deutschland Frankreich VZÄ in Zahnarztpraxen
Italien Österreich Schweden 110
12 Zahnarztpraxen
Zahnärzte in freier Praxis
105
10
8 100
6 95
4 90
2 85
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1998 2001 2005 2008
Quelle: World Health Organization, Credit Suisse Economic Research Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Mehr Zahnärztinnen, mehr Die auf Basis der Ärzte mit Praxisbewilligung berechnete Schweizer Zahnarztdichte von 5.18
Teilzeitarbeit pro 10'000 Einwohner lässt den Beschäftigungsgrad unberücksichtigt. Die Anzahl Zahnärzte
mit Praxisbewilligung nahm zwischen 1998 und 2008 um 517 Zahnärzte oder knapp 1.4% p.a.
zu (Abbildung 12). Der Anstieg fand dabei zwischen 2001 und 2008 statt. Die vollzeitäquivalen-
te Beschäftigung in der Branche blieb lange Zeit eher stabil und hat erst seit 2005 wieder zu-
genommen (2005–2008: +2.0% p.a.). Der Grund für diese Divergenz ist einerseits wohl in der
vermehrten Teilzeitarbeit zu suchen. Dieser Schluss liegt nahe, weil der Anteil der Frauen unter
den Studienabgängern in der Fachrichtung Zahnmedizin in den letzten 10 Jahren stark ange-
stiegen ist. Andererseits dürfte auch die verstärkte Einwanderung ausländischer Zahnärzte seit
Inkrafttreten der bilateralen Verträge eine Rolle spielen.
Gruppenpraxen und Zahn- Der Rückgang der Anzahl Zahnarztpraxen (Abbildung 12) dokumentiert, dass sich auch bei den
arztzentren im Trend Zahnärzten ein Trend hin zu grösseren Einheiten abzeichnet. Gruppenpraxen und Zahnarztzent-
ren sind stark im Kommen. In grösseren Einheiten kann ein umfassendes Leistungsspektrum
angeboten werden. Die Infrastruktur und das Hilfspersonal können besser ausgelastet und die
vor allem in der Anfangszeit hohen Kapitalkosten geteilt werden. Zudem sind längere Öffnungs-
zeiten, die einem zunehmenden Kundenbedürfnis entsprechen, organisatorisch einfacher umzu-
setzen. Der Regelfall ist jedoch nach wie vor die Einzel- oder Kleinpraxis mit mehreren nichtärzt-
lichen Angestellten (Administration, Dental- und Prophylaxeassistenz, Dentalhygiene). Rund
95% der Betriebe zählen 1–9 Vollzeitstellen.
Swiss Issues Branchen 14Economic Research
Keine Angebotsverdichtung Auch bei Zahnärzten ist die hohe Migration ein Thema. Zwischen 2002 und 2008 wurden im
trotz Zuwanderung aus Bereich der Zahnmedizin jährlich rund 300 ausländische Diplome anerkannt. Rund 60% davon
dem EU-Raum entfallen auf deutsche, 18% auf französische und 9% auf italienische Zahnärzte. Offen ist, wie
viele tatsächlich in den Schweizer Markt eintreten. Der Gang in die Selbständigkeit auf dem
Schweizer Markt erfordert von ausländischen Interessenten profunde Kenntnisse des hiesigen
Gesundheits- und Rechtssystems. Da sich auch bei den Zahnärzten der demographische Wan-
del immer mehr bemerkbar macht, füllen die infolge des Freizügigkeitsabkommens aus dem
EU- und EFTA-Raum zuwandernden Zahnärzte eher eine demographische Lücke, als zu einer
Überversorgung zu führen.
1.3.4 Alters- und Pflegeheime
Alters- und Pflegeheime: Der Bereich Alters- und Pflegeheime umfasst mehr als 76'000 Vollzeitstellen. Seit 1998 wurde
Gewichtiger Teilbereich mit die Anzahl Stellen in den Alters- und Pflegeheimen insgesamt jährlich um durchschnittlich 4.2%
starkem Wachstum ausgeweitet, wobei offenbar gleichzeitig eine Verlagerung von Alters- hin zu Pflegeheimen
stattgefunden hat. Gemäss Statistik der sozialmedizinischen Institutionen unterscheiden sich
Alters- und Pflegeheime von der Struktur ihrer Angestellten her nur unwesentlich. In beiden Fäl-
len setzt sich die Belegschaft aus einem grossen Anteil Pflegefachpersonal und Beschäftigten
im Bereich der Alltagsgestaltung (57.8% bzw. 66.1%), einem etwas kleineren Teil im Bereich
Verwaltung, Hausdienste, technische Dienste (42.2% respektive 33.8%) und einem geringen
Anteil an Ärzten und anderen Akademikern (0.13% respektive 0.08%) zusammen.
Drei Viertel der Heime sind Die Statistik der sozialmedizinischen Institutionen zählte 2008 schweizweit rund 1'600 Alters-
öffentlich subventioniert und Pflegeheime und 780 sonstige sozialmedizinische Institutionen (für Menschen mit Behinde-
rungen, Suchtproblemen und psychosozialen Probleme). Rund 60% der Alters- und Pflegehei-
me sind entweder öffentliche Institutionen oder solche, die staatlich subventioniert werden (Be-
triebsbeitragsgarantie oder Defizitdeckung). Das heisst, weniger als 40% haben eine private
Trägerschaft und werden nicht subventioniert. Bei den sonstigen sozialmedizinischen Institutio-
nen sind es mit knapp 14% deutlich weniger. Während die staatlich subventionierten Heime
dem Spardruck der Gemeinden und Kantone unterliegen, können private Heime Qualitäts- bzw.
Komfortstufen anbieten, die den Standard in den öffentlichen Heimen übertreffen.
Flexibilisierung des Rund 186'000 Personen wurden 2008 in Heimen betreut, 137'000 davon in Pflege- und Al-
Angebots tersheimen. Dabei sind insbesondere bei den Alters- und Pflegeheimen die Plätze für Externe
von untergeordneter Bedeutung. Allerdings werden auch hier die Dienstleistungen für Externe
(Mahlzeiten-, Fahrdienst, Veranstaltungen etc.) zunehmend ausgebaut. Das gesellschaftliche
Bedürfnis nach mehr Flexibilität äussert sich überdies in neueren Formen der Teilzeitbetreuung.
Bei diesen werden zwischen zwei und fünf fixe Tage im Alters- oder Pflegeheim gebucht; die
anderen Wochentage werden zuhause verbracht, in der Regel betreut von Familienangehörigen.
Viele Institutionen bieten zudem Ferienaufenthalte an.
Künftige Kapazitäts- Anders als im Spitalbereich scheint die Schliessung von Pflege- und Altersheimen kein Thema.
engpässe? Die Anzahl Heime ist zwischen 1998 und 2008 angestiegen. Rund 80 zusätzliche Institutionen
sind seit 1998 eröffnet worden, wobei sich auch hier eine Verschiebung von Alters- hin zu Pfle-
geheimen zeigt. Die Alters- und Pflegeheime operieren bereits heute mit einer hohen Auslas-
tung von durchschnittlich 95%. Im Zuge der demographischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen wird die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter ansteigen. Die geburtenstarke Gene-
ration der Babyboomer geht in Rente und erreicht nach und nach auch das Alter, in welchem
die Pflegebedürftigkeit zum Thema wird.
Steigende Nachfrage nach Gleichzeitig nimmt die Zahl derjenigen ab, die informelle Pflege- und Betreuungsleistungen rund
flexiblen Unterstützungs- um die Uhr erbringen können oder wollen. Einerseits liegt dies an der geringeren Kinderzahl,
angeboten und Hauspflege andererseits aber auch an den soziodemographischen Entwicklungen. Immer häufiger wohnen
die Nachkommen von den Eltern entfernt, was Betreuungsaufgaben erschwert oder verunmög-
licht. Die Frauenerwerbsquote ist stark angestiegen und wird auch künftig weiter zunehmen. Die
erwerbstätigen Frauen fehlen aber in der informellen Pflege, bei der sie heute die Hauptlast tra-
gen. Die Nachfrage nach partiellen familienexternen Unterstützungsangeboten, aber auch nach
Hauspflegeleistungen, Besuchsdiensten und Haushaltshilfen wird daher künftig stark zuneh-
Swiss Issues Branchen 15Economic Research
men. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das längere Verbleiben in der eigenen Wohnung und der
vertrauten Umgebung einem grossen Bedürfnis entspricht.
Heime immer mehr als Trotz bis auf weiteres gesicherter Nachfrage wird es für die Alters- und Pflegeheime immer
Dienstleistungsunterneh- wichtiger, als moderne Dienstleistungsunternehmen geführt zu werden (klare strategische Posi-
men geführt tionierung, Qualitätsmanagement, Marketing, Prozessoptimierung u.ä.). Zum einen haben die
Kunden hohe Ansprüche an die Qualität der angebotenen Infrastruktur und der Dienstleistun-
gen. Zum anderen werden diese Ansprüche mit zunehmender Eigenbeteiligung an der Finanzie-
rung weiter zunehmen. Die sich individualisierenden Bedürfnisse und damit auch die steigende
Vielfalt der Angebote an Wohnformen für das Alter, die sich gegenseitig ergänzen, aber auch
konkurrenzieren, sorgen zudem für einen gesunden Wettbewerb innerhalb der Branche.
Swiss Issues Branchen 16Economic Research
2 Regionale Bedeutung
Spannungsfeld zwischen Der Gesundheitssektor befindet sich im Spannungsfeld zwischen Konzentration und Spezialisie-
Konzentration und Versor- rung auf der einen Seite sowie der Nähe zu Kunden bzw. Patienten auf der anderen Seite. Ar-
gungsauftrag beitsteilungs- und Effizienzüberlegungen wirken dabei oftmals in Richtung Konzentration der
Leistungserstellung, während die notwendige Nähe zum Konsumenten und der Versorgungs-
auftrag der Konzentration entgegenwirken. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen –
auch anderen Dienstleistungsbranchen – spielen im Gesundheitsbereich Zugangs- und Versor-
gungsgesichtspunkte eine besonders gewichtige Rolle. Die Gewährleistung einer angemesse-
nen Versorgung ist gar in der Verfassung verankert.5
2.1 Regionale Spezialisierungen
Kantonale Unterschiede in Die regionale Verteilung des Gesundheitssektors ist durch verschiedene Faktoren bedingt. Aus
der Grösse des Gesund- dem Zusammenspiel von Spezialisierungen und der Notwendigkeit einer flächendeckenden me-
heitssektors dizinischen Versorgung der Bevölkerung ergeben sich regionale Unterschiede in der Konzentra-
tion und der Ausbildung von Schwerpunkten bestimmter Fachrichtungen. Inwieweit Verteilung
und Entwicklung des Sektors der Bevölkerungsverteilung oder der Wirtschaftsentwicklung fol-
gen, soll durch einen regionalen Vergleich der Versorgungsdichte des Gesundheitswesens be-
leuchtet werden. Ein erster Blick auf die kantonale Verteilung der Gesundheitsversorgung zeigt
die Unterschiede, gemessen an der Verteilung der Beschäftigten (Abbildung 13).
Abbildung 13
Kantonale Bedeutung des Gesundheitssektors
Anteile am Total der Schweiz in Prozent 2008
18%
Bevölkerungsanteil Beschäftigtenanteil am Gesundheitssektor
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
ZH BE VD AG SG GE LU TI VS BL FR SO TG GR BS NE SZ ZG SH JU AR NW GL UR OW AI
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Unterschiedlich ausgepräg- Wäre die Verteilung des Gesundheitswesens allein durch die Versorgungsfunktion begründet,
te Versorgungsfunktion der müsste die Branche ähnlich wie die Bevölkerung verteilt sein – mit einer starken Konzentration
Zentrumskantone für ihr in der Nordschweiz sowie in der Genferseeregion und insbesondere in städtischen Zentren,
Umland welche häufig ein Teil der Versorgung für das Umland bereitstellen. Bereits auf der kantonalen
Ebene zeigen sich jedoch Abweichungen von diesem Erklärungsmuster. Die meisten grossen
5 BV Art. 41 Abs. 1b: Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass jede Person die für ihre Gesundheit
notwendige Pflege erhält.
Swiss Issues Branchen 17Economic Research
Zentren erreichen höhere Anteile am Gesundheitssektor, was auf ihren grösseren Einzugsbe-
reich zurückzuführen ist. Der Kanton Waadt ist mit seinem Zentrum Lausanne ebenfalls in der
vorderen Reihe präsent.
Kantonale Vielfalt in der Die Kantone unterscheiden sich nicht nur in der Verteilung des Gesundheitswesens, sondern
Gesundheitsversorgung auch in der fachlichen Spezialisierung innerhalb des Sektors. Die zunehmende Spezialisierung
der Medizin und die Konzentration der Gesundheitsbranche machen sich auch regional bemerk-
bar. Neben dem Versorgungsaspekt ist es auch ökonomisch relevant, wenn bestimmte Berei-
che des Gesundheitssektors die regionale Wirtschaft prägen. Abbildung 14 zeigt die Bedeutung
einzelner Segmente des Gesundheitssektors gemessen am Beschäftigungsanteil für die Kanto-
ne der Schweiz und weist auf erste Spezialisierungen hin. Bei Ärzten und Beschäftigten in Kran-
kenhäusern sind über die Kantone der Schweiz relativ geringe Schwankungen erkennbar. Le-
diglich in Neuenburg und Appenzell A.Rh. ist der Anteil Ärzte und Krankenhäuser vergleichswei-
se eher tief, wobei sich dies im Fall von Appenzell A.Rh. durch die ausserordentlich hohen An-
teile in Appenzell I.Rh. relativiert. Sowohl in Neuenburg als auch in Appenzell A.Rh. sind zudem
Spezialkliniken relativ stark vertreten. Im Bereich Spezialkliniken unterscheiden sich die Kantone
denn auch deutlich. Während in Kantonen wie Appenzell A.Rh., Neuenburg, Basel Stadt oder
Thurgau ein Viertel bis ein Drittel der Beschäftigten des Gesundheitssektors in Spezialkliniken
arbeiten, sind diese in den meisten Kantonen weniger bedeutend und bleiben mit ihrem Be-
schäftigungsanteil unter dem Schweizer Durchschnitt von 12%.
Abbildung 14
Vielfalt der kantonalen Gesundheitsversorgung
Anteil der Subbranchen am Total der Beschäftigung des Gesundheitssektors 2008 in Prozent
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AI OW SZ NW UR JU GL FR SO TI BL BE LU SH GE VD CH SG ZH ZG VS AG GR TG BS NE AR
Krankenhäuser Ärzte Übrige Pflege Spezialkliniken
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Pflege gewinnt (fast) Abbildung 15 zeigt für die einzelnen Kantone, wie viel die einzelnen Subbranchen innerhalb von
überall an Bedeutung 10 Jahren zum Ausbau des Gesundheitssektors beigetragen haben. Der stärkste Beschäfti-
gungszuwachs entfällt in den meisten Kantonen auf den Pflegebereich. Auch in allgemeinen
Krankenhäusern und Spezialkliniken wurde 1998 bis 2008 das Personal ausgebaut, je nach
Kanton jedoch in sehr unterschiedlichem Ausmass. Hierdurch lassen sich auch die Unterschie-
de zwischen dem Gesundheitssektor als Ganzem und der Allgemeinmedizin erklären. Zug hatte
beispielsweise im Gesundheitssektor insgesamt ein überdurchschnittliches Wachstum zu ver-
zeichnen, bei der Allgemeinmedizin aber sogar einen leichten Rückgang. Anhand der Subbran-
chen wird deutlich, dass in diesem Fall vor allem die Beschäftigung in Pflegeheimen sowie Spe-
zialkliniken zugenommen hat, was die Gesamtentwicklung im Gesundheitswesen prägte. In eini-
gen Kantonen gab es auch Verschiebungen unter den Gesundheitsdienstleistern, so etwa in
Swiss Issues Branchen 18Economic Research
Neuenburg von den allgemeinen Krankenhäusern zu Spezialkliniken oder in Schaffhausen, wo
eine Spezialklinik durch eine Allgemeinklinik übernommen wurde.
Abbildung 15
Entwicklung des Gesundheitssektors nach Subbranchen
Wachstumsbeiträge der Subbranchen zur Beschäftigungsentwicklung im Gesundheitswesen des jeweiligen Kantons 1998–
2008 in Prozent; durchschnittliches jährliches Beschäftigungswachstum im Gesundheitswesen 1998–2008 in Prozent
70% 7%
Krankenhäuser Spezialkliniken
60% Ärzte Fachärzte 6%
Pflegeheime Übrige
50% Gesundheitswesen (rechte Skala) 5%
40% 4%
30% 3%
20% 2%
10% 1%
0% 0%
-10% -1%
-20% -2%
-30% -3%
UR SZ ZG SG VS SO TG OW LU ZH NW BL CH VD JU BE AG TI SH BS FR GR AR NE GE GL AI
Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research
Gesundheitsversorgung Für den Gesundheitssektor haben Kantone als politisch-administrative Einheiten eine grosse
wirkt über Kantonsgrenzen Bedeutung, da viele Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebene definiert werden. Zudem wir-
hinaus ken Kantone als Regulator und Planer und sind gleichzeitig in etlichen Fällen Eigentümer und
Betreiber von Gesundheitseinrichtungen. Wirtschaft und Bevölkerung entwickeln sich jedoch
über Kantonsgrenzen hinweg oder in kleinerem räumlichem Massstab. Es entstehen funktionale
Verbindungen nicht nur zwischen Wohnorten und Wirtschaftszentren, sondern auch Versor-
gungsbeziehungen zu Gesundheitseinrichtungen. Die Analyse der Entwicklung auf regionaler
Ebene bietet daher eine noch bessere Annäherung an die Gegebenheiten.
Fachmedizin mit deutlicher Abbildung 16 zeigt die regionale Spezialisierung in der Fachmedizin – für Spezialklinien und
regionaler Konzentration Fachärzte – auf Ebene der Wirtschaftsregionen. Spezialkliniken spielen vor allem in der Nord-
schweiz eine Rolle: im Grossraum Zürich, einzelnen Regionen der Kantone Thurgau und St.
Gallen, im nördlichen Aargau sowie in Basel-Stadt. Auffällig ist dabei, dass diese Spezialisierun-
gen gerade in der Nordschweiz ausserhalb der Zentren Basel und Zürich nicht mit einer über-
durchschnittlichen Versorgungsdichte im Gesundheitswesen verknüpft sind. Weitere weniger
deutlich ausgeprägte Schwerpunkte liegen in der Westschweiz in den Kantonen Neuenburg und
Waadt, im Wallis sowie im Kanton Bern. Die Spezialisierungen sind hier allerdings nicht so dicht.
Lokal sind zudem in Graubünden Spezialisierungen zu verzeichnen, beispielsweise durch histori-
sche Standorte oder spezielle Kurkliniken in Bade- oder Luftkurorten. Spezialisierungen im Be-
reich der Fachärzte sind generell weniger ausgeprägt als solche von Kliniken.
Swiss Issues Branchen 19Sie können auch lesen