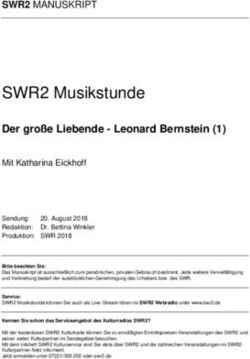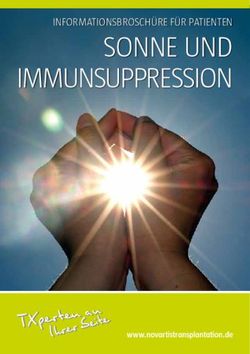SWR2 Glauben 450 JAHRE GALILEO GALILEI
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Glauben 450 JAHRE GALILEO GALILEI EINE SPURENSUCHE IN ROM VON JAN-CHRISTOPH KITZLER SENDUNG 01.11.2014 / 12.05 UHR Redaktion Religion, Kirche und Gesellschaft Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR SWR2 Glauben können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/glauben.xml Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de
Musik: John McLaughlin…
OT 1 Galileo Galilei, Sprecher1: Ich, Galileo Galilei, Sohn von Vincenzo Galilei
aus Florenz, 70 Jahre alt und persönlich vor dem Gericht erschienen, kniend
vor Euch, höchst erhabene und ehrwürdige Herren Kardinäle […], mit den
geheiligten Evangelien vor Augen, die ich mit meinen Händen berühre,
schwöre, stets geglaubt zu haben, gegenwärtig zu glauben und in Zukunft mit
Gottes Hilfe glauben zu wollen alles das, was die katholische und apostolische
Kirche für wahr hält, predigt und lehret. […]
Autor: Der Abschwur Galileo Galileis in Rom war der Höhepunkt einer mehr als
schwierigen Beziehung, einer Geschichte voller Widersprüche und
Missverständnisse, einer Geschichte von Unterdrückung und
Selbstüberschätzung.
Sprecher 1 weiter … Ich bin des Verdachtes der Häresie beschuldigt worden,
weil ich daran festgehalten und geglaubt habe, dass die Sonne das Zentrum
der Welt sei und unbewegt, und dass die Erde nicht das Zentrum sei und sich
bewegt. […] Ich Galileo Galilei habe abgeschworen und versprochen, und im
Glauben an die Wahrheit habe ich mit eigener Hand dieses Dokument
meiner Abschwur unterschrieben, und es Wort für Wort vorgelesen. In Rom, im
Kloster der Minerva, an diesem 22. Juni 1633.
Autor: Der Konflikt mit der katholischen Kirche hat Galilei, der vor 450 Jahren
zur Welt kam, zum Symbol gemacht für eine um die Wahrheit kämpfende
Wissenschaft. Und er hat dazu beigetragen, dass die katholische Kirche bis
heute von nicht wenigen für wissenschaftsfeindlich gehalten wird.
Der Abschwur im Sommer 1633 fand nicht im Vatikan statt, auch nicht im dem
Palast, gleich neben dem Petersplatz, in dem heute die
Glaubenskongregation ihren Sitz hat und zur Galilei-Zeit die zentrale
Inquisitionsbehörde der Katholischen Kirche.
Dieser hochsymbolische Moment geschah mitten in Zentrum Roms.
2Atmo: Vor der Kirche Santa Maria Sopra Minerva
Autor: Gleich neben dem Pantheon stand damals und steht heute noch die
Kirche Santa Maria sopra Minerva, davor Berninis berühmter Elefant, der einen
Obelisken trägt. Es ist die Kirche eines alten Dominikaner-Klosters. Und weil die
Dominikaner jahrhundertelang eine wichtige Rolle in der Inquisition gespielt
hatten, trafen sich hier die Kardinäle der „Kongregation der römischen und
allgemeinen Inquisition“, die 1542 neugegründet worden war. Jeden
Mittwoch – auch der 22. Juni 1633, der Tag, an dem Galileo Galilei
abschwören musste, war ein Mittwoch, ein normaler Sitzungstag also.
Daniele Ols ist heute der Prior, der Vorsteher des Klosters. Früher hat der
Franzose in der „Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse“
gearbeitet, einer der Behörden der römischen Kurie.
Atmo: Kreuzgang
Autor: Jetzt steht er in schwarz-weißer Ordenstracht im Kreuzgang des Klosters,
im Hof recken sich mehrere Palmen hoch in den Himmel. Man sagt, es seien
die höchsten von Rom. Das Minerva-Kloster war spätestens seit dem 15.
Jahrhundert ein wichtiger Ort in der Stadt. Zwei Päpste wurden hier gewählt,
Prozessionen begannen hier oder kamen hier an. Bis zur Einnahme Roms 1870
durch italienische Truppen besuchte es der Papst jedes Jahr. Padre Ols erklärt,
wie es 1633 war:
OT2 Padre Daniele Ols, OP (Sprecher 2): Zu Galileos Zeit gab es diesen
Kreuzgang bereits, der im 16. Jahrhundert gebaut wurde. Wenn die Kardinäle
Inquisitoren ankamen, gingen sie durch das Tor des Klosters, wo wir
hineingekommen sind, dann durchquerten sie hier den Kreuzgang, und
stiegen schließlich die Treppe dort in der Mitte des Kreuzgangs hoch.
Autor: Der Saal, in dem die Sitzungen stattfanden, gehört heute nicht mehr
zum Dominikanerkloster. Man muss zurück auf die Straße und einmal um den
Block.
3Atmo: in der Bibliothek
Autor: Dieser recht große Saal ist inzwischen Teil der Bibliothek des
italienischen Parlaments. Man sieht noch die alten Deckenfresken. Ansonsten
hat sich das Szenario stark verändert. Wo heute ein Lesesaal ist mit schweren
Holzmöbeln und Bücherregalen, saßen vor fast 400 Jahren die Kardinäle
zusammen.
OT3 Daniele Ols, OP (Sprecher 2): In diesem großen Saal stand ein großer
Tisch, so ausgerichtet. Ein anderer Tisch war in die andere Richtung
ausgerichtet. In der Ecke nahm der Kardinal Platz, der der Sitzung vorsaß. Da
waren die Kardinäle, der Angeklagte wurde hereingelassen und einige
wenige Privilegierte durften anwesend sein. Nur die ältesten Beiräte durften
dabei sein.
Autor: Der Abschwur von Galilei vor dem Inquisitions-Gremium war natürlich
ein Akt der Erniedrigung. Ein Kniefall, eine erzwungene Absage an das, von
dem der große Mathematiker, Astronom und Physiker überzeugt war. Aber im
Vergleich zu dem, was die katholische Kirche in dieser Zeit sonst mit
Abweichlern veranstalten konnte, war man mit Galileo noch relativ gnädig.
33 Jahre zuvor, im Jahr 1600, hatte man den ehemaligen Mönch Giordano
Bruno ein paar hundert Meter von hier auf dem Campo dei Fiori verbrannt. Er
hatte unter anderem behauptet, das Weltall sei unendlich und es gäbe eine
unendliche Anzahl von Welten. Es gab auch Fälle, wo der Abschwur vor
großem Publikum geleistet werden musste. Zum Beispiel nebenan in der Kirche
Santa Maria Sopra Minerva. Damit alle gut sehen konnten, wurden dann extra
Tribünen aufgebaut. Galilei dagegen durfte im kleinen Kreis abschwören.
Padre Ols ist noch wichtig zu betonen, dass Galileo nur für den offiziellen Akt
des Abschwörens hierher kam. Die Verhöre, die dem voran gingen, fanden im
Palast der Inquisition statt, links vom Petersplatz.
4OT4 Daniele Ols, OP (Sprecher 2): Jemand wurde mit dem Verhör beauftragt
und er durfte auch foltern. Galileo wurde in der Tat die Folter angedroht. Das
wurde dann nicht gemacht, aber immerhin... Verhört wurde im Palazzo
Sant'Uffizio, dem Sitz der Glaubenskongreation, wo auch die Zellen waren, in
denen die Leute festgesetzt wurden.
Atmo: Rund um den Petersplatz
Autor: 22 Tage wurde Galilei 1633 hier festgehalten, bevor ihm der Prozess
gemacht wurde. Ganz in der Nähe, hinter den Vatikanischen Mauern wohnt
heute Kardinal Walter Brandmüller. Der 85jährige war bis vor 5 Jahren
Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft. Als eine Art
Chefhistoriker der römischen Kurie hat er unter anderem ein Buch
geschrieben mit dem Titel „Galilei und die Kirche. Ein ‚Fall‘ und seine Lösung“:
OT5 Kardinal Walter Brandmüller: Die mit dem Fall befasste
Indexkongregation und Inquisitionsbehörde waren nicht in der Lage, sich vom
Buchstaben der Bibel zu Lösen und den eigentlichen Sinn zu erfassen. Die
Inquisition irrte in der Bibelerklärung und Galilei in der Astrophysik.
Autor: Denn Galilei hatte zwar gute Anhaltspunkte für die Theorie des
Heliozentrismus, nach der sich die Erde um die Sonne dreht. Aber er hatte
noch keine richtigen Beweise.
Und: Galilei hatte den Heliozentrismus nicht erfunden. Er baute auf die
Theorien des Nikolaus Kopernikus auf. Die so genannte Kopernikanische
Wende gilt als der entscheidende Schritt für das neue Weltbild. Sie war aber
zunächst nur ein mathematisches Modell, mit dem sich viele Phänomene
erklären ließen. Und dabei mathematisch noch recht ungenau. Erst Johannes
Kepler kam der Wirklichkeit nahe, indem er Anfang des 17. Jahrhunderts von
elliptischen Bahnen der Planeten ausging und diese Erkenntnis 1609
veröffentlichte. Aber physikalisch beweisen ließ sich das noch nicht, sagt Ugo
5Baldini, der Wissenschaftshistoriker, der in Padua gelehrt hat, dort, wo auch
Galilei einige Jahre seinen Lehrstuhl hatte.
OT6 Ugo Baldini, Wissenschaftshistoriker (Sprecher 3): Als Newton 1687 seine
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica veröffentlich hat, hat er nicht
nur bewiesen, dass Kepler Recht gehabt hatte, dass also die Zeichnung der
Umlaufbahnen von Kepler exakt war, sondern er beweist auch, dass es auf
Grundlage der Physik gar nicht anders sein kann. Dementsprechend wird die
Geozentrik physikalisch widerlegt. Mit Newton hat es also einen weiteren
Schritt gegeben.
Autor: Galilei konnte den physikalischen Beweis noch nicht führen, aber er
benutzte als einer der ersten ein Fernrohr zur Beobachtung der Sonne, der
Planeten und ihrer Monde. Er entdeckte die Sonnenflecken und Mondkrater.
Und er hatte Bewunderer und Förderer in Rom – auch in Kirchenkreisen.
Insgesamt vier mal war er vor dem Abschwur in Rom – seine Reisen waren
regelrechte Triumphzüge durch die Salons und die Hörsäle der Stadt. Seit der
Veröffentlichung seiner Schrift „Siderius Nuntius“ – „der Sternenbote“ war er
sozusagen ein Star der Wissenschaft – er wurde zum gefeierten
Hofmathematiker der Medici in Florenz berufen. Ein Jahr, später, 1611, kam er
das erste Mal nach Rom, wo er gebeten wurde, seine Entdeckungen und
Erfindungen vorzuführen.
Die Kirche war nicht etwa generell wissenschaftsfeindlich. Auch die Päpste
interessierten sich für Astronomie. Teil der heutigen Vatikanischen Museen ist
der „Turm der Winde“. Papst Gregor XIII. hatte dieses Observatorium Ende des
16. Jahrhunderts bauen lassen, unter anderen um dort Beobachtungen für
seine Kalenderreform anstellen zu lassen.
Guy Consolmagno ist Jesuitenbruder und gleichzeitig Astronom. Er betreut
und erforscht in Castelgandolfo die Meteoriten-Sammlung des Vatikans, die
eine der größten der Welt ist, und schaut am Observatorium in Tucson Arizona
in die Sterne. Auch er hat sich mit der Zeit Galileis auseinandergesetzt.
6OT7 Guy Consolmagno, SJ (Sprecher 4): Wer betrieb damals Wissenschaft?
Also das, was wir Wissenschaft nennen? Leute an den Universitäten, die
meisten von ihnen Priester. Wer waren die, die an den Ergebnissen von
Galileos Forschungen interessiert waren? Warum sollte sich die Kirche
überhaupt darum kümmern, wie sich die Planeten bewegen? Weil damals
die Art darüber, was die Welt zusammen hält, die Idee miteinschließt, dass
man in den Bewegungen der Sterne die Bewegungen der Engel wiederfindet.
Dass man in der Struktur des Universums auch eine metaphysische Struktur
wiederfinden kann.
Autor: Auch deshalb stießen die Forschungen Galileis in Rom auf großes
Interesse: Kardinal Maffeo Barbarini war sein großer Förderer am Papsthof.
1623 wurde er selbst zum Papst gewählt und nahm den Namen Urban VIII. an.
1611, bei seinem ersten Besuch in Rom, lernte Galilei auch Roberto Bellarmin
kennen, den vielleicht bedeutendsten Theologe jener Zeit. Heute ist er in der
Kirche Sant’Ignazio beigesetzt, ganz in der Nähe der Minerva. Rechts in einer
Seitenkappelle, liegt er im roten Kardinalsgewand unter dem Altar. Als Galileo
und er sich trafen, war Bellarmin schon jahrelang Kardinal. Beim Konklave
1605 wäre er selbst beinahe zum Papst gewählt worden. Auch er war der
Wissenschaft gegenüber aufgeschlossen, und: Roberto Bellarmin hatte auch
Astronomie studiert. Und so glaubte auch er in den Himmelskörpern eine
göttliche Ordnung wieder zu erkennen. So schreibt er um das Jahr 1610:
OT8 Roberto Bellarmin (Sprecher 1): Mich selbst kam einmal die Neugier an zu
erfahren, wieviel Zeit die Sonne brauche, um ins Meer unterzusinken. Beim
Beginn ihres Unterganges fing ich an den Psalm Miserere zu beten, und ich
war noch kaum zwei Mal damit fertig geworden, so war die Sonne auch
schon ganz untergegangen. Sie hatte also in der kurzen Zeit […] einen Raum
von weit mehr als siebentausend Meilen durchlaufen.
Autor: Die Probleme mit der Astronomie aber, sie begannen dort, wo die
Gefahr bestand, erklären zu müssen, dass der Wortlaut der Bibel falsch war.
7Denn Bibelwort war göttliches Wort. Hier war die Astronomie ein heikles Feld,
denn sie stellte das biblische Weltbild infrage, das, wie die Weltbilder aller
antiker Kulturen, davon ausgeht, dass die Erde eine Scheibe und der
Mittepunkt des Alls sei. Insofern war es für die Vertreter der Kirche zwar
akzeptabel, sich als Hypothese vorzustellen, dass die Erde rund sei und sich
um die Sonne dreht, man konnte sozusagen inoffiziell von so einem Modell
ausgehen, wenn es zum Beispiel Seeleuten zu Navigation nützte, aber man
durfte es nicht als absolute Wahrheit verkünden.
OT9 Hubert Wolf, Kirchenhistoriker: Wenn Du das nämlich machst, dann
widerspricht das, was Du sagst, der Kosmologie der Bibel. Denn im Buch Josua
steht: „Sonne, stehe still im Tal von Gibeon! Und die Sonne stand still.“ Also: ich
darf naturwissenschaftliche Hypothesen immer vertreten. Das zeigt die
Geschichte der Inquisition und des Index in Hinblick auf Naturwissenschaften –
ausgehend vom Fall Galileo. Ich darf sie nur nicht in einen Kontrast zur
biblischen Offenbarung und zur Glaubenswahrheit bringen.
Atmo: rund um den Petersplatz…
Autor: Hubert Wolf treffen wir am Petersplatz. Der Kirchenhistoriker und
Professor in Münster hat unter anderem als einer der ersten im römischen
Inquisitionsarchiv geforscht und über den Index, der die von der Katholischen
Kirche verbotenen Bücher auflistet. Der Index Librorum Prohibitorum wurde
1559 eingeführt. Erst nach dem 2. Vatikanischen Konzil wurde er abgeschafft.
Über das Verhältnis zwischen der Kirche und den Naturwissenschaften sagt
der Index nur wenig aus.
Für Hubert Wolf liegt das auch daran, dass die Kirche durch die Jahrhunderte
grundsätzlich aufgeschlossen war. Auch Kardinal Bellarmin bemühte sich ganz
offensichtlich um den Ausgleich zwischen den wissenschaftlichen
Erkenntnissen und der Wahrheit der Bibel. Zum Beispiel im Fall des Karmeliters
Paolo Antonio Foscarini: er hatte 1615 ein Buch veröffentlicht, in dem er zu
beweisen versuchte, dass der Heliozentrismus der Bibel nicht widersprach.
8Damit eckte er in Rom an und musste seine Thesen vor der Inquisition
verteidigen. Bellarmin schrieb ihm im April dieses Jahres einen Brief, der ihm
Mut machen sollte:
OT11 Kardinal Roberto Bellamin (Sprecher1): Ich halte dafür: wenn es
wahrhaft bewiesen würde, dass die Sonne im Mittelpunkt der Welt und die
Erde im dritten Himmel steht und dass nicht die Sonne die Erde umkreist,
sondern die Erde die Sonne, dann müsste man sich mit großem Bedacht um
die Auslegung der Schriften bemühen, die dem zu widersprechen scheinen,
und eher sagen, dass wir es nicht verstehen als zu sagen, das Bewiesene sei
falsch.
Autor: Zu spät. Das Buch Foscarinis war da schon auf dem Index gelandet, die
Inquisitionskongregation hatte ein Dekret erlassen, in dem das
Kopernikanische Weltbild ein für alle Mal für unvereinbar mit der katholischen
Lehre erklärt wurde.
Galilei wollte sich damit nicht abfinden. Eigentlich hatte er wohl gehofft, in
Foscarini einen Verbündeten zu finden. Deshalb reiste er rund um dessen
Prozess wieder nach Rom. Er dachte ganz ähnlich, wie es Bellarmin in seinem
Brief formuliert hatte. Schon 1613 hatte er seinem Freund und Schüler, dem
Benediktinermönch Benedetto Castelli geschrieben, dass man die Bibel nicht
allzu wörtlich nehmen sollte. Der Brief wurde von der Inquisition abgefangen,
abgeschrieben und nach Rom geschickt. Er war später ein wichtiges
Beweisstück im Prozess gegen Galilei:
OT12 Galileo Galilei (Sprecher1): Da es also die Schrift an vielen Stellen […]
notwendig macht, eine von der scheinbaren Bedeutung der Worte
abweichende Auslegung zu geben, halte ich dafür, dass ihr in Disputen über
die Natur der letzte Platz vorbehalten sein sollte […] Denn es ist offensichtlich,
dass die natürlichen Wirkungen, die uns durch die Erfahrung der Sinne vor
Augen geführt werden oder die wir durch zwingende Beweise erkennen,
keineswegs in Zweifel gezogen werden dürfen durch Stellen der Schrift, deren
9Worte scheinbar einen anderen Sinn haben, weil nicht jeder Ausspruch der
Schrift an so strenge Regeln gebunden ist wie eine jede Wirkung der Natur.
Autor: Galilei hatte auch seine feste Auffassung über die mangelnde
Kompetenz der Theologen, in Fragen der Wissenschaft zu entscheiden. Was er
über die Inquisition in Rom dachte wird mehr als deutlich in einem Brief, den er
1615 der Großherzogin Christine von Lothringen schrieb:
OT13 Galileo Galilei (Sprecher1): Wenn nun die Theologie, sich nur mit den
höchsten göttlichen Problemen beschäftigend, aus Würde auf ihrem
königlichen Throne verbleibt, der ihr ihrer hohen Autorität zukommt, und nicht
zu den niederen Wissenschaften herabsteigt, vielmehr dieselben, als die
Seligkeit nicht betreffend, unbeachtet lässt, so sollten auch die Professoren
der Theologie sich nicht die Autorität anmaßen, Dekrete und Verordnungen in
Fächern zu erlassen, die sie nicht betrieben und studiert haben.
Autor: Das klingt unversöhnlich. Und in der Tat war ein Problem, dass die
Kirche mit Galilei hatte, auch dessen aufbrausender, rechthaberischer
Charakter. Vermutlich überschätzte er sich in der Annahme, er könne
Einrichtungen der Kirche wie die Inquisition von seiner Wahrheit überzeugen.
Die Hüter der Glaubenslehre fürchteten den Dammbruch: dass, wenn die
Bibel in einem wichtigen Punkt wiederlegt sei, auch andere
Glaubenswahrheiten nicht mehr sicher waren. Zu sagen, wie auch Galilei
argumentiert hatte, dass die Bibel nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern den
Glauben und das Weltbild ihrer Entstehungszeit widerspiegelt, ist heute
selbstverständlich. Damals war das ein Problem:
OT15 Ugo Baldini, Wissenschaftshistoriker (Sprecher 3): Wir müssten sagen,
dass es nicht wahr ist, dass Methusalem mit 970 Jahren stirbt. Wir müssten
sagen, dass die Sintflut nicht die gesamte Menschheit auslöscht. Wir müssten
sagen, dass nicht alle Tiere in der Arche Noah sind. Und unendlich viel andere
Dinge. Kurz: Die Kirche meint, wenn das Prinzip durchgeht, dass in der Heiligen
10Schrift einige Dinge wörtlich zu nehmen sind und andere nicht, dann wird das
Heiligtum der Schrift zersetzt.
Autor: Hinzukommt, dass die Katholische Kirche in jener Zeit unter besonderem
Druck stand. Noch in der Renaissance-Zeit war der Umgang der Kirche mit der
Bibel relativ locker. Aber der neu entstehende Protestantismus aus dem
deutschsprachigen Raum hatte die die katholische Kirche in die Defensive
gebracht. Auch was einen genaueren Umgang mit der Heiligen Schrift
anging, sagt Kardinal Brandmüller.
OT16 Kardinal Walter Brandmüller: Luther insistiert auf dem Wortlaut der Schrift.
Und die Vorwürfe an die katholische Adresse, man habe die Heilige Schrift
verraten, haben auf der anderen Seite einen Abwehraffekt zur Folge gehabt,
der nun dazu führte, dass man auf katholischer Seite so
bibelbuchstabengetreu wie nur möglich zu sein sich bemühte, um diesen
Vorwürfen aus Wittenberg entgegenzutreten.
Autor: Auch wenn Martin Luther die Regel „sola scriptura“, „allein die Schrift“
zum Maß der Dinge erhoben hatte um zu unterscheiden, was wirklich
Verkündigung der Bibel war, und was nur kirchliche Auslegung, Dogma oder
Meinung des Papstes. Was die römischen Theologen mit Blick auf diese neue,
vom Humanismus geprägte Herangehensweise an die eigene Tradition
befürchteten, das drohte ihnen jetzt auch im Bereich der Naturwissenschaft.
Kardinal Bellarmin versuchte im Fall Galilei solange es ging, goldene Brücken
zu bauen und den Eklat zu verhindern. An Foscarini schrieb er:
OT17 Kardinal Roberto Bellarmin (Sprecher1): Ich bin der Meinung, dass Euer
Hochwürden und Herr Galilei klug daran täten, sich darauf zu beschränken,
von Annahmen zu sprechen, wie ich immer glaubte, dass Kopernikus so
gesprochen habe. Indem man von der Annahme spricht, dass die Erde sich
bewege und die Sonne still stehe, wird der Schein besser gewahrt, […] es ist
11bestens gesagt und entbehrt jeglicher Gefahr; und dieses genügt dem
Mathematiker.
Autor: Doch 1621 stirbt Bellarmin hochbetagt in Rom. Galilei musste sich nun
auf mehr Gegenwind einstellen. Aber 1623 keimte wieder Hoffnung auf, als
sein alter Förderer Maffeo Barberini zum Papst gewählt wurde. Ihm widmete
er die Schrift Saggiatore, in der er sich mit der Bahn von Kometen
auseinandersetzt. Urban VIII., wie Barberini sich nannte, empfing Galilei 1624
gleich mehrmals und ermunterte ihn, weiter zu publizieren.
Doch es war dessen nächstes großes Werk, das das Fass zum Überlaufen
brachte, der „Dialog über die zwei Weltsysteme“.
Atmo: Musik vom Anfang...
Autor: Darin streiten sich die zwei Hauptfiguren darüber, ob nun die Erde
unbewegt im Mittelpunkt des Universums steht oder die Sonne. Und dabei ist
ganz klar, auf welcher Seite Galilei steht. In den Augen der Inquisition verstößt
dieses Buch gegen die Auflage, über seine Theorien als Hypothesen zu
schreiben.
OT18 Hubert Wolf, Kirchenhistoriker: Denn da geht es auch wieder darum:
eigentlich werden Hypothesen ausgetauscht. In diesem Gespräch zwischen
den beiden. Wobei völlig klar ist: derjenige, der für das heliozentrische System
argumentiert, der ist brillant. Und der für das geozentrische hypothetisch
argumentiert das ist ein Dünnbrettbohrer. Es wird jedem sofort klar, wenn man
das liest, wo die Position ist. Das ist keine Hypothese, da wird eine Wahrheit
behauptet.
Autor: Das Inquisitionsverfahren, das schließlich im Abschwur mündet, versucht
Galileo Galilei so lange wie möglich zu verhindern. Aber 1632 wird er nach
Rom geladen. In Florenz wütet in diesen Jahren die Pest, Galilei verweist auf
sein Hohes Alter, er ist 68, seine schlechte Gesundheit, und er versucht es über
12seinen alten Gönner, indem er an Francesco Barberini schreibt, der als
Kardinalnepot die rechte Hand des Papstes ist. Ihn bittet er, bei den
Kardinälen der Inquisition ein gutes Wort für ihn einzulegen.
Es nützt nichts, Galilei muss abschwören. Ob er danach tatsächlich gesagt
hat „Und sie bewegt sich doch“ – daran gibt es große Zweifel. Gedacht hat
er es sicher.
Atmo: Musik vom Anfang…
Die katholische Kirche hat aus dem Fall gelernt, sagen ihre Vertreter. Aber erst
Anfang der 1990er Jahre hielt Papst Johannes Paul II. eine Ansprache, die
man als Rehabilitierung Galileis verstehen kann.
Jedoch schon in den Jahrhunderten zuvor haben Männer der Kirche die
moderne Wissenschaft vorangetrieben, unter anderem auch Astronomen, die
bis heute in der päpstlichen Sternwarte in Castelgandolfo forschen. Gregor
Mendel war Benediktinermönch, Georges Lemaître, der als Erfinder der
Urknall-Theorie gilt, war katholischer Priester.
OT21 Kardinal Walter Brandmüller: Dass man das nach wie vor verdrängt, ist
eine Folge dessen, dass im Gefolge der Aufklärung ein solcher Gegensatz
konstruiert wurde und Galilei quasi als Gallionsfigur einer von Autoritäten
unabhängigen Forschung glorifiziert wurde.
OT 22 Guy Consolmagno, SJ (Sprecher 4): Wir haben in den letzten 400 Jahren
gelernt, dass Galileos Erklärung des Universums auch unvollständig war.
Newtons Erklärung des Universums war auch unvollständig. Und vielleicht sieht
die Urknall-Theorie in 500 Jahren auch ziemlich dämlich aus. Man will doch
nichts davon nehmen, um darauf eine Religion zu begründen…
Autor: Aber das Verhältnis von Glauben und Wissenschaft ist, solchen
Beteuerungen zum Trotz, nach wie vor schwierig. Seit dem Fall Galilei ist es
vergiftet.
13OT 23 Hubert Wolf: Ich verstehe natürlich den Forscher, der irgendwann an
den Punkt kommt und sagt: ich will jetzt aber sagen, was Sache ist. Und das ist
der „Dialog der beiden Weltsysteme“. Und insofern war’s natürlich ein
Maulkorb.
OT25 Ugo Baldini, Wissenschaftshistoriker (Sprecher 3): Die Kirche hoffte, dass
die Wissenschaft Fortschritte machen könnte, ohne dabei die traditionellen
und fundamentalen Wahrheiten anzufechten. Doch einige dieser Wahrheiten
wurden angegriffen und mussten verändert werden. Dies wurde nur mit
großer Mühe verstanden, sehr langsam.
Autor: Guy Consolmagno, der Jesuit und Astronom hat das Problem
zumindest für sich gelöst:
OT26 Guy Consolmagno, SJ (Sprecher 4): Es gibt keinen Gegensatz zwischen
Glaube und Wahrheit. Die Leute glauben fälschlicherweise, dass Wissenschaft
und Religion zwei unterschiedliche Wege sind um an Fakten zu kommen. Aber
das ist nicht, was Wissenschaft ausmacht, und das ist nicht, was Religion ist.
Religion geht es nicht um die Fakten in der Bibel, Religion geht es darum, was
wir aus diesen Fakten machen. Genauso geht es Wissenschaft nicht um die
Fakten, die man in einem Buch findet. Es ist die Unterhaltung die wir führen,
um den Sinn dieser Fakten herauszufinden. Beide sprechen nicht einfach nur
von einer Reihe von Dingen, die man in ein Buch stecken kann.
Autor: Galileo Galilei musste dafür bezahlen, dass man das zu seiner Zeit ganz
anders sah.
14Sie können auch lesen