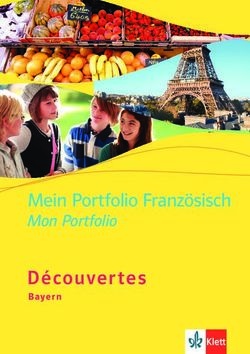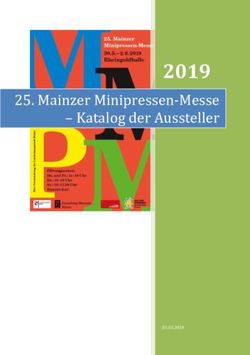"Tollwut" der Franken und wandernde Pest - Karl-Heinz Leven - Steiner eLibrary
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Medizinhistorisches Journal 53, 2018/2, 163–182
Karl-Heinz Leven
„Tollwut“ der Franken und wandernde Pest
Byzantinische Geschichtsschreiber über „wahre“ und „falsche“ Ursachen von Seuchen
Franconian “Rabies” and wandering Plague
Byzantine Historians on “true” and “false” causes of epidemics
ABSTRACT: Following the account of the Byzantine historian Agathias of Myrina, in 554 AD
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
a Franconian army was hit by a “plague” while invading Italy. Causes of the disease (which
befell the leader Leutharis in an abominable kind of „rabies“) were numerous: wrong diatet-
ics, air-pollution etc. But, Agathias emphasized, the barbarian insults should be regarded as the
“real” cause. The historian mixed up different causes, a method which has to be regarded in its
context. The deployment of medical and theological concepts was related to the literary genre,
and imitation of classical literature (“mimesis”) played here a crucial role.
Plague was explained in two ways: on the one hand as being carried by the wandering armies
(Agathias’ view). On the other hand, plague itself could be regarded as moving: like a diligent
tax collector, plague seemed to move through imperial mainland and islands, taking its toll of
death. Whereas epidemics of barbarian troops could be explained conventionally by medical
and theological concepts, the great “Justinianic” plague could only be comprehended from un-
conventional points of view. Description took the place of explanation.
Keywords: Justinianic Plague – Byzantine historians – Agathias – Procopius
Zusammenfassung: Im Jahr 554 wurde nach dem Bericht des byzantinischen Geschichts-
schreibers Agathias von Myrina ein fränkischer Heerhaufen in Italien von einer „Pest“ (νόσος
τις λοιμώδης) heimgesucht. Die Ursachen dieser Krankheit, die bei dem Anführer Leutharis
selbst eine besonders abscheuliche, an „Tollwut“ erinnernde Form annahm, waren vielgestaltig:
Diätfehler und Verunreinigung der atmosphärischen Luft, d. h. der zeitgenössischen Medizin
entlehnte Gründe wurden genannt. Hinzu kam als „wahrer“ (ὡς ἀληθῶς) Grund das frevelhafte
Treiben der Barbaren. Die charakteristische Vermischung von Krankheitsursachen, wie sie in
dieser Episode aufscheint, ist im weiteren Kontext byzantinischer Seuchenschilderungen zu
sehen. Es zeigt sich, dass medizinische Konzepte und theologische Erklärungsmuster abhängig
von der jeweiligen literarischen Gattung adaptiert wurden. Hierbei spielte die „Nachahmung“
(μίμησις) als klassisch verstandener literarischer Vorbilder mit ihrer je eigenen Tradition von
Seuchenschilderungen eine entscheidende Rolle.
Die „Pest“ erscheint in der byzantinischen Literatur in zwei Formen, zum einen, wie in dem
Beispiel des Agathias, als Seuche kriegführender Heerhaufen, insbesondere von Barbaren –
hier wanderten demgemäß die Träger der Krankheit. Zum anderen bewegte sich die Krankheit
selbst: wie ein gewissenhafter Steuereintreiber, so schien es den Zeitgenossen, durchwanderte
die Seuche Festland und Inseln des Reiches und erhob ihren Tribut des Todes.
War das Seuchengeschehen bei den in das Reich einfallenden Barbaren mit medizinisch-natur-
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart164 karl-heinz leven
kundlichen oder religiösen Konzepten ursächlich zu fassen, so versagten diese „konventionel-
len“ Erklärungsversuche bezüglich der das gesamte Reich durchwandernden großen Pest. Hier
ergaben sich „unkonventionelle“ Sichtweisen, die das Ungeheure des Geschehens zwar noch
beschreibbar, aber kaum mehr erklärbar machten.
Schlagworte: Justinianische Pest – byzantinische Geschichtsschreiber – Agathias – Prokop
Dimensionen der „Justinianischen“ Pest
Der plötzliche Seuchentod, das massenhafte Sterben innerhalb kurzer Zeit, gehören zu
den Phänomenen, die in verschiedenen Kulturen und Epochen zeitgenössische Beob-
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
achter herausgefordert haben. Die abendländischen Seuchenkonzepte waren fest etab-
liert, als im 6. Jahrhundert n. Chr. die „Justinianische“ Pest eine Katastrophe verursachte,
die der Mittelmeerraum in diesem Ausmaß niemals zuvor gesehen hatte. Die vorliegen-
de Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie Seuchen bei barbarischen Völkern, die in
das Reich einbrachen, in byzantinischen Quellen geschildert werden. Aus dieser Fall-
studie ergeben sich Rückschlüsse auf die Reichweite von Seuchenkonzepten, die by-
zantinische Geschichtsschreiber kreativ verwendeten. Im Weiteren wird das Wandern
der Pest selbst mit den zeitgenössischen Erklärungsweisen in Beziehung gesetzt; hierbei
ergeben sich Aufschlüsse über das Weltbild der spätantiken Historiographie.
„Damals brach eine Seuche aus, die fast die gesamte Menschheit dahingerafft hätte
(ἐξ οὗ ἅπαντα ὀλίγου ἐδέησε τὰ ἀνθρώπεια ἐξίτηλα εἶναι).“*1 – mit diesen Worten leitete
der Geschichtsschreiber Prokop von Kaisareia (um 500 – um 560) in seinen „Perser-
kriegen“ die Schilderung der „Justinianischen“ Pest ein, die das byzantinische Reich seit
541/42 heimsuchte. In einer Aufzählung von Katastrophen umschrieb er in seiner „Ge-
heimgeschichte“ (Anekdota) die unglaubliche Vernichtungskraft der Seuche lapidar:
„Hinzu kam … die Pest (ὁ λοιμός); sie raffte etwa die Hälfte der restlichen Mensch-
heit hinweg (τὴν ἡμίσειαν μάλιστα τῶν περιγινομένων ἀνθρώπων ἀπήνεγκε μοῖραν).“2
Die „Justinianische“ Pest ist in den letzten Jahrzehnten intensiv erforscht worden;3 ver-
gleichbar dem „Schwarzen Tod“ des 14. Jahrhunderts war die „Justinianische“ Pest ein
„Hammerschlag“, eine der verheerendsten Katastrophen, die den Mittelmeerraum je-
mals betraf.4 Die unmittelbaren Auswirkungen auf Bevölkerungszahl, Religion, Politik,
Wirtschaft, Geistesleben sind in zeitgenössischen Quellen fassbar. Indem die Pest bis in
die Mitte des 8. Jahrhunderts periodisch wiederkehrte, ergaben sich langfristige Folgen,
insbesondere für das Byzantinische Reich; das von Prokop entworfene „Rundgemälde
* Hans-Ulrich Wiemer (Erlangen) verdanke ich wertvolle Anregungen und Hinweise.
1 Prokop, Perserkriege 2, 22, 1 (Ed./Übers. Veh, Bd. 3, 355).
2 Prokop, Anekdota 18, 44 (Ed./Übers. Veh, Bd. 1, 162 f.); vgl. die neue Ausgabe der Anekdota, in der die
Übersetzung von Veh mit einem neuen Kommentar von Meier und Leppin versehen ist, hier S. 316 f. zur
Stelle.
3 Little (Hg.), Plague and the End of Antiquity; Meier (Hg.), Pest; Meier, Das andere Zeitalter Justinians;
Stathakopoulos, Famine and Pestilence; Leven, „Die ‚Justinianische‘ Pest“.
4 Horden, „Mediterranean Plague“, 155.
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart„Tollwut“ der Franken und wandernde Pest 165
der verwüsteten Oikumene“5 ist keine bloße Übertreibung, die der Geschichtsschrei-
ber aus weiter unten darzustellenden Motiven, so seinem Hass auf Kaiser Justinian, in
die literarische Welt setzte, sondern dürfte der Realität nahekommen.6 Die interessante
Frage, inwieweit der „Untergang Roms“ bzw. das Ende der Antike und der Aufstieg des
Islams auch den Folgen der Pest zuzurechnen sind, wird intensiv diskutiert, ist jedoch in
dieser Monokausalität nicht zu beantworten.7
Um welche Krankheit es sich bei der „Justinianischen“ Pest im Sinne einer retros-
pektiven Diagnose nach modernen Kriterien handelte, ist in den letzten Jahren im Licht
molekulargenetischer Untersuchungen erörtert worden.8 Festzuhalten ist hier, dass die
(spät-)antike Seuchenlehre mit der mikrobiologischen der Moderne wenig gemeinsam
hat. Die Vorstellung, dass ein mikrobieller Erreger eine bestimmte ansteckende Krank-
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
heit hervorruft, eine Krankheit, die durch diesen Erreger geradezu charakterisiert ist,
hat vor dem späten 19. Jahrhundert keinen Platz. Seit der griechischen Antike gab es
verschiedene Modelle, um Seuchen zu erklären.9 Die naturkundliche Sichtweise favo-
risierte die Miasma-Lehre, wonach schädliche „Verunreinigungen“ in der Atmosphäre
die Atemluft vergifteten und im Körper „Fäulnis“ auslösten. Empirisch bekannt war die
Gefahr der Ansteckung; hiermit verband sich die Angst vor Einschleppung von Seu-
chen durch Fremde bzw. von Außerhalb. Schließlich gab es, erstmals nachweisbar in der
Homerischen Ilias, die religiöse Deutung, wonach Seuchen als Strafe für Frevel oder
auch als Prüfung durch himmlische Mächte verhängt würden.10
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine bestimmte Episode des frühmittelalter-
lichen Seuchengeschehens, in der sich Pest und wandernde Barbarenhaufen verbinden.
An diesem Beispiel lassen sich die Seuchenkonzepte der byzantinischen Geschichts-
schreibung differenzieren. Allgemein standen die byzantinischen Autoren dieses Gen-
res im Bann der „Nachahmung“ (griech. μίμησις) klassischer Autoren, denen sie stilis-
tisch und inhaltlich nacheiferten. An erster Stelle rangierten Herodot und Thukydides,
gefolgt von anderen Autoren wie Xenophon, aber auch späteren wie Flavius Josephus
und Arrian.11 Zu betonen ist, dass die (früh-)byzantinischen Autoren, ungeachtet der
Mimesis paganer Vorbilder, in überwiegender Zahl Christen waren und dies bei allem
Klassizismus auch erkennen ließen.12 Es bedarf keiner besonderen Erläuterung, dass
5 Rubin, Prokopios, 275.
6 Stathakopoulos, Seuchen 1041; vgl. die überzeugende Bilanz der Forschung bei Meier, „‚Justinianic
Plague‘“.
7 Little (Hg.), Plague and the End of Antiquity; Leven, „Kaiser, Komet und Katastrophe“.
8 Leven, „‚At times these ancient facts seem to lie before me like a patient on a hospital bed‘“; Leven, „Von
Ratten und Menschen“; Leven, „‚Vandalisches Minimum‘“
9 Leven, Geschichte der Infektionskrankheiten, 20–31; Meier (Hg.), Pest.
10 Laser, Medizin und Körperpflege, 62 f., 68 f.; Latacz (Hg.), Homers Ilias. Gesamtkommentar Bd. I Faszikel 2,
24 f.; 45 f.
11 Hunger, „Thukydides bei Johannes Kantakuzenos“.
12 Ob der Klassizismus eine Art religiöser Toleranz oder verstecktes Heidentum bzw. eine neuplatonische
Gesinnung andeuten sollte, mag hier offen bleiben; Zosimos war unzweifelhaft Heide, vgl. Hunger, Hoch
sprachliche Literatur, 288; Leven, „Zosimos“. Zu den anderen frühbyzantinische Autoren vgl. Cameron,
Procopius, 113–133; Cameron, Agathias, 89–111; Kaldellis, „Historical and Religious Views of Agathias“; all-
gemein Cupane, „Literatur“, 932 f.
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart166 karl-heinz leven
sich die klassizistischen byzantinischen Autoren auch auf das Alte Testament (in der
Version der Septuaginta) und das Neue Testament bezogen; gerade im Hinblick auf das
Seuchenmotiv boten biblische Schriften eine Fülle von Anknüpfungspunkten.13
Quellenspektrum
Byzantinische Autoren führten Seuchen in letzter Hinsicht häufig auf göttlichen Willen
zurück14; hier bestand weitgehend Einigkeit, wie einige Beispiele zeigen mögen. Prokop
schrieb bezüglich der Pest von 542 in Konstantinopel: „Für dieses Unglück (κακόν) je-
doch kann man einen Grund (πρόφασις) weder nennen noch ausdenken, außer man
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
sucht ihn bei Gott“ (εἰς τὸν θεὸν ἀναφέρεσθαι).“15 Der aus dem syrischen Epiphania am
Orontes stammende Kirchengeschichtsschreiber Evagrios Scholastikos (536 – ca. 594),
stellte zum Jahr 592 fest: „Diese Seuche hat bis jetzt … 52 Jahre gewütet und alles Frühe-
re in den Schatten gestellt. … Was noch kommen wird, ist ungewiß (τὰ ἑξῆς δὲ ἄδηλα),
es wird so weitergehen, wie es Gott gefällt (οὗ ὁ θεὸς εὐδοκήσει), der die Ursachen kennt
und das Ziel (τὰς αἰτίας ἐξεπιστάμενος καὶ ποῖ φέρονται).“16
Eine nahezu lückenlose Reihe von Historikern, vom 6. bis zum 15. Jahrhundert,
folgte dieser Linie; Johannes Kantakuzenos (ca. 1295–1383), der als Johannes VI. (1347–
1354) regierte und zugleich als Geschichtsschreiber tätig wurde, war Augenzeuge der
Pest von 1347 in Konstantinopel; bei ihm wird deutlich, wie die Mimesis des klassischen
Vorbilds Thukydides sich bruchlos in einen neuen Sinnzusammenhang fügte; Kantaku-
zenos schrieb über die Seuche:
„Die Art der Krankheit war unfaßbar für den Verstand (κρεῖσσον λόγου ἦν [Zitat aus Thukydi-
des 2, 50, 1]). Daraus wurde ersichtlich, dass sie nicht zu den üblichen und der menschlichen
Natur angemessenen Dingen gehörte, sondern etwas anderes war, von Gott über die Menschen
zur Züchtigung (πρὸς σωφρονισμόν) verhängt.“17
Die Passage „unfassbar für den Verstand“ ist ein wörtliches Zitat aus der Pestschilderung
des Thukydides, der es seinerseits vermieden hatte, die attische Seuche von 430 v. Chr.
als göttliche Strafe zu bezeichnen.18 Ohne den Wortlaut zu verändern, fügte der Byzanti-
13 Einschlägige Stellen in der Septuaginta: 1 Samuel 5, 6 („Pest“ der Philister), Numeri 25, 9 („Pest“ als Strafe
für Davids Frevel); Neues Testament: „synoptische Apokalypse“ (Mt 24, 7; Mk 13, 8; Lk 21, 11), vgl. Leven,
„‚Unfassbar für den Verstand‘“, S. 119 f.
14 Leven, „‚Unfaßbar für den Verstand‘“.
15 Prokop, Perserkriege 2, 22, 2 (Ed./Übers. Veh, Bd. 3, 355).
16 Evagrius, Kirchengeschichte 4, 29 (Hübner, 512 f.).
17 Johannes Kantakuzenos, Geschichte 4, 8 (Schopen, Bd. 3, 52).
18 Allerdings berichtete Thukydides an mehreren Stellen über den in der Stadt umlaufenden Glauben be-
treffend den Zusammenhang von Pest und Frevel gegen die Gottheit, so Thuc. 2, 54, 4: das delphische
Orakel hatte den Spartanern geraten, den Krieg gegen Athen energisch zu führen. Apoll selbst würde ih-
nen helfen, was eine deutliche Anspielung auf die homerische Ilias (1, 46–51) enthält: hier sandte Apoll
die Pfeile der Pest auf die Achaier, die seinen Priester beleidigt hatten. Die Vorstellung, dass der Gott aus
Delphi den Spartanern mit der Seuche zur Hilfe käme, mochte Thukydides selbst fremd gewesen sein,
aber für die Athener klang dies recht überzeugend, wie man der Schilderung des Thukydides entnehmen
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart„Tollwut“ der Franken und wandernde Pest 167
ner fast zwei Jahrtausende später diesen Halbsatz in seine Schilderung ein und ergänzte
ihn entscheidend, indem er Gott als die eigentliche Quelle des Verhängnisses benannte.
An diesem Beispiel zeigt sich, dass bei aller „Nachahmung“ klassischer Vorbilder byzan-
tinische Autoren eigene Intentionen auszudrücken vermochten.
In einer älteren Sichtweise wurde die byzantinische Geschichtsschreibung (von
Prokop bis Kantakuzenos und einigen Autoren des 15. Jahrhunderts) von der Kirchen-
geschichte und der heilsgeschichtlich orientierten Chronistik streng geschieden, da die
verschiedenen Textgattungen vermeintlich eine grundsätzlich andere Perspektive ein-
nähmen. Ein Beispiel aus der byzantinischen Chronistik mag hier genügen, um etwas
zu verdeutlichen, was man in der älteren Forschung gemeinhin als „Niveauunterschied“
empfand. Der Syrer Johannes Malalas (nach 490 – nach 574) aus Antiocheia am Oron-
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
tes, Augenzeuge der „Justinianischen“ Pest, schrieb in seiner „Weltchronik“ (Chronogra
phia) über die Seuche:
„Da der Herrgott sehen mußte, daß sich die Verbrechen (ἀνονμίαι) der Menschheit vervielfacht
hatten, schickte er eine Pest (πτῶσις) über die Erde, welche die Einwohner in sämtlichen Städ-
ten und Ländern austilgen (ἐξάλειψις) sollte. … So suchte der Zorn Gottes [wörtlich: Barmher-
zigkeit] (εὐσπλαγχνία) zwei Monate lang die Stadt heim.“19
In ihrer Ausführlichkeit und Genauigkeit ist Malalas’ Schilderung denjenigen byzanti-
nischer Geschichtsschreiber zweifellos unterlegen, seine Erklärungsweise ist schlicht,
gleichwohl stimmig.20 In der langen Seuchenschilderung des Johannes von Ephesos
(ca. 507–586/88), enthalten in seiner syrisch verfassten „Kirchengeschichte“, wurde die
auch bei Malalas enthaltene Vorstellung, die Pest sei von Gott zur Züchtigung geschickt,
geradezu zum „Leitgedanken seiner Darstellung“.21
Das Spektrum der Quellengattungen, die über das spätantike Seuchengeschehen
Auskunft geben, ist weit gespannt22; in Darstellung und Verständnis einer Pest lassen
sich Eigenheiten in den jeweiligen Genera ausmachen. So wird man in der heilgeschicht-
lich ausgerichteten Chronistik erwarten, dass dort die religiöse Deutung der Pest über-
wiegt; dies ist auch der Fall. Gleichwohl lassen sich die Quellen nicht schubladenartig
einteilen. Es gibt Gemeinsamkeiten, die bei allen Autoren aufgrund ihrer „Allgemein-
bildung“ (ἐγκύκλιος παιδεία) aufscheinen. Daher ist die erwähnte strenge Scheidung
von Geschichtsschreibung, Chronistik und Kirchengeschichtsschreibung weniger in-
kann. Perikles, der Protagonist im Drama Athens, wie Thukydides ihn darstellte (Thuc. 2, 64, 2), nannte in
einer öffentlichen Rede die Pest eine „Götterfügung“ (τά τε δαιμόνια), die es „notgedrungen“ (ἀναγκαίως)
zu tragen gelte; vgl. Leven, „Thukydides und die ‚Pest‘ in Athen“, 148–151; Horstmanshoff, „Epidemie und
Anomie.“
19 Joannis Malalae Chronographia 18, 92 (Ed. Thurn, S. 407; übers. Veh, Prokop, Bd. 3, 555).
20 Hunger, Hochsprachliche Literatur, 319–325; vgl. den Kommentar von Veh (Prokop, Gotenkriege, Bd. 3, 566)
zur Pestschilderung: diese „… zeigt uns … den Unterschied zwischen dem bescheidenen Chronisten und
Prokops … Beobachtungsgabe und Darstellungskraft. Malalas sieht … nicht weiter als der Mann aus dem
Volke.“
21 Meier, „‚Hinzu kam auch noch die Pest‘“, 97.
22 Kaldellis, „The Literature of Plague“.
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart168 karl-heinz leven
haltlich und stilistisch bedingt als durch neuzeitliche Konzepte begründet.23 Innerhalb
der byzantinischen Literatur, die insgesamt als epigonal und klassizistisch galt, wurde
der profanen Geschichtsschreibung lange Zeit ein höherer Rang eingeräumt als heils-
geschichtlicher Chronistik oder Kirchengeschichtsschreibung.24 Dies hatte auch dazu
geführt, dass man den Quellenwert der „Kirchengeschichte“ des Johannes von Ephesos
für die Geschichte der „Justinianischen“ Pest bis vor wenigen Jahrzehnten übersah, da
mit Prokop bereits alles gesagt schien.25
Leutharis und Butilin: Ein fränkisch-alemannischer Heerzug nach Italien
im Jahre 553
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
Einzige Quelle für die Seuche, von der ein wandernder Heerhaufen von Alamannen
und Franken in Italien betroffen war, ist das Geschichtswerk des Agathias Scholastikos
(ca. 531 – vor 582) aus Myrina in Westkleinasien.26 Wie sein Beiname ausdrückt, war
er (in Konstantinopel) als Anwalt tätig; sein Werk „Geschichten“ (Ἱστορίαι) schloss
zeitlich an die „Kriege“ des Prokop an und behandelte die Zeit von 552–559 n. Chr.;
Agathias, der auch als Verfasser von Epigrammen erotischen Inhalts in der Anthologia
Graeca fassbar ist, gilt, im Gegensatz zu Prokop, als „Schreibtischhistoriker“. Fern vom
Geschehen, von dem sein Werk handelt, schrieb er in Konstantinopel; dort erlebte er
als Augenzeuge 558 die zweite Pestwelle, die er in seinem Werk recht kurz, aber plastisch
schilderte. Die übrigen Schauplätze seiner historischen Darstellung, so Italien und die
dort aufscheinenden Völker hat er nie selbst gesehen. Agathias stützte sich auf (nicht
überlieferte) zeitgenössische Quellen und mündliche Berichte. Allerdings kommt sei-
nem Werk, auch in Ermangelung anderer Quellen, hoher Wert für die 550er Jahre zu.
Die Alamannen, so Agathias, seien früher den Goten, nunmehr, d. h. in seiner ei-
genen Zeit hingegen den Franken untertänig. Die Alamannen „leben wie die Franken“
(τῇ Φραγγικῇ ἕπονται πολιτείᾳ); sie seien jedoch Animisten und verrichteten blutige
Tieropfer. Allerdings sei mit der Zeit ein mäßigender Einfluss der Franken zu erwarten.27
Die Franken wiederum, so Agathias, seien „keine Nomaden“ (οὐ νομάδες) wie manche
anderen Barbaren; sie lebten in einer „Art von römischem Staatswesen“ (πολιτείᾳ ὡς
τὰ πολλὰ χρῶνται Ῥωμαϊκῇ), das durch Gesetze geregelt sei. Zudem folgten sie der or-
thodoxen Religion, was in dieser Zeit bedeutete, dass sie, anders als die Goten und die
bereits 533 von Belisar in Nordafrika ausgeschalteten Vandalen, keine Homöer („Aria-
ner“) waren. Einen Unterschied zu den Römern seiner eigenen Zeit sah Agathias darin,
dass die Franken barbarische Kleidung trügen und eine eigene Sprache hätten. Das Ge-
samtbild der Franken bei Agathias war ausgesprochen positiv: der Autor bewunderte
23 Hunger, Hochsprachliche Literatur, 252; vgl. aber die neuere Sicht bei Cupane, „Literatur“, 931 f.
24 Cameron, Procopius, 19–32.
25 Meier, „Hinzu kam auch noch die Pest“, 91.
26 Cameron, Agathias; Hunger, Hochsprachliche Literatur, Bd. 1, 303–309; Karayannopulos/Weiss Quellenkun
de, Bd. 2, S. 281 (Nr. 86).
27 Agathias, Historiae 1, 7; 2, 3 f. (Ed. Keydell, 18; 43–44; Ed./Übers. Veh, Prokop. Bd. 2. Gotenkriege, 1171, 1177).
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart„Tollwut“ der Franken und wandernde Pest 169
sie (ἄγαμαι γὰρ αὐτούς), sie folgten der „besten Lebensweise“ (ἄριστα βιοῦντες), beflei-
ßigten sich der „Gerechtigkeit“ (δικαιοσύνη) und „Eintracht“ (ὁμόνοια) untereinander.28
Diese idealisierende Bild beruhte zweifellos nicht auf Autopsie, sondern entsprach ei-
nem literarischen Topos bezüglich fernab der römischen Zivilisation, vermeintlich har-
monisch lebender (Barbaren-)Völker; die beschönigende Sichtweise des Agathias wi-
dersprach der etwa 20 Jahre früheren Schilderung Prokops diametral.29 Agathias nutzte
seine Darstellung zum einen als Folie für die als problematisch empfundenen Zustände
in Byzanz selbst und erzähltechnisch im Rahmen seines Geschichtswerkes, die dann
folgende Katastrophe der Barbaren umso drastischer herauszustellen. Außerdem ist
in Rechnung zu stellen, dass die Franken zu der Zeit, als Agathias sein Werk verfasste
(570er Jahre), als potentielle Bündnispartner der Byzantiner gegen die Langobarden in
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
Italien gesehen werden konnten.30 Dies war Ende der 530er Jahre, während der von Pro-
kop geschilderten Gotenkriege noch ganz anders gewesen31: Der Frankenkönig Theud-
obert (533–547) hatte 539, entgegen früherer Bündnisabsprachen, einen Kriegszug nach
Norditalien unternommen, indem er Goten und Römer gleichermaßen überrollte; bei
ihrem Vormarsch töteten die Franken auch Frauen und Kinder der Goten, um sie als
Menschenopfer in den Fluss zu werfen. Prokop konstatierte, die Franken, obwohl äu-
ßerlich christianisiert, hätten ihr altes Heidentum bewahrt, mitsamt den abscheulichen
Opfern. Der Kontrast zu der einige Jahrzehnte später verfassten idealisierenden Schil-
derung des Agathias könnte kaum größer sein.
Im Jahr 554, so wiederum Agathias, sammelten die alamannischen „Herzöge“
Leutharis und Butilin einen aus Alamannen und Franken gemischten Heerhaufen,
um in Italien einzufallen und Beute zu machen.32 Ihr Gegner war Narses, den sie ab-
schätzig ein „Männlein“ (ἀνδράριον) nannten, womit sie darauf anspielten, dass er
Eunuch war. Narses hatte 552 innerhalb von drei Monaten die letzten Könige der
Goten, Totila und Teja besiegt und das gotische Königreich in Italien liquidiert.33
Der „alamannische Haufen“ (τὸ δὲ Ἀλαμανικὸν ἅπαν), der aus Alamannen und Fran-
ken bestand, umfasste, so Agathias, 75.000 Mann; diese Zahlenangabe ist phantastisch
übertrieben und nicht wörtlich zu nehmen. Zahlenangaben dienten in derartigen Schil-
derungen nahezu durchgehend als Mittel rhetorischer Übertreibung und nicht als kon-
krete Maßzahlen.34 Der Heerhaufen habe nun in Italien rücksichtslos Kirchen geplün-
dert; allerdings hätten „echte Franken“ (Φράγγοι ἰθαγενεῖς) die Heiligtümer geschont.
Der Versuch des Agathias, die „echten Franken“ vom dem barbarischen Haufen der tief
unter ihnen stehenden Alamannen zu unterscheiden, wirkt gezwungen und unlogisch,
28 Agathias, Historiae 1, 2 (Ed. Keydell, 11; Übers. Prokop. Gotenkriege, 1115); vgl. Cameron, Agathias, 54 f.;
Kaldellis, Hellenism in Byzantium, 107.
29 Prokop, Gotenkriege 6, 25, 2 (Veh, Bd. 2, S. 391) nannte die Franken als Volk „das unzuverlässigste in der
ganzen Welt.“
30 Hunger, Hochsprachliche Literatur, Bd. 1, 306.
31 Prokop, Gotenkriege 6, 25, 9 f. (Veh, Bd. 2, 392 f.); Rubin, Zeitalter Iustinians, 129 f.
32 Agathias, Historiae 2, 3 f. (Ed. Keydell, 43–44; Ed./Übers. Prokop. Gotenkriege, 1171; 1177); vgl. Rubin, Zeit
alter Iustinians, 196–199.
33 Wolfram, Die Goten, 358–360, Wiemer, Theoderich, 606–617.
34 Leven, „Die ‚Justinianische‘ Pest“, 228 f.
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart170 karl-heinz leven
geradezu grotesk.35 Prokop, dessen Werk Agathias ausdrücklich zugrunde legte, hatte
den Franken, wie erwähnt, glaubhaft Menschenopfer zugeschrieben. Die Inkonsistenz
der Schilderung des Agathias erweist sich im Fortgang des Geschehens. Eine „herein-
brechende pestilenzialische Krankheit“ (νόσος τις λοιμώδης … ἐπεισπεσοῦσα) habe Ala-
mannen und Franken unterschiedslos überfallen.36 Die Krankheit wurde von Agathias
in ihrer Symptomatik und ihren angenommenen Ursachen ausführlich geschildert. Es
habe sich um „vielgestaltige Leiden“ (ποικίλα πάθη) gehandelt; der Versuch, sie mit
einer modernen Krankheitseinheit zu identifizieren, ist, dies sei hier nur angedeutet,
wenig sinnvoll.37 Die Folgen, so Agathias, waren jedenfalls verheerend. Die Krieger
„starben haufenweise“ (ἔθνησκον χύδην). Fieber habe sie bei klarem Verstand ergriffen,
einige seien in Ohnmacht (ἀποπληξία) gefallen, andere von Kopfschmerzen und Rase-
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
rei (παραφροσύνη) gepeinigt worden.
Die naheliegende Frage nach der Ursache dieser Pest beantwortete der Geschichts-
schreiber auf zweifache Weise; eine naturkundliche Erklärung im Horizont der zeitge-
nössischen Medizin schrieb er bezeichnenderweise den Barbaren selbst zu: sie glaubten,
„schlechte Luft“ (μοχθηρὸς ἀήρ) und eine „(fehlerhafte) Veränderung der Lebensweise“
(τῆς διαίτης παραλλαγή) zur „Ausschweifung“ (τὸ ἁβροδίαιτον) während des Beutezugs
sei ursächlich gewesen. Dass Agathias diese medizinische Sichtweise den Barbaren in
den Mund bzw. Sinn legte, zeigt einmal mehr, dass er die Franken bzw. Alamannen der
spätantiken Bildung für teilhaftig hielt. Zugleich liegt auf der Hand, dass er die medizini-
sche Erklärung abwertete, indem er sie den plündernden Barbaren zuschrieb. Diese Er-
klärung, so die naheliegende Lesart für zeitgenössische Leser, musste „falsch“ sein. Aga-
thias zögerte nicht, die „richtige“ Ursache zu benennen; er konstatierte nüchtern: „Den
wahren Grund und Anlass ihres Unglücks bedachten sie überhaupt nicht“ (τὴν δέ γε ὡς
ἀληθῶς ἀρχήν τε καὶ ἀνάγκην τῆς ξυμφορᾶς οὐ μάλα διενοοῦντο). In dieser Formulierung
wird erkennbar, dass die Barbaren zu dieser Erklärung nicht vorstoßen wollten oder
konnten, war doch ihr Unglück durch ihre eigenen Fehler bzw. Verbrechen bedingt. Ihr
„Unrecht“ (ἀδικία) und die Missachtung göttlicher und menschlicher Satzungen hatten
göttlichen Zorn (μηνίματα) als Strafe für „Unrecht“ (ἀδικία), Habgier und die „Vernach-
lässigung Gottes“ (θεοῦ ἀθεραπευσία) nach sich gezogen. Diese religiöse Deutung war
für Agathias die einzig richtige; zur Verdeutlichung exemplifizierte er sie am Beispiel
des „Anführers“ (στρατηγός) Leutharis, der an seinem Körper eine ganze Serie „gottge-
sandter Strafen“ (θεήλατοι ποιναί) erlitten habe. Die nun folgende Schilderung wird in
der modernen Literatur gelegentlich als ein Fall von „Tollwut“ bezeichnet.38 Zunächst
35 Über die Quellen des Agathias kann man nur spekulieren; Kaldellis, „Agathias on the Early Merovingians“,
133 f., vermutet mündliche Berichte von fränkischen Gesandten in Konstantinopel.
36 Agathias, Historiae 2, 3, 4 f. (Ed. Keydell, 43).
37 Zur Problematik der retrospektiven Diagnose, Leven, „Von Ratten und Menschen“.
38 Théodorides, „Rabies in Byzantine Medicine“, 156, spekuliert über die Symptomatik dieser „Tollwut“, die
mit derjenigen der gegenwärtigen Krankheit Tollwut nicht recht übereinstimmt; ersatzweise bringt er die
1902 erstmals beschriebene „Aujeszky-Krankheit“ (Pseudorabies), eine viral bedingte infektiöse Bulbär-
paralyse, ins Spiel; zur Problematik derartiger retrospektiver Diagnosen vgl. die Literatur in Anm. 8; zu
den Versuchen, eine Geschichte der Rabies bis in die Vormoderne zurück zu verfolgen vgl. den Literatur
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart„Tollwut“ der Franken und wandernde Pest 171
habe Leutharis den Verstand verloren (παραπλήξ), und er „tobte“ (ἐλύττα, μανία).39
Weiterhin befielen ihn „Krämpfe“ (κλόνος), und er „stürzte“ (κατέπιπτεν); Leutharis
hatte „Schaum vor dem Mund“ (ἀφρῷ τε πολλῷ τὸ στόμα περιερρεῖτο), seine „furchtba-
ren Augen waren verdreht“ (τὼ ὀφθαλμὼ βλοσυρώ … παρατετραμμέννω). Schließlich
steigerte sich, kurz vor seinem Tod, das Grauen – es kam zur Selbstverstümmelung,
indem er „sein eigenes Fleisch verschlang“ (τῶν οἰκείων μελῶν ἀπογεύσασθαι).40 Ob die-
ser grauenhaften Szene ein dem Agathias mündlich überliefertes Geschehen zugrunde
lag oder nicht, ist weder zu behaupten noch auszuschließen. Zweifellos ging es Agathias
nicht um eine möglichst realistische Darstellung medizinischer Details, sondern darum,
das unvermeidliche und schreckenerregende göttliche Strafgericht an dem frevelhaften
Heerführer zu zeigen. Derartige „Strafwunder“ im Sinne eines elenden Todes betrafen
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
in der Antike, insbesondere im jüdisch-christlichen Kontext des Alten und Neuen Tes-
taments, diejenigen Machthaber, die gegen göttliche Satzung verstoßen hatten.41
Über Butilin, den zweiten barbarischen Heerführer, der sich von Leutharis zuvor
mit einem eigenen Haufen getrennt hatte, berichtete Gregor von Tours (538–594),
dieser bei ihm Buccelenus genannte Krieger habe in Italien zunächst große Siege gegen
Belisar und Narses erkämpft42; später sei er von Narses getötet worden43. Bei Agathias
wird Butulins Untergang dagegen anders dargestellt: Eine „Krankheit“ (νόσος) dezi-
mierte sein Heer; die Krankheit brach im Spätsommer aus, als Trauben den Barbaren
als einzige Speise dienten. Hieraus entstand „Diarrhoe“ (ἡ γαστὴρ διέρρει), die häufig
tödlich endete.44 Die Seuche wurde demnach, im Sinne der antiken medizinischen The-
orien, offensichtlich durch Diätfehler ausgelöst, gleichwohl stand auch hier eine religi-
öse Deutung dahinter, zumindest für Agathias; denn es sei offensichtlich gewesen, „daß
die Feinde für ihre Untaten büßen mußten“ (ποινὰς ὑπέσχον τῶν ἀδικημάτων) und eine
himmlische Macht (ὑπερτέρα τις ἀνάγκη) über sie kam.“45
Der Zug von Leutharis und Butulin hatte, wie erwähnt, eine Art Vorläufer gehabt in
einem Heerzug des Merowingerkönigs Theudebert I., der 539 in Italien eingefallen war.
Nach der parallelen Darstellung des Gregor von Tours waren die Franken seinerzeit in
„ungesunde“ Gegenden (loca morbida) geraten, weshalb ihr Heer von „Fiebern“ (febres)
befallen worden sei; viele seien gestorben und das Heer daraufhin umgekehrt.46 Über
überblick bei Teigen, „The Global History of Rabies and the Historian’s Gaze“; eine moderne medizinische
Deutung des von Agathias geschilderten Falls findet sich auch bei Gusso, „Il morbo cenedese“.
39 Das Wort λυττάω hatte in der antiken Literatur einen medizinischen Beiklang und bezeichnete die „Toll-
wut“ von Tieren (Aristophanes, Lysistrata 298; Aristoteles, Historia animalium, 604 a 6).
40 Agathias, Historiae 2, 3, 4 f. (Ed. Keydell, 43).
41 Einige Beispiele für schmerz- und schimpfliche Todesqualen: Antiochos IV. Epiphanes (AT, 2 Makka
bäer 9, 9); Herodes der Große (Flavius Josephus, Antiquitates Iudaicae, 17, 168; De bello Iudaico, 1, 656 f.);
Herodes Agrippa (NT, Acta Apostolorum, 12, 23); Galerius (Laktanz, De mortibus persecutorum, 33; Euse-
bios, Kirchengeschichte 8, 16).
42 Gregor von Tours, Historiae 3, 32 (Ed./Übers. Giesebrecht/Buchner, Bd. 1, 184 f.).
43 Gregor von Tours, Historiae 4, 9 (Ed./Übers. Giesebrecht/Buchner, Bd. 1, 202 f.).
44 Agathias, Historiae 2, 4; 2, 9 (Ed. Keydell, 44; 52 f.).
45 Agathias, Historiae 2, 9, 12 (Ed. Keydell, 53; Übers. Prokop, Gotenkriege, 1194 f.).
46 Gregor von Tours, Historiae, 3, 32 (Ed./Übers. Giesebrecht/Buchner, Bd. 1, 184 f.]; Rubin, Zeitalter Iustini
ans, 130.
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart172 karl-heinz leven
diesen Zug Theudeberts berichtete auch Prokop: eine Seuche sei ausgebrochen, nach-
dem die Franken aus Mangel an Lebensmitteln nur noch Rindfleisch und Flusswasser
zu sich genommen hätten.47 Es habe sich um eine Durchfallerkrankung (γαστρὸς ῥύσις,
δυσεντερίας νόσος) gehandelt, an der ein Drittel der Franken gestorben seien, woraufhin
das Heer, wie auch von Gregor von Tours erwähnt, in die Heimat zurückgekehrt sei.
Diätfehler erscheinen mithin als einzige Ursache der Seuche; der Gedanke, die Krank-
heit mit den zuvor erwähnten frevelhaften Menschenopfern der Franken in Verbindung
zu bringen, lag Prokop fern. Agathias sah wenige Jahrzehnte später bei dem vergleich-
baren Geschehen, das Butulins Heer betraf, den Diätfehler nur als eine mittelbare Ursa-
che, den Frevel der Franken hingegen als die eigentliche, die „wahre“ Ursache.
Das Motiv der Pest als Strafe für Sünde begegnete im Zusammenhang mit barba-
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
rischen Völkern in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung häufiger. Theophy-
laktos Simokates (spätes 6. Jh. – frühes 7. Jh.) berichtete in seiner „Weltgeschichte“
(οἰκουμενικὴ ἱστορία), in der die Regierungszeit Kaiser Maurikios‘ (582–602) dargestellt
wurde, über die Awaren, diese seien nach der Schändung der Kirche und des Grabes des
Heiligen Alexander (ἀνοσίως σκυλεύουσι καθυβρίζουσί τε) in Drizipera (Thrakien) vom
Himmel gestraft worden: „unser Jesus“ habe dem Anführer der Awaren, dem Chagan,
seine „Herrschergewalt“ (βασιλεία) bewiesen, und
„eine gewaltige Seuche befiel (ἐπιφοίτησις λοιμοῦ) … die Barbaren …, das Übel war unerbitt-
lich und es fand sich kein Mittel dagegen (τὸ κακὸν … σοφίσματος οὐκ ἀνεχόμενον). Der Cha-
gan erhielt jetzt die rechte Strafe (ἀξιολόγους ποινάς) für die Entehrung (ἠτιμάκει) des Märty-
rers Alexandros. Sieben seiner Kinder befiel die Beulenpest (βουβῶσι περιτυγχάνουσι), [es] …
gab … Weinen, Tränen … und Strafen, die nicht auszuhalten waren (ζημίαν ἀνυπομόνητον).
Von den Heerscharen der Engel wurde er getroffen (ἐβάλλετο), der Schlag (πληγή) war sichtbar,
das Heer jedoch war unsichtbar.“48
Die hier als „Beulenpest“ bezeichnete Krankheit, wohl in das Jahr 598 zu datieren, wird
üblicherweise als Folgeepidemie der „Justinianischen“ Pest gesehen.49 Das Bild der Pfei-
le abschießenden Engel, die solcherart den plötzlichen und unausweichlichen Pesttod
sandten, war in der griechischen Literatur als Bild der Seuche seit der homerischen Ilias
präsent.50 Dass ein marodierender Barbarenhaufen einer himmlischen Strafe anheim-
fiel, war ebenfalls ein Topos der griechischen Literatur, wie zwei Beispiele illustrieren
mögen. Der Autor der aus dem späten 5. Jh. v. Chr. stammenden hippokratischen Schrift
„Über die Umwelt“ schrieb den Skythen ein schändliches „Frauenleiden“ zu:
„Außerdem sind sehr viele von den Skythen Eunuchen (εὐνουχίαι) gleich; sie leisten Frauenar-
beiten und sprechen ähnlich wie Frauen. Solche werden Anarieis (Ἀναριεῖς) genannt. Die Ein-
47 Prokop, Gotenkriege 6, 25, 17 (Veh, Bd. 2, 394 f.).
48 Theophylaktos Simokates, Historiae 7, 15 (Ed. De Boor, 271; Übers. Schreiner, 195); die Übersetzung von
Schreiner, „von den Heerscharen der Engel wurde er hin- und hergeworfen“ ist ungenau, da das Verb
βάλλειν, im Aktiv „werfen“, „schießen“, hier im Passiv „getroffen werden [zu ergänzen: von Pfeilen]“ meint.
49 Stathakopulos, Famine and Pestilence, 330.
50 Homer, Ilias, 1, 49 f.
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart„Tollwut“ der Franken und wandernde Pest 173
heimischen weisen die Ursache (für deren Zustand) einer Gottheit zu (τὴν αἰτίην προστιθέασι
θεῷ).“51
Etwa eine Generation vor dem hippokratischen Autor hatte Herodot (ca. 485–
425 v. Chr.) bei den Skythen eine Gruppe von sog. „Enarern“ ausgemacht:
„Den Skythen nun, die das Heiligtum [der Aphrodite Urania] in Askalon plünderten (συλήσασι),
schickte die Göttin wie auch allen ihren Nachkommen ein ‚Frauenleiden‘ (ἐνέσκηψε ἡ θεὸς
θήλεαν νοῦσον). Die Skythen sagen daher, daß das Leiden davon herrühre; auch wer ins Sky-
thenland komme, könne bei ihnen den Zustand der Kranken sehen, die die Skythen Enarer
(τοὺς καλέουσι ἐνάρεας) nennen.“52
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
Über dieselben „Enarer“ heißt es an anderer Stelle bei Herodot: „die Enarer (Ἐνάρεες)
aber, die Zwitter [Transvestiten?] (ἀνδρόγυνοι), sagen, ihnen sei die Wahrsagekunst von
Aphrodite verliehen worden.“53
Offensichtlich lag den Versionen bei Herodot und dem hippokratischen Autor die
Beobachtung zugrunde, dass es bei den Skythen sog. „Anarieis“ bzw. „Enarer“ gab, ein
Wort, das die Griechen nur transkribierten; die dahinter stehende Geschichte begeg-
nete in zwei Versionen, die in einem entscheidenden Punkt überein stimmten: beide
Autoren benannten den eigentümlichen Zustand der „Anareis“ bzw. „Enarer“ als Folge
einer göttlichen Strafe für Frevel.
Das Motiv plündernder Nomaden, die beim Einbruch in die Kulturwelt früher oder
später einer himmlischen Bestrafung unterliegen mussten, hatte ein Gegenbild in der
Vorstellung, dass die nomadische Lebensweise gerade hinsichtlich von Seuchen auch
vorteilhaft sein konnte. Derselbe Agathias, der die Seuche des Leutharis und Butulin
schilderte, stellte an anderer Stelle seines Geschichtswerks fest, während der verheeren-
den zweiten Welle der „Justinianischen“ Pest (558 n. Chr.) seien hunnische Stämme an
der Peripherie des Byzantinischen Reiches verschont (ἐσώζετο) und im Vollbesitz ihrer
Kräfte geblieben.54
Der bereits zitierte Theophylaktos Simokates kannte in einem „Türkenexkurs“ ein
vergleichbares Phänomen:
„Auf zwei sehr bedeutende Dinge sind die türkischen Völker stolz (τὰ Τούρκων ἔθνη
μεγαλαυχεῖ): sie behaupten nämlich, daß sie seit urdenklicher Zeit niemals eine Seuche ge-
sehen hätten (μηδέποτε λοιμῶν ἐπιδημίαν θεάσασθαι) und daß Erdbeben in jenem Land selten
seien.“55
Theophylaktos Simokates erwähnte weiterhin eine Eigentümlichkeit offensichtlich
christlich getaufter Türken, die in einem Krieg zwischen Byzantinern und den sasa-
51 Hippokrates, Über die Umwelt, 22, 1 f. (Hg./Übers. Schubert/Leschhorn, 56 f.).
52 Herodot, Historien, 1, 105, 4 (Hg./Übers. Feix, 102 f.).
53 Herodot, Historien, 4, 67, 2 (Hg./Übers. Feix, 550 f.).
54 Agathias, Historiae, 5, 11, 5 (Ed. Keydell, 177).
55 Theophylaktos Simokates, Historiae, 7, 8, 13 f. (Ed. De Boor, 260; Übers. Schreiner, 188).
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, Stuttgart174 karl-heinz leven
nischen Persern in Gefangenschaft des Kaisers Maurikios (582–602) gerieten; diese
Türken hätten auf der Stirn ein eingeritztes Kreuzzeichen (τὸ τοῦ κυριακοῦ
ἐπίσημον) getragen, von dem sie behaupteten,
„sie hätten es von ihren Müttern erhalten. Als nämlich die östlichen Skythen eine starke Pest
heimsuchte (λοιμοῦ γὰρ … ἐνδημήσαντος), rieten angeblich einige Christen, der Stirne der
kleinen Knaben dieses Zeichen einzuritzen (ἐγκεντῆσαι). Da die Barbaren sich an diese Mah-
nung gehalten hatten, gereichte ihnen der Rat zur Rettung (σωτηρίαν ἐκ τῆς συμβουλίας).“56
Der lateinische Schriftsteller Corippus (gest. nach 567), der zur Zeit Kaiser Justins II.
(565–578) ein Lobgedicht auf den Feldherrn Johannes, der in Nordafrika die Berber
bekämpfte, vorlegte, behauptete, die „Seuche, Freundin des Kriegsgottes“, habe die Bar-
Free Download von der Franz Steiner Verlag eLibrary am 15.08.2022 um 11:45 Uhr
barenstämme nicht heimgesucht, da jene sich gehütet hätten, den „Ansteckungsstoff “
auf sich zu ziehen.57 In allen erwähnten Fällen ließen die byzantinischen Geschichts-
schreiber erkennen, dass die barbarische Lebensweise, im Gegensatz zur städtischen
Umgebung, vor der Pest schützte.
Wanderbewegung – Das aktive „Wesen“ der Pest
War bislang von wandernden (Barbaren-)Völkern die Rede, die beim Einbruch in den
Mittelmeerraum einer Seuche als himmlischer Strafe anheimfielen oder – in einigen
seltenen Fällen – als Nomaden an der Peripherie der Großreiche der Pest ausweichen
konnten, so ist nun ein weiteres Wanderungsphänomen darzustellen: die Wanderung
der Pest selbst. Dass eine Epidemie „wandert“ ist auch in der modernen Vorstellung
geläufig; eine ansteckende Krankheit breitet sich aus, indem Infizierte ihre Krankheits-
erreger an andere weitergeben. Außerdem bewegen sich die Träger von Krankheitser-
regern, Mensch oder Tier, im Raum und können solcherart die Krankheit in bislang
verschonte Gebiete bringen.
Doch in der Spätantike wurde die Wanderbewegung der Seuche nicht in medizi-
nischen Vorstellungen formuliert; das Umherstreifen der Seuche verwies auf höhere
Mächte, die hinter dem sichtbaren Geschehen wirkten. Das Aktive der Wanderbewe-
gung wurde bereits sprachlich deutlich, indem aktive intransitive Verben, bei denen die
Krankheit das Subjekt bildete, dominierten. Die Pest, die Agathias darstellte, „fiel ein“
(ἐνέπεσε) in ein Gebiet, sie „strömte herein“ (εἰσήρρησεν), „wanderte weiter“ (μεταβᾶσα)
und „kam zurück“ (ἐπανῆκεν).58 Evagrios Scholastikos, während seiner Lebenszeit Au-
genzeuge von nicht weniger als vier Pestwellen, beschrieb die Wanderung ähnlich: die
56 Theophylaktos Simokates, Historiae, 5, 10, 14 f. (Ed. De Boor, 208; Übers. Schreiner, 154 f.).
57 Corippus, Johannis, 388–390: „gentes non laesit amaras Martis amica lues: metuens tamen ille cavebat ne
mala praedatae caperet contagia terrae“ (Hg. Partsch, 62); vgl. Leven, „Miasma und Metadosis“, 48.
58 Agathias, Historiae, 5, 10, 1 f. (Ed. Keydell, 175 f.); ähnlich Prokop, Perserkriege 2, 22, 6 (Veh, Bd. 3, 356 f.).
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries
of copyright law is illegal and may be prosecuted.
This applies in particular to copies, translations, microfilming
as well as storage and processing in electronic systems.
© Franz Franz
Steiner Steiner Verlag2018
Verlag, StuttgartSie können auch lesen