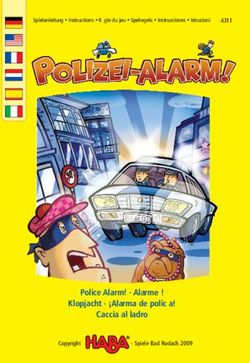Charles-Gaspard Peschier (1782-1853). Ein Wegbereiter der Homöopathie im französischen Sprachraum "Juger sans connaître c'est mentir"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Charles-Gaspard Peschier (1782-1853). Ein Wegbereiter der
Homöopathie im französischen Sprachraum
»Juger sans connaître c’est mentir«1
Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
Summary
Charles-Gaspard Peschier (1782-1853). A Pioneer of Homeopathic Medicine in Franco-phone Areas
Charles-Gaspard Peschier can be seen, together with the late Pierre Dufresne (1786-1836),
as the leading propagandist of homeopathy in French-speaking countries, especially in the
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
“Région du Léman”.
Beyond practising homeopathy himself, he dedicated his whole life to the propagation of
this healing method. Peschier initiated two homeopathic societies, gaining influence and a
strong reputation in the political arena. In 1832 he co-founded the “Bibliothèque Homoe-
opathique”, the first French journal of homeopathic medicine.
This study contains a compilation of Peschier’s publications, which have been summarised
for the first time in this form. Out of a total of 119 papers attributed to Peschier, 111 deal
with homeopathic issues.
Résumé
Un précurseur de l’homéopathie dans les pays francophones.
Charles-Gaspard Peschier (né et mort à Genève: 13 mars 1782 - 21 mai 1853).
Le nom de Peschier est un nom très connu à Genève. Dans cette famille on trouve
quelques pharmaciens, médecins, et autres savants. Après avoir reçu sa première éducation
à l’Académie de Genève, Charles-Gaspard Peschier entreprit la médecine et la chirurgie à
Paris où il obtint son doctorat en chirurgie en 1809. Il poursuivit ses études à l’Université
de Montpellier avant de s’établir d’abord à Genève et puis à Aubonne dans le canton de
Vaud. Il fut agrégé à la Société médicale de Genève en 1828. En plus il joua un rôle déci-
sif dans la franc-maçonnerie à Genève; la loge «Union des Coeurs» était dirigée plusieurs
années par le vénérable Charles-Gaspard Peschier.
A partir de 1831 le chirurgien Charles-Gaspard Peschier se consacra à l’étude sérieuse de
l’homéopathie qu’il en fit lui inspira un tel enthousiasme, que dès lors il fut un des plus
zèles disciples de Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) et un des plus ar-
dents défenseurs de sa doctrine. Il fut un propagandiste de tout premier plan de cette do-
maine dans les pays francophones, notamment dans la «Région du Léman». Sa contribu-
tion la plus connue fut la création, en 1832, de la «Bibliothèque homoeopathique» - le
premier journal homéopathique en français - en collaboration avec le médecin savoyard
Pierre Dufresne (1786-1836). Charles-Gaspard Peschier dirigea ce journal comme directeur
et principal rédacteur jusqu’à sa cessation en 1842 pour des raisons économiques. En outre
la «Société homoeopathique Gallicane» et la «Société homoeopathique Lémanienne» fu-
rent fondée en 1832 respectivement 1833 également sous l’impulsion de Charles-Gaspard
Peschier. De cette manière il entra pour beaucoup dans la transmission de l’homéopathie.
Charles-Gaspard Peschier mourut d’hydropisie, le 21 mai 1853, à l’âge de 71 ans.
1 Vgl. Tischner (1939), S. 468.
MedGG 21 2002, S. 143-172
Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart
Franz Steiner Verlag144 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
Herkunft und Familie
Charles-Gaspard Peschier (Abb. 1) wurde als fünftes Kind des Apothekers
Charles-Antoine Peschier und dessen Ehefrau Jacqueline Peschier-Laurens
am Freitag, den 13. März 1782 in der unabhängigen »République de
Genève« geboren. Seine am 5. Juni 1811 geschlossene Ehe mit Françoise-
Guillemine Scheunberguer blieb kinderlos.2 Charles-Gaspard Peschier ent-
stammte einer angesehenen Genfer Familie, deren Vorfahren um 1700 als
hugenottische Glaubensflüchtlinge aus Bagnols im Languedoc in der Calvi-
nstadt politisches Asyl fanden. Sein Großvater Pierre Peschier (1688-1766)3
wurde zum Begründer einer über hundertjährigen Apothekerdynastie in
Genf. 1730 hatte er die Apotheke in der Grand-Rue 15 – der Hauptver-
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
kehrsader der »Haute Ville privilégiée« – von Philippe II Rubatty (1668-
1739) erworben.4 Der Familientradition folgend, ergriff Charles-Gaspard
Peschiers ältester Bruder Jacques Peschier (1769-1832) den Beruf des Apo-
thekers.5 Nachdem er 1795 seine Approbation als »Maître pharmacien«
erhalten hatte, leitete er zunächst gemeinsam mit seinem Vater die in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur »Pharmacie Colladon« gelegene »Pharmacie
Peschier«, bevor er diese 1817 als Alleinbesitzer übernahm.
Jacques Peschier zählte zu den wissenschaftlich ambitionierten Apothekern,
verfaßte zwei Monographien und 59 Zeitschriftenaufsätze, hielt Vorträge
und stand mit dem »Vater der wissenschaftlichen Pharmazie Deutsch-
lands«, dem Erfurter Apotheker und Professor der Chemie, Johann Bartho-
lomäus Trommsdorff (1770-1837),6 nachweislich zwischen 1819 und 1830
in brieflichem Kontakt.
Charles-Gaspard Peschiers um acht Jahre jüngerer Bruder Jean (1774-1831)
widmete sich gleichfalls der Medizin. Nachdem er 1797 sein Studium in
Edinburgh mit einer Promotion als »Docteur en médecine« abgeschlossen
hatte, wirkte er als niedergelassener Arzt in seiner Heimatstadt.7 Besondere
Verdienste erwarb sich Jean Peschier gemeinsam mit den beiden Genfer
Ärzten Louis Odier (1748-1817) und Jean-François Coindet (1774-1850)
um die Einführung und Weiterentwicklung der Vakzination mit Kuhpok-
ken. Darüber hinaus war er als Hospitalarzt sowie im politischen Bereich
von 1814 bis 1830 als »Conseil représentatif« in der Calvinstadt tätig.
Ausbildung und erste praktische Tätigkeit
2 Vgl. Choisy/Dufour-Vernes (1902), S. 438.
3 Vgl. Choisy/Dufour-Vernes (1902), S. 432.
4 Vgl. Archives d’Etat de Genève; Jean-Jacques I Choisy, notaire, 13 may 1730.
5 Zur Biographie von Jacques Peschier siehe Reichenbach (2001).
6 Zur Biographie von Johann Bartholomäus Trommsdorff siehe Abe (1971/72); Fried-
rich (1987); Götz (1977).
7 Peschier, Jean (1797).
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 145
Nach dem Besuch des »Collège de Calvin« in Genf studierte Charles-
Gaspard Peschier ab dem 1. Juli 1797 an der dortigen »Académie de Cal-
vin« zunächst Literatur und ab Juni 1799 Philosophie. Zur Fortführung
seiner Ausbildung ging er anschließend nach Paris, wo er 1803 das Medi-
zin- und Chirurgiestudium aufnahm, das er am 17. August 1809 mit einer
Promotion8 als »Docteur en chirurgie« abschloß.9 1812 belegte er an der
»Université de Montpellier« einen medizinischen Kursus. Nach seiner
Rückkehr praktizierte er in Genf und später im waadtländischen Aubonne,
wurde 1828 Mitglied der »Société médicale de Genève« und 1834 deren
Vorsitzender.10 Die Anerkennung, die Charles-Gaspard Peschier inzwischen
gefunden hatte, belegt die 1824 verliehene Ehrenmitgliedschaft der »Medi-
cinisch-chirurgischen Gesellschaft« des Kantons Zürich.11
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
Außerdem war er maßgeblich an der Untersuchung über die Wirksamkeit
des ätherischen Farnkrautwurzel-Extraktes »Extractum filicis« beteiligt, den
sein Bruder, der Apotheker Jacques Peschier, – er bezeichnete ihn als
»Oléo-résine de la fougère mâle« – 1824 erstmals herstellte und anschlie-
ßend nicht nur in Genf, sondern in ganz Europa vertrieb.12
Freimaurer
Wie viele Ärzte und Apotheker dieser Zeit war auch Charles-Gaspard Pe-
schier Mitglied einer Freimaurerloge. Erste Kontakte zur Freimaurerei13 hat-
te er bereits während seiner Studienzeit in Genf, als er zwischen 1801 und
1803 Mitglied der Loge »Fraternité« wurde, die damals einen beachtlichen
Einfluß unter den Genfer Logen besaß.14 Sein Engagement in der Freimau-
rerei wurde wohl nur während seiner Pariser Studienzeit von 1803 bis 1809
unterbrochen, für die sich eine Mitgliedschaft in einer Loge nicht nachwei-
sen ließ. Unter dem Namen »eques a scalpello« bekleidete er in der Loge
»Union des Coeurs« unmittelbar nach seiner Rückkehr von 1809 bis 1819
sowie nochmals zwischen 1822 und 1834 die führende Stellung als
»Vénérable« (Meister vom Stuhl).15 Peschier, der sich auch mit Spiritualität
und Mystik befaßte, verlieh seiner Loge eine ausgesprochen religiöse Prä-
gung (Abb. 2).16 Die gemeinsame Zugehörigkeit zur Freimaurerei erleichter-
8 Peschier, Charles-Gaspard (1809).
9 Stelling-Michaud/Stelling-Michaud (1976), S. 141.
10 Picot/Thomas (1923), S. 168.
11 Vgl. S. N. (1827).
12 Peschier, Charles-Gaspard (1825).
13 Zur Geschichte der Freimaurerei in Genf siehe Ruchon (1935); Cahorn (1915).
14 Ruchon (1935), S. 91.
15 Vgl. Ruchon (1935), S. 127f. und 139.
16 Vgl. Ruchon (1935), S. 128.
Franz Steiner Verlag146 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
te ihm auch die Bekanntschaft mit Christian Friedrich Samuel Hahnemann
(1755-1843)17, dem Begründer der Homöopathie18, der 1817 in die Leipzi-
ger Loge »Minerva zu den drei Palmen« aufgenommen worden war.
Die Ausbreitung der Homöopathie im französischen Sprachraum
Obwohl die im französischen Sprach- und Kulturkreis liegende »Républi-
que de Genève«, die mit der Annexion durch Frankreich 1798 zum »Chef-
lieu du département du Léman« bestimmt worden war und zugleich ihre
politische Unabhängigkeit verloren hatte, nach dem Wiener Kongreß 1815
der schweizerischen Eidgenossenschaft beigetreten war, sollen im folgenden
Charles-Gaspard Peschiers Wirkungskreis sowie seine Leistungen insbeson-
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
dere im Zusammenhang mit Frankreich und der »Région du Léman« näher
untersucht werden.
Erste Zentren der Homöopathie im französischen Sprachraum waren Lyon,
Genf und das Elsaß. Eine Schlüsselrolle kam dabei dem neapolitanischen
Grafen Sébastien Des Guidi (1769-1863) zu, der sich als Arzt in Lyon seit
1828 zur »neuen Medizin« bekannte und darüber hinaus Schüler warb,19
die ihrerseits die Hahnemannsche Lehre erfolgreich verbreiteten.20
Einer dieser frühen Anhänger war der aus La Tour près de Saint-Jeoire
(Région Faucigny, Département Haute-Savoie) stammende und später in
Genf praktizierende Arzt Pierre Dufresne (1786-1836).21 Sein Interesse an
der Homöopathie war durch Mitteilungen seines Genfer Freundes Adolphe
Pictet (1799-1875) Ende der 1820er Jahre geweckt worden. Auf Grund guter
Beziehungen, die Dufresne seit seiner Studienzeit zu Michel-Félix Dunal
(1789-1856) unterhielt, der als Nachfolger von Augustin-Pyramus de Can-
dolle (1778-1841) als Professor der Botanik an der »Université de Montpel-
lier« wirkte, fand die Homöopathie an der traditionsreichen südfranzösi-
schen Medizinschule sehr bald Einzug in den Lehrplan. Maßgeblichen An-
17 Zur Biographie von Christian Friedrich Samuel Hahnemann siehe Albrecht (1875);
Haehl (1922); Gumpert (1934); Handley (1993); Jütte (1996), S. 179-221.
18 Zur Geschichte der Homöopathie siehe Rapou (1847); Tischner (1939); Dinges
(1996); Jütte (1996), S. 179-221.
19 Vgl. Gijswijt-Hofstra (1997), S. 165f.
20 Zur Geschichte der Homöopathie in Frankreich vgl. Janot (1936); Garden (1992);
Faure (1996).
21 Pierre Dufresne erhielt seine medizinische Ausbildung zwischen 1807 und 1811 an der
»Université de Montpellier«, wo er als Schüler des bedeutenden Professors der Bota-
nik, Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841), am 14. Juni 1811 mit der Dissertati-
on »Histoire naturelle et médicale de la famille des Valérianées« promoviert wurde,
bevor er sich 1812 zunächst in Chêne-Thonex und anschließend in Genf als Arzt nie-
derließ. Außerdem war Dufresne 1823 einer der sechs Gründungsmitglieder der
»Société médicale de Genève«; vgl. Picot/Thomas (1923), S. 10-12.
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 147
teil daran hatte der Professor der allgemeinen Pathologie und Therapie, der
gebürtige Spanier Benigno Juan Isidoro Risueño de Amador (1802-1849).
Die Veröffentlichung seines Aufsatzes »Sur la nouvelle thérapeutique médi-
cale, nommée Homoeopathie« in der Bibliothèque homoeopathique22 brachte
Dufresne alsbald in Verbindung mit zahlreichen aufgeschlossenen Ärzten,
wie z. B. Jean Marie Dessaix (1880-?) in Thonon, Longchamp in Fribourg,
Toussaint Rapou (1777-1852) in Lyon und Alexandre Chargé (1810-?) in
Marseille. Gleichsam die Krönung seiner beruflichen Laufbahn bildeten die
Untersuchung sowie die praktische Anwendung von Methoden zur Be-
kämpfung der »Maladie charbonneuse«.23 Richtungsweisend wurde ferner
seine Behandlung mit »Anthracin«24, das er 1836 gemäß dem homöopathi-
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
schen Grundsatz in potenzierter Form verabreichte, und mit dem er sowohl
bei Menschen als auch bei Schafen durchschlagenden Erfolg erzielte.25
Vierzehn Jahre vor der Entdeckung des Milzbranderregers »Bacillus anth-
racis« durch Casimir Joseph Davaine (1811-1882) 1850 und 45 Jahre vor
der Einführung des Impfstoffes durch Louis Pasteur (1882-1895) 1881 hatte
er ein wegweisendes Erklärungsmodell für die Entstehung und Ausbreitung
von Infektionskrankheiten geliefert.
Mit dem Tod von Pierre Dufresne 1836 verlor die Homöopathie einen ihrer
wichtigsten Vorkämpfer in der »Région du Léman«. Allerdings war es ihm
gelungen, seine Begeisterung für die neue Lehre an seinen Sohn Jean-Marie-
Edouard Dufresne (1818-1898) weiterzugeben, der 1839 in Lyon das Medi-
zinstudium aufgenommen hatte, bevor er 1840 nach Paris übersiedelte, wo
er am 23. Januar 1846 zum »Docteur en médecine« promoviert wurde.26
Bereits als Schüler von Jean Paul Tessier (1811-1862), der als Krankenhaus-
arzt am »Hôpital Sainte-Marguerite« in einem Nebengebäude des »Hôtel-
Dieu« in Paris tätig war, setzte er sich für die Verbreitung der Homöopathie
in Frankreich ein, indem er seinen Lehrer anregte, sich mit diesem Thera-
pieverfahren zu beschäftigen und es zu erproben. Nachdem Tessier ab 1848
22 Dufresne, Pierre (1832).
23 Die »Maladie charbonneuse«, auch als Milzbrand oder Anthrax bezeichnet, ist eine
hochpathogene Infektionskrankheit beim Menschen und herbivoren Tieren, nament-
lich Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen und Pferden. Zur Morphologie, Pathogene-
se, Therapie, Epidemiologie und Prophylaxe dieser durch »Bacillus anthracis« verur-
sachten Krankheit siehe Wiesmann (1982), S. 181-183.
Das komplexe Thema stand jüngst im Zusammenhang mit Anschlägen, verursacht
durch »biologische Waffen«, weltweit im Zentrum der Tagesaktualität. Besorgte Ärzte
und Bürger in Amerika horteten Unmengen an Ciprofloxacin (Ciprobay und Cipro-
xin, Bayer AG), dem einzig dagegen wirksamen Antibiotikum, so daß die Hersteller-
firma die Produktion sogleich massiv erhöhen mußte.
24 Zur Herstellung des Anthracins benutzte Dufresne Flüssigkeit aus Milzbrandpusteln
sowie Blut infizierter Ratten; vgl. Duprat (1955).
25 Vgl. Dufresne, Pierre (1837), S. 200-221 und 271-284.
26 Vgl. Dufresne, Jean-Marie-Edouard (1846).
Franz Steiner Verlag148 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
mit der homöopathischen Behandlung von Pneumonien und Cholera erste
Erfolge erzielt hatte, erlernte er diese Therapie und avancierte zum Ausbil-
der bedeutender homöopathischer Ärzte in Frankreich wie z. B. Pierre Jous-
set (1818-1910), Frédéric Gabalda (1818-1863) und Jules Davasse (1819-
1879).27
Gewiß angeregt durch seinen Lehrer in Paris, trat Jean-Marie-Edouard
Dufresne für den Bau des »Hôpital de Plainpalais« in Genf ein, des ersten
homöopathischen Hospitals in der Schweiz, das von 1846 bis 1876 unter
seiner Leitung stand.
Charles-Gaspard Peschier und Samuel Hahnemann
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
Charles-Gaspard Peschiers Schlüsselerlebnis, das ihn auf die Homöopathie
aufmerksam werden ließ, war die ab 1830 sich von Indien ausbreitende
Choleraepidemie.28 Bis 1828 blieb sie fast nur auf Asien beschränkt, gelang-
te dann jedoch auf dem Seeweg über Arabien und Ägypten nach Europa.
In Stettin, Küstrin und Berlin fanden bereits 1831/32 1.423 Menschen
durch die Cholera29 den Tod, während zur selben Zeit in Paris über 18.000
Personen dahingerafft wurden, denen die Schulmedizin nicht hatte helfen
können.30
Nachdem Peschier, der als äußerst sprachbegabt galt,31 sich zunächst per-
fekte Kenntnisse der deutschen Sprache angeeignet hatte, begann er 1831
mit dem gründlichen Studium von Hahnemanns »Organon der Heilkunst«.
Im folgenden Jahr unternahm er eine größere Reise, um an der 3. Jahres-
versammlung des »Homöopathischen Zentralvereins«, die am 10. August
1832 in Leipzig stattfand, teilzunehmen.32 Im Anschluß daran reiste er am
13. August 1832 ins nahegelegene Köthen, wo er Christian Friedrich Sa-
muel Hahnemann einen persönlichen Besuch abstattete. Peschiers ausführ-
licher, sprachlich wie inhaltlich beeindruckender Bericht über diese Reise
sowie seine Begegnungen mit Hahnemann in dessen Wohnhaus in der
27 Vgl. Demarque (1981), S. 240.
28 Somit fällt Peschiers Übertritt zur Homöopathie, den er als Chirurg in seinem 48.
Lebensjahr vollzog, gemäß Gijswijt-Hofstra – der Genfer Gelehrte blieb allerdings in
dieser Zusammenstellung unberücksichtigt – in die weniger spektakuläre Kategorie
»route of experiment«; in der aufsehenerregenderen »dramatic line« führte sie demge-
genüber Homöopathen an, deren Angehörige oder Patienten durch die neue Lehre
wundersame Heilungen erfahren hatten; vgl. Gijswijt-Hofstra (1997), S. 162-169.
29 Zur Cholera und deren zeitgenössischer konventioneller sowie homöopathischer The-
rapie siehe Quin (1832); Scheible (1992).
30 Vgl. Schreiber/Mathys (1987), S. 37-47.
31 Peschier beherrschte neben den meisten Sprachen Europas sogar Hebräisch, um die
Bibel in ihrer Originalfassung lesen zu können; vgl. S. N. (1854).
32 Zur Geschichte des »Homöopathischen Zentralvereins« siehe Haehl (1929).
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 149
Wall-Straße 217 (Abb. 3),33 reflektiert anschaulich Schwierigkeiten, Befind-
lichkeiten und Stimmungslage, denen Wissenschaftler auf Bildungsreisen in
den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ausgesetzt waren.34 Er be-
schrieb seine Anreise aus Leipzig und vermittelte geographische und histo-
rische Einzelheiten über die anhaltinische Residenzstadt Köthen, die er als
»petite forteresse« bezeichnete. Ferner berichtete Peschier über das Palais
des Herzogs Ferdinand
[...] le château du duc régnant [...] est entouré d’un jardin ouvert au public, où les
fleurs même les plus rares sont cultivées avec beaucoup de soin. La duchesse douai-
rière habite un joli château de plaisance, entouré de jardins, d’étangs habités par des
cygnes, et tous les agrémens de la campagne; il est situé aux portes de la ville, dont il
n’est séparé que par une promenade et un bosquet.35
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
Darüber hinaus schilderte er auch Hahnemanns Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen. Anläßlich ihres ersten Zusammentreffens begrüßte Hahnemann
Peschier mit der familiären Anrede »mon cher fils«, der Genfer Gelehrte
seinerseits nannte ihn vertraulich »mon père«, was wohl zugleich den in
Freimaurergemeinschaften gepflegten Umgangston erkennen läßt. Die in
herzlicher Atmosphäre geführten fachlichen und persönlichen Gespräche
zogen sich mehrere Abende jeweils über fünf oder sechs Stunden hin. Zen-
trale Themen dieser Unterredungen betrafen Hahnemanns Erläuterungen
zu seiner Lehre und seine praktischen Erfahrungen sowie die Besprechung
einzelner Krankheitsfälle und deren Therapien. Peschier lobte insbesondere
die Gastfreundschaft, die er anläßlich seiner Besuche im Hause Hahne-
manns erfahren durfte,
ses aimables filles prodiguaient leurs soins et leurs attentions pour nous offrir des raf-
fraîchissemens, une collation, un souper, qui témoignaient par leur abondance et leur
délicatesse du plaisir que cette honorable famille éprouvait à fêter un hôte venu de si
loin.36
Im Anschluß an seinen Besuch in Köthen reiste Peschier weiter nach Des-
sau, Potsdam und Berlin, wo er im Hotel »Zum goldenen Engel« in der
Heilig-Geist-Straße logierte und die persönliche Bekanntschaft einiger be-
deutender Wissenschaftler, Künstler und Politiker machte, unter ihnen
Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836),37 Johann Friedrich Dieffenbach
33 Hahnemann bezog 1821 das Eckhaus in der Wall-Straße 217 in Köthen, wo er bis zu
seiner Übersiedlung nach Paris 1835 wohnte und praktizierte.
34 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Visite (1832).
35 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Visite (1832), S. 4f.
36 Vgl. Peschier, Charles Gaspard: Visite (1832), S. 11f.
37 Hufeland war Arzt und Professor an der Universität in Jena, bevor er 1801 einem Ruf
als Leibarzt der königlichen Familie nach Berlin folgte. Damit übernahm er zugleich
das Direktorat des »Collegium medico-chirurgicum«, der seit 1724 bestehenden mili-
tär- und wundärztlichen Ausbildungsstätte und die Position als erster Arzt der Cha-
rité; vgl. Eckart/Gradmann (1995), S. 200f.
Franz Steiner Verlag150 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
(1795-1847),38 Johann Gottfried Schadow (1764-1850)39 und Friedrich Karl
von Savigny (1779-1861).40 Danach kehrte er über Dresden und München
in die Schweiz zurück.41
Die Bekanntschaft mit der jungen Pariser Künstlerin Mélanie d’Hervilly-
Gohier (1800-1878) 42 (Abb. 4), die im Herbst 1834 als Patientin nach
Köthen gereist war, veranlaßte bekanntlich den fast 80jährigen Hahnemann
zu einer vollständigen Loslösung und Abkehr von seiner bisherigen Le-
bensweise. Bereits kurz nach der am 18. Januar 1835 erfolgten Hochzeit
beschloß er, sich gemeinsam mit seiner Ehefrau in der französischen Metro-
pole eine neue Existenz aufzubauen. Peschier war einer der ersten, die Sa-
muel und Mélanie Hahnemann nach ihrem Umzug in ihrem neuen Heim
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
in der »7, Rue Madame« – beim »Jardin du Luxembourg« – besuchten.43
Begeistert berichtete er in einem Brief vom 13. Juli 1835, daß er mit dersel-
ben Herzlichkeit empfangen worden sei wie drei Jahre zuvor in Köthen. Er
beglückwünschte das frisch vermählte Paar und lobte den vorteilhaften Ein-
fluß, den die intelligente junge Dame auf den jugendlich wirkenden
Hahnemann ausübte.44
Charles-Gaspard Peschiers Verdienste um die Homöopathie
38 Der in Königsberg geborene Arzt und Chirurg Dieffenbach wurde 1832 zum Profes-
sor an der Charité ernannt und zählt zu den Begründern der modernen plastischen
Chirurgie, die er durch zahlreiche neue Operationsmethoden bereicherte; vgl.
Eckart/Gradmann (1995), S. 108.
39 Der 1788 zum Hofbildhauer und 1816 zum Leiter der Akademie der Künste berufene
Schadow gilt als Hauptvertreter der deutschen klassizistischen Bildhauerei; vgl. DNB
4 (1942), S. 49.
40 Als Haupt der historischen Rechtsschule hat der preußische Staatsmann von Savigny
die deutsche Rechtswissenschaft entscheidend geprägt und zur Begründung ihrer füh-
renden Stellung in Europa beigetragen; vgl. DNB 4 (1942), S. 44.
41 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Troisième (1833). Dieser Aufsatz enthält eine Fülle
geographisch, historisch und kulturell wertvoller Ausführungen zu den bereisten
Landschaften und Städten in Brandenburg, Sachsen, Bayern und der Schweiz.
42 Gumpert (1934), S. 224.
43 Nachdem Samuel und Mélanie Hahnemann am 7. Juni 1835 Köthen verlassen hatten,
erreichten sie Paris am 21. Juni 1835, wo sie zunächst Mélanies Wohnung in der »26,
Rue des Saints-Pères«, die im Quartier »Saint-Germain-des-Prés« gelegen war, bezo-
gen. Da sich diese Wohnung schon bald als zu eng erwiesen hatte, erfolgte bereits am
15. Juli 1832 der erste Umzug in ein Haus in der »7, Rue Madame« im selben Stadt-
teil, dessen Garten an der Hinterfront direkt mit dem Jardin du Luxembourg in Ver-
bindung stand. Im Frühjahr 1837 schließlich wechselten Samuel und Mélanie
Hahnemann ein letztes Mal ihre gemeinsame Wohnung, indem sie in ein geräumiges
und vornehmes »Hôtel« in der »l, Rue de Milan«, das nördlich der Seine in der Nähe
des heutigen Gare St. Lazare und der Opéra Garnier gelegen war, einzogen, wo sie
auch gemeinsam ihre Praxis führten.
44 Vgl. Bradford (1895), S. 352.
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 151
Im Unterschied zu Hahnemann, der sich mit seinen Schriften vornehmlich
an Mediziner wandte, veröffentlichte Peschier neben Fachaufsätzen in der
Bibliothèque homoeopathique auch Beiträge, die direkt für ein »Laienpubli-
kum« oder auch die Gegner der Homöopathie bestimmt waren. Mit popu-
lärwissenschaftlichen Broschüren, Streitschriften und Briefen wollte der
sprachgewandte Genfer Homöopath der Bevölkerung die Grundlagen für
»La médecine homoeopathique« und ihre Vorzüge darlegen, zugleich aber
auch auf mitunter fatale Folgen schulmedizinischer Behandlungen aufmerk-
sam machen.45
Peschier trat bedingungslos für Hahnemanns Lehre ein. Er deckte Wider-
sprüche der Gegner auf, bekämpfte sie, indem er das Publikum zum Zeugen
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
anrief und die praktischen Vorteile einer sanften und gleichsam kostengüns-
tigen Heilmethode hervorhob, die die Unannehmlichkeiten der schulmedi-
zinischen Therapien, wie sie beispielsweise Aderlaß, Brech- und Purgiermit-
tel verursachten, vermied.46 Damit leistete Peschier auch einen Beitrag zur
gesellschaftlichen Legitimierung der Homöopathie. Seine Schriften enthal-
ten häufig Vergleiche von Behandlungsverfahren, wobei er – gestützt auf
statistische Methoden – nachwies, daß Kranke, die allopathisch behandelt
wurden, eine deutlich höhere Mortalität aufwiesen als homöopathisch oder
nicht behandelte Personen. Als Informationsquellen dienten ihm neben ei-
genen praktischen Erfahrungen mündliche und briefliche Mitteilungen be-
freundeter Kollegen sowie das Studium zahlreicher homöopathischer Zeit-
schriften und Bücher aus Europa und Amerika.
Die im April 1832 gegründete erste homöopathische Fachzeitschrift in fran-
zösischer Sprache,47 die zunächst alle zwei Monate und ab April 1834 mo-
natlich erscheinende Bibliothèque homoeopathique, die Peschier gemeinsam
mit Pierre Dufresne redigierte (Abb. 5)48, hatte den Anstoß zu einer ver-
stärkten Beschäftigung mit dieser Lehre gegeben. Die Zeitschrift sorgte für
die weitere Verbreitung der Homöopathie im romanischen Sprachraum
und war somit maßgeblich am deutsch-französischen Wissenschaftstransfer
beteiligt. Peschier bereicherte diese Zeitschrift nicht nur mit eigenen Beiträ-
45 Siehe die Zusammenstellung der Publikationen von Charles-Gaspard Peschier am
Ende des Aufsatzes.
46 Größere Beachtung erlangte die Homöopathie nicht zuletzt aus dem Versagen der
»aderlassenden« Medizin bei der Behandlung der Cholera zwischen 1830 und 1836,
während die Homöopathie hier Erfolge verzeichnen konnte; vgl. Scheible (1992), S.
70-76.
47 Siehe Abbildung 5. Erst danach erfolgte in Paris die Gründung zweier weiterer homö-
opathischer Periodika, nämlich 1833 das zweimal monatlich erscheinende Journal de
médecine homoeopathique sowie 1834 das monatlich publizierte Archives de la médecine
homoeopathique.
48 Als Schriftleiter der Bibliothèque homoeopathique erwähnte Fäh neben Peschier an Stelle
von Pierre Dufresne irrtümlich dessen Sohn Jean-Marie-Edouard Dufresne (1818-
1898); vgl. Fäh (1996), S. 105.
Franz Steiner Verlag152 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
gen zu aktuellen Themen, wie beispielsweise der Behandlung der damaligen
Epidemien (Cholera und Typhus), sondern auch mit Berichten über die
Versammlungen homöopathischer Vereine sowie mit zahlreichen Buchbe-
sprechungen. In einem seiner ersten Aufsätze gab er eine detaillierte Über-
sicht über die Zubereitung, Konservierung sowie die Abgabe homöopathi-
scher Arzneimittel.49
Auch seine weiteren Arbeiten belegen ein beachtliches pharmazeutisches
Wissen, und es darf vermutet werden, daß Peschier ein enges Verhältnis
zum Apotheker Samuel Reymond (1807-1836) hatte, der als Nachfolger
seines 1832 verstorbenen Bruders Jacques die Apotheke in der Grand-Rue
16 führte. Schließlich sorgte Peschier mit Übersetzungen deutschsprachiger
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
Originalwerke für eine schnelle Rezeption dieser Schriften.
Bereits 1837 beabsichtigte Peschier wegen der Überlastung der redaktionel-
len Mitarbeiter die Einstellung der Bibliothèque homoeopathique, wie er im
Anhang zum achten Band mitteilte:
En voyant succomber à leurs fatigues nos collaborateurs de près et de loin, [...], nous
avons senti notre courage faiblir; nous avons reculé devant la continuité de cette
tâche, qui ne nous offrait pas à un point suffisant le pretium operae; nous avons eu
l’intention et le désir de terminer l’existence de la Bibliothèque homoeopathique à son
8e volume.50
Zahlreiche Briefe sowie mehrere persönliche Besuche der »amis zélés de
l’homoeopathie« veranlaßten ihn dann aber, die Zeitschrift fortzuführen.
Für die Redaktion des Journals konnten neue Mitarbeiter gewonnen wer-
den. Neben der Bearbeitung einer umfassenden Korrespondenz sollten Be-
richte »de nouveau voyage pour aller à la source de la lumière scientifique«
im Zentrum des Journals stehen. Zugleich veränderte Peschier die Zielset-
zung des Journals, das bisher vornehmlich praxisorientierten Beiträgen ge-
widmet war, indem er ankündigte
et nous admettrons des articles dogmatiques dans lesquels on cherchera à démontrer
la supériorité scientifique et théorique de la doctrine homoeopathique par-dessus
l‘allopathique, l’étéropathique et toutes autres; [...], et nous ne chercherons la victoire
que dans la force et la justesse des raisonnements à l’exclusion de toute personnalité.51
Peschier unterhielt Beziehungen zu führenden Ärzten der damaligen Zeit,
wie beispielsweise Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872), Kliniker im
»Hôtel-Dieu« in Paris,52 Charles-Polydore Forget (1800-1861), Professor der
49 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Préparation (1832), S. 85-100.
50 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1837), S. I.
51 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1837), S. III.
52 Louis war seit 1825 Mitglied der »Académie de médecine« in Paris und erwarb sich
bedeutende Verdienste auf den Gebieten der Pathologie und der Anatomie sowie als
Fachschriftsteller; vgl. Hirsch Bd. 3 (1931), S. 848f., und Index (1991), S. 133.
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 153
klinischen Medizin an der Universität Straßburg53 und Gabriel Andral
(1797-1876), Professor der allgemeinen Pathologie und Therapie an der
Medizinischen Fakultät Paris.54 Als Redakteur sah Peschier es als eine wich-
tige Pflicht an, seine Kontakte ständig zu erweitern. Um die praktizierenden
homöopathischen Ärzte der damaligen Zeit persönlich kennenzulernen,
bereiste er große Teile Europas.55 Auf einer dieser Reisen kam Peschier in
Kontakt mit bisher meist unbekannten homöopathischen Fachgenossen,
aber auch Laienheilern aus Südfrankreich und dem Piemont, unter ihnen
Crépu und Juvin aus Grenoble, Alexandre Chargé (1810-?), Sollier und
Duplat aus Marseille, Payen aus Avignon und J.-J. Béchet (1813-1884) aus
Montpellier, Daniel und Taxil aus Toulon, Flores und Torneri aus Nizza,
Onis und Botto aus Genua, Chio, Saracco, Sanvito und Poeti aus Turin.56
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
1842 erfolgte auf Grund finanzieller Schwierigkeiten allerdings die Einstel-
lung der von Peschier 1832 mitbegründeten Bibliothèque homoeopathique. Die
hier erstmalig gegebene Zusammenstellung seiner Publikationen (Tabelle)
widerspiegelt eine umfangreiche publizistische Tätigkeit, die vor allem mit
der Zeitschrift verbunden war, weshalb nach 1842 kaum noch Arbeiten von
Peschier erschienen. Insgesamt konnten 119 Aufsätze nachgewiesen werden,
von denen 111 homöopathische Themen behandelten.
Bereits in einer seiner ersten Publikationen wandte sich Peschier 1832 an
das Laienpublikum, um diesem die neue medizinische Lehre vorzustellen
und detaillierte Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Homöopathie
durch Hahnemann zu gewähren. Außerdem wies er darauf hin, daß
I. L’homoeopathie guérit des cas que l’autre médecine ne guérit pas; [...].
II. L’homoeopathie guérit réellement des maladies qui souvent ne sont que dépla-
cées, [...].
III. L’homoeopathie guérit quelquefois avec une étonnante rapidité des maladie très-
graves, [...].
IV. L’homoeopathie n’emploie qu’un très-petit nombre de remèdes dans la même ma-
ladie, et en très-petites doses, [...]
V. L’homoeopathie n’administre que des remèdes insipides ou agreables au goût.57
53 Forget war ein Vertreter der »philosophischen Medizin« und wurde 1836 Mitglied der
»Académie de médecine« in Paris; vgl. Hirsch Bd. 2 (1930), S. 569f., und Index
(1991), S. 79.
54 Andrals wissenschaftliche Hauptleistung war die Publikation seiner Clinique médicale,
die zum grundlegenden Werk für die medizinische Klinik in Frankreich wurde. 1823
erfolgte seine Aufnahme als Mitglied der »Académie de médecine« in Paris; vgl.
Hirsch Bd. 1 (1929), S. 131-133, und Index (1991), S. 4.
55 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Visite (1832); Peschier, Charles-Gaspard: Troisième
(1833) und Peschier, Charles-Gaspard (1839).
56 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1839), S. 1-28.
57 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Deux (1832), S. 12.
Franz Steiner Verlag154 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
Zugleich vertrat er die Auffassung, daß das Studium der Homöopathie
gründlich, gewissenhaft und wissenschaftlich betrieben werden müsse, und
daß ihre Anwendung ein umfassendes und sicheres Gedächtnis, überdurch-
schnittliches Urteilsvermögen, höchste Aufmerksamkeit sowie beständiges
Nachdenken erfordere und verlange:
Partant de là, tout docteur qui ne se sentira pas capable d’un travail réel de sa vie en-
tière fera bien de ne pas se livrer à l’homoeopathie.58
Schließlich äußerte er sich zur Entwicklung und Verbreitung der Homöo-
pathie außerordentlich zuversichtlich, zu optimistisch indessen, wie die Zu-
kunft zeigen sollte
[...]; et je ne mets nullement en doute que, dans un très-petit nombre d’années, tous
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
mes honorables confrères seront médecins homoeopathes.59
Eine weitere Veröffentlichung Peschiers aus der Anfangszeit befaßte sich
mit der Therapie sowie der Prophylaxe der Choleraerkrankungen. In dieser
gleichfalls für das Laienpublikum bestimmten Schrift wies er nachdrücklich
auf die zentrale Bedeutung diätetischer Maßnahmen als Vorbeugungsmaß-
nahmen gegen diese Infektionskrankheit hin:
La sobriété, la régularité et le choix des alimens sont trois circonstances de première
valeur dans le régime anti-cholérique.60
Gemäß seinem Grundsatz, auf jegliche Art der »Völlerei und Trunkenheit«
entschieden zu verzichten, empfahl er statt dessen die kontrollierte, regel-
mäßige Zuführung von leicht verdaulicher Kost. Beachtenswert sind zudem
seine Hinweise zur Auswahl der Getränke, neben leichten Weinen, z. B.
dem »Vin de Madère«, befürwortet er ausdrücklich Bier und Tee. Schließ-
lich finden sich bereits erste Vorschläge zur Schaffung eines gesunden
Raumklimas, indem Peschier nachdrücklich betonte, daß Feuchtigkeit in
den Mauern der Wohnräume zu eliminieren sei.
Bei bereits erkrankten Personen richtete Peschier seine Aufmerksamkeit ins-
besondere auf die Behandlung der als »eisig« empfundenen Kälte des ge-
samten Körpers und der Gliedmaßen – hervorgerufen durch das hohe Fie-
ber – mittels mehrmaligem Frottieren und Auflegen feuchtwarmer Tücher.
Nachhaltige Beachtung besitzt ferner sein Rat, der heute noch bei allen Ar-
ten der Diarrhö zur grundlegenden Therapieempfehlung zählt, um den
Flüssigkeitsverlust zu kompensieren:
On a aussi fait une infusion de thé Chine, ou de feuilles de menthe, de mélisse,
d’oranger, etc., dont on donne, de temps à autre au malade une tasse aussi chaude
qu’il la peut supporter; [...].61
58 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Deux (1832), S. 13.
59 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Deux (1832), S. 13.
60 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Instruction (1832), S. 2.
61 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Instruction (1832), S. 17.
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 155
Und er ergänzte:
On ne refusera pas au malade une cuillerée d’eau froide, lorsque les ardeurs de la soif
la lui feront demander.62
Zugleich veröffentlichte Peschier einen für Fachleute verfaßten Aufsatz zur
homöopathischen Therapie bei Typhus, in dem er die Empfehlungen
Hahnemanns übersetzte und durch eigene Beobachtungen ergänzte. Als
Mittel der Wahl bezeichnete er in der ersten Phase der Krankheit den
»Camphre«,
[...] une ou deux gouttes d’esprit-de-vin camphré (composé d’une partie de camphre
dissout dans douze parties d’alcool) sur un morceau de sucre, ou dans une cuillerée
d’eau.63
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
In einem späteren Stadium der Erkrankung sollten hingegen »dragées de
cuivre« (Cuprum), »huile de Caieput« (Oleum caieputi), »ellébore blanc«
(Veratrum album), »racine de Bryon« (Bryon) sowie »racine de Sumach«
(Rhus toxicodendron) verabreicht werden.64
Peschiers Publikation »Sur la Camomille« (Matricaria chamomilla) diente
einem besseren Verständnis der zahlreichen Anwendungsgebiete, in denen
diese ubiquitär verbreitete Pflanze in der Homöopathie Verwendung fin-
det.65
In einem öffentlichen Antwortschreiben Peschiers im Fédéral an einen ihm
bekannten, jedoch nicht namentlich genannten ehemaligen Schüler des Kli-
nikers im »Hôtel-Dieu« in Paris, Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-
1872),66 erwähnte er im Zusammenhang mit dem ablehnenden Bericht der
»Académie de Médecine« zur Errichtung eines homöopathischen Hospitals
in Paris die 1835 bereits bestehenden Institutionen in Bordeaux (verant-
wortlicher Leiter: Mabit), Thoissey (verantwortlicher Leiter: Gastier),
Vesoul (verantwortlicher Leiter: Bressand), Versailles sowie die homöopa-
thischen Abteilungen in den Hospitälern in Liège, Colmar und Altkirch.67
Außerdem präzisierte er, daß in einem homöopathischen Hospital keine
Apotheke im herkömmlichen Sinne, keine Drogenkammer und keine Räu-
me zur Herstellung von Teemischungen vorhanden seien, da den Patienten
lediglich reines oder gezuckertes Wasser verabreicht werde.68
Schließlich beklagte Peschier 1841 in einem offenen Brief an Charles-
Polydore Forget (1800-1861), Professor der klinischen Medizin an der Uni-
62 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Instruction (1832), S. 17.
63 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Application (1832), S. 69.
64 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Application (1832), S. 70-72.
65 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard: Sur (1833).
66 Zu Louis siehe Anm. 52.
67 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1835), S. 6.
68 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1835), S. 2.
Franz Steiner Verlag156 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
versität Straßburg,69 dessen Ignoranz, die dieser in einer Publikation über
Typhuserkrankungen gegenüber der Homöopathie – er bezeichnete diese
als »absurde« –, der deutschen Sprache und den deutschen Wissenschaft-
lern erkennen ließ und stellte ihm die provokative Frage:
Les célébrités allemandes n’ont-elles pas autant de valeur scientifique que les célébrités
françaises?70
Auf Grund der von Forget erwähnten zweiunddreißig Fallstudien zu dieser
Erkrankung vertrat Peschier die Auffassung, daß dieser, obwohl als Univer-
sitätsprofessor tätig, die beiden zentralen Anforderungen eines Arztes nicht
erfülle, nämlich
la justesse du diagnostic et celle du pronostic71,
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
ein Umstand, der für die Patienten folgenschwere Auswirkungen verursa-
chen könne.
Demgegenüber beurteilte Peschier die medizinische Versorgung der Bevöl-
kerung in Genf seit der Einführung der Homöopathie als deutlich verbes-
sert:
[...] la thérapeutique des médecins allopathes s’est singulièrement modifiée; ils ont
donné, en masse et en nombre, beaucoup moins de médicaments; et le nombre des
décès des affections dites malignes a notablement diminué; il y a maintenant beau-
coup plus de chances que jadis de vivre pour les personnes atteintes d’affection ty-
phoïdes.72
Zum Zwecke eines intensiveren Erfahrungs- und Gedankenaustausches, zur
Entwicklung gemeinsamer Strategien und zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit der Homöopathen im gesamten französischen Sprachraum be-
mühte sich Peschier um die Gründung einer wissenschaftlichen Gesell-
schaft. Diese als »Société homoeopathique Gallicane« bezeichnete Vereini-
gung – gleichfalls die erste im französischen Sprachraum – wurde am 6.
September 1832 in Genf »chez le docteur Dufresne« ins Leben gerufen
(Abb. 6)73, allerdings in Peschiers Abwesenheit, der zu dieser Zeit in
Deutschland weilte. Definitiv konstituierte sich die Gesellschaft auf der fol-
genden Jahresversammlung, die unter dem Präsidium von Des Guidi in
Lyon vom »6 au 8 septembre 1833 dans une salle de Collège royal« durch-
geführt wurde. Auf dieser Tagung wurde Peschier zum Sekretär gewählt,
69 Zu Forget siehe Anm. 53.
70 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1841), S. 4.
71 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1841), S. 9.
72 Vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1841), S. 19f.
73 Vgl. S. N.: Société (1833).
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 157
dessen Aufgaben in Artikel 23 des »Règlement de la Société homoeopa-
thique Gallicane« festgeschrieben waren.74
Um die Kontakte der einzelnen Mitglieder zu verbessern, wurde in Lyon
beschlossen, lokale Sektionen der »Société homoeopathique Gallicane«, die
zukünftig als Dachverband fungieren sollte, zu bilden. Für die »Région du
Léman«75 entstand bereits am 16. November 1833 »chez le docteur Dufres-
ne« die »Société homoeopathique Lémanienne«, in der Peschier gleichfalls
als Sekretär wirkte.76 Die Mitglieder trafen sich alle drei Monate zu Ver-
sammlungen.77 Auf Grund dieser Vereinstätigkeit sowie seiner umfangrei-
chen redaktionellen Arbeit stand Peschier nicht nur in Kontakt zu Homöo-
pathen aus der engeren Heimat, unter ihnen Chuit aus Genève, Convers
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
aus Vevey, Laville de la Plaigne aus Dijon, Claris aus Thônex, Muret aus
Morges, Bégoz und Charles Saladin, sondern insbesondere auch zu Fach-
genossen aus Deutschland, unter ihnen Carl Georg Christian Hartlaub
(1795-1839) aus Braunschweig,78 Georg Adolf Weber aus
Lich/Oberhessen, Clemens Franz Maria von Boenninghausen (1785-
79
1864) aus Münster,80 Julius Lobethal (1810-1874) aus Breslau81 und Gott-
lieb Heinrich Georg Jahr (1800-1875) aus Köthen (später Paris).82
Über Peschiers Tätigkeit nach 1842 ist nur wenig bekannt; allerdings kann
vermutet werden, daß er weiterhin als Homöopath wirkte, wie einem Brief
74 Vgl. S. N.: Règlement (1833). Als weitere Jahresversammlungen sind nachgewiesen
die »Réunion à Genève le 15 au 17 septembre 1834« sowie die »Réunion à Paris le
15-18 septembre 1835«; vgl. Peschier, Charles-Gaspard (1834). Auf der Versammlung
in Genf 1834 gab Peschier überdies bekannt, daß er Hahnemann am 12. Mai 1834
das »Diplôme unique de membre d’honneur de la Société Gallicane« zugeschickt hat-
te, wofür sich dieser in einem in französischer Sprache verfaßten Schreiben vom 6.
Februar 1835 herzlich bedankte; vgl. Hahnemann (1835).
75 Mit »Région du Léman« wird das Gebiet bezeichnet, das den »Lac Léman« oder Gen-
fer See umgibt (Genève, le Vaud, la Savoie) sowie die angrenzenden französischen
Gebiete.
76 Für 1834 läßt sich die Gründung der »Société homoeopathique dans la Côte-d’Or«
nachweisen.
77 Für 1834 ließen sich die folgenden Versammlungen belegen:
»Réunion le 15 fevrier 1834 chez le docteur Peschier avec 10 personnes«
»Réunion le 15 mai 1834 chez M. Chuit, à Genève«
»Réunion le 15 août 1834«
»Réunion le 15 novembre 1834 chez le docteur Peschier (secrétaire)«.
78 Vgl. Tischner (1939), S. 780.
79 Vgl. Tischner (1939), S. 804.
80 Vgl. Tischner (1939), S. 499.
81 Vgl. Tischner (1939), S. 788.
82 Vgl. Tischner (1939), S. 499f.
Franz Steiner Verlag158 Karl-Rudolf Reichenbach, Christoph Friedrich
von 1850 an Jean Marie Placide Munaret (1805-?),83 der in Châtillon de
Michaille près de Lyon als Arzt praktizierte, zu entnehmen ist (Abb. 7).
Darin beklagte sich Peschier, daß auf dem Gebiet der Medizin mit Aus-
nahme der Homöopathie, die Munaret allerdings – ohne diese zu kennen
und vor allem ohne entsprechende praktische Erfahrung – verspottete, seit
längerer Zeit nichts Neues zu berichten wäre. Erneut verwies Peschier auf
die Vorzüge der homöopathischen Heilmittellehre, die eine schnellere und
schonendere Heilung ermöglichen sollte. Außerdem bemerkte er, daß es
ihm gelungen sei, auch bei schweren Fällen von Lungenentzündungen oder
Typhuserkrankungen Todesfälle zu vermeiden:
A preuve, je vous affirme que depuis l’an 1832 où j’ai commencé à pratiquer la mé-
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
thode d’Hahnemann, je n’ai pas perdu un malade atteint de fluxion de poitrine, où de
typhus quelle qu’ait été la gravité de la maladie.84
Von 1848 bis zu seinem Tod 1853 wirkte Peschier als Kapitelspräfekt des
Bezirkes Genf des »Ordre intérieur«.85 Leider besaß Peschier keine Mög-
lichkeit, die Homöopathie an der »Académie de Calvin« zu institutionali-
sieren, da die »Faculté de médecine« an der nachmaligen »Université de
Genève« erst 1876 errichtet wurde (Abb. 8). Charles-Gaspard Peschier ver-
starb am 21. Mai 1853 in seiner Vaterstadt Genf an Wassersucht.86
Tabelle: Publikationen von Charles-Gaspard Peschier
1. Sur les maladies des enfants. Dissertation Paris 1809.
2. Sur le traitement de la pneumonie et la pleurésie avec le tartre émétique à haute dose. Genève 1822.
3. Lettre adressée aux Rédacteurs sur un nouveau moyen de tuer le Ténia vulgaire. In: Bibliothèque
Universelle 30 (1825), 205-209.
4. Lettre sur l’emploi du coton comme charpie. Genève 1831.
5. Notices et documens sur le choléra, extraits de communications particulières et de journaux étran-
gèrs. Genève 1831.
6. Application de l’Homoeopathie au traitement du choléra spasmodique ou asiatique. In: Bibliothèque
homoeopathique 1 (1832), 66-73.
7. Préparation, conservation et dispensation des remèdes homoeopathiques. In: Bibliothèque homoeo-
pathique 1 (1832), 85-100.
8. Tableau comparatif des symptomes qu’à offert le choléra, et de ceux que produisent les médica-
ments que lui ont opposé, avec succès. In: Bibliothèque homoeopathique 1 (1832), 183-194.
r
9. Lettre du D Peschier. A MM les rédacteurs. In: Bibliothèque homoeopathique 1 (1832), 247f.
10. Correspondance. Réunion des médecins homoeopathes a Leipzig. Extrait d’une lettre du docteur
Peschier aux Rédacteurs de la Bibliothèque homoeopathique, écrite de Coethen, en date du 16 août
1832. In: Bibliothèque homoeopathique 1 (1832), 308-317.
11. Deux mots au public sur l’homoeopathie. Genève 1832.
83 Obwohl Munaret als ein Vertreter der allopathischen Richtung galt, pflegten die bei-
den Kollegen eine freundschaftliche, über Jahrzehnte bestehende Beziehung, wie ein
Brief von Peschier an Munaret vom 30. Oktober 1833 dokumentiert; vgl. Biblio-
thèque de l’Académie nationale de Médecine, Paris; Lettre Peschier, ms 186, folio
248f.
84 Vgl. Bibliothèque de l’Académie nationale de Médecine, Paris; Lettre Peschier, ms
186, f. 250 recto/verso.
85 Vgl. Ruchon (1935), S. 289.
86 Vgl. Haag/Haag (1846), S. 203.
Franz Steiner VerlagCharles-Gaspard Peschier 159
12. Instruction succincte pour le traitement homéopathique, préservatif et curatif du choléra. Genève
1832.
13. Eclaircissemens sur l’homoeopathie. Genève 1832.
14. Visite à Hahnemann. Genève 1832.
r e
15. Du soufre, par le D [Carl Georg Christian] Hartlaub (Ann. Hom. Klein. 3 B. p. 253), avec des re-
r
marques du D Peschier. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 1-41.
16. Melanges. Quelques mots sur la nouvelle doctrine médicale, nommée homoeopathie; par le docteur
Muret, de Morges. Br. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 78-80.
17. Melanges. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 163f.
18. Sur la camomille. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 165-195.
Sur la camomille. Genève 1833.
19. Sur la belladone. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 269-292, 450-466 et 3 (1834), 70-107.
20. Melanges. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 402-404.
21. Annonces. Melanges. In: Bibliothèque homoeopathique 2 (1833), 477-484.
r
22. Troisième lettre du D Peschier. Visite à Dessau, Berlin, Dresde, Munich et la Suisse. Genève 1833.
Open Access Download von der Verlag Österreich eLibrary am 07.06.2022 um 08:06 Uhr
23. Weber, [Georg Adolf]: Exposition systématique des effets pathogénétiques purs de tous les remèdes
mis jusqu’à ce jour en experience. Traduite de l’allemand et publiée par le docteur Peschier. 3 t. en 2
vol. Genève 1833-1842.
24. [Mit Boenninghausen, Clemens Franz Maria von] Tableaux des modifications qu’apportent aux effets
des remèdes homoeopathiques diverses circonstances de leur administration, suivis de leur action
r
sur l’état moral des sujets. Traduits et publiés sur la seconde édition par le D Ch. Peschier. Ge-
nève/Paris 1834.
25. Annonces. In: Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 53-57.
26. Homoeopathie vétérinaire. In: Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 120-127, 179-181, 246-253,
314-318, 4 (1834), 112-120 et 4 (1835), 298-300.
27. Observation communiquée à la Société homoeopathique lémanienne, dans sa séance du 15 mai. In:
Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 147-156.
28. Annonces. In: Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 187f.
29. Isopathie. In: Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 271-281, 363-373, 4 (1834), 22 et 4 (1835),
291-298.
30. Observation pratique. In: Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 300-305.
31. Observations pratiques (Extraites de l’Allgem. homoeop. Zeitung). In: Bibliothèque homoeopathique 3
(1834), 305-309 et 4 (1834), 23-34.
32. Faits pratiques consignés par le docteur Attomyr dans ses lettres sur l’homoeopathie. In: Bibliothèque
homoeopathique 3 (1834), 310-314.
33. Observation pratique communiquée par le docteur Peschier à la Société homoeopathique Léma-
nienne, le 15 août 1834. In: Bibliothèque homoeopathique 3 (1834), 374-380.
34. Société homoeopathique Lémanienne, séance du 15 août. In: Bibliothèque homoeopathique 4
(1834), 1-4.
35. Société homoeopathique Gallicane. Session de 1834. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1834), 34-
45.
36. Annonces. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1834), 126-128.
37. Allocution et observations communiquées à la Société homoeopathique Gallicane, le 16 septembre
1834. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1834), 129-152.
38. Société Lémanienne. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 248-255.
39. Sur le saccharum lactis. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 273-280.
40. Remèdes tirés ou à tirer du règne animal. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 280-290.
41. [Doin et Laburthe]: Du suc de persil dans le traitement de l’uréthrite aiguë ou chronique, suivi de
quelques autres applications des remèdes homoeopathiques à la guérison des maladies syphili-
tiques. Paris/Genève 1835. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 304-310.
42. Annonces. Mélanges. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 313-319.
43. De la Prosopalgie. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 345-355.
44. Société homoeopatique Lémanienne. In: Bibliothèque homoeopathique 4 (1835), 378-382.
45. Observations pratiques. In: Bibliothèque homoeopathique 5 (1835), 217-243 et 6 (1836), 266-284.
46. Prospectus. Genève 1835.
47. Lettre sur l’homoeopathie, adressée aux rédacteurs du Fédéral. Genève 1835.
48. Observations sur le jugement que porte le Fédéral sur l’homoeopathie. Genève 1835.
49. Statistique de l’homoeopathie. Genève 1835.
50. Société homoeopathique Gallicane. Session Parisienne. 15-18 septembre 1835. In: Bibliothèque
homoeopathique 6 (1836), 1-28.
51. Mélanges. In: Bibliothèque homoeopathique 6 (1836), 115-119.
Franz Steiner VerlagSie können auch lesen