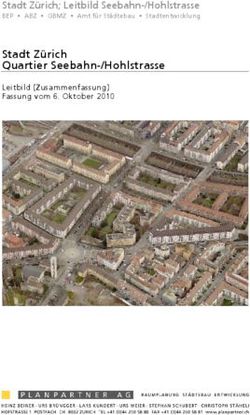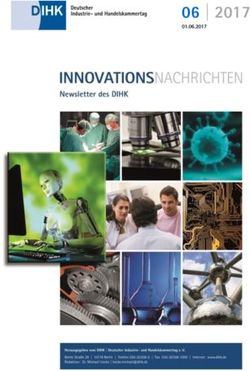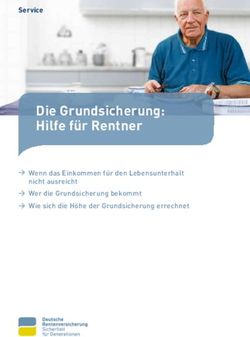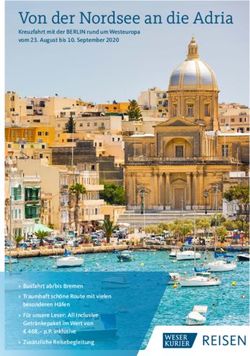Valentin Magaro 2017 Mit einem Text von Nicole Seeberger
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2017 In der Dezember-Ausstellung 2017 ist Valentin Magaro in der Kunsthalle Winterthur mit einer mehrteiligen Serie zum Motiv der „Schutzmantelmadonna“ vertreten. Dem Motiv aus dem christlich- religiösen Kontext galt u.a. im letzten Jahr ein Grossteil seiner Aufmerksamkeit. Der schützende Mantel Mariä breitet sich im übertragenen Sinn über das Jahr 2017 aus und beherbergt darunter eine Welt prallgefüllt mit Leben. Von Museumsbesuchenden und Radfahrenden, von Stürzenden, Gehenden, Lesenden, alle haben ihren Platz, Hunde, Katzen, Haushühner, Spinnen, exotische Tiere, Fabelwesen und andere Kreaturen ebenso. Sie alle tummeln sich in dieser Welt, die uns Magaro aus verschiedensten Perspektiven sichtbar macht. Der Künstler stösst bereits 2008 bei Recherchen zur Gotik auf die plastische Darstellung einer Schutz- mantelmadonna und beginnt sich für diesen besonderen Typus zu interessieren. Er legt sich eine Abb. 1 grössere Bildersammlung an, die ihm als Grundlage und Inspirationsquelle für seine eigenen Motive dient. In den 28 Zeichnungen begegnen wir, beeinflusst aus verschiedenen Epochen, Darstellungsarten der Schutzmantelmadonna aus Magaros Hand. Erst posiert die Madonna im klassischen Kontrapost mit ihrem bis zu den Füssen reichenden Mantel ohne die Schutzsuchenden (Abb. 1). Dabei interessiert Magaro vor allem der reiche Faltenwurf ihres Überhanges, den er von Zeichnung zu Zeichnung mehr ausarbeitet, bis er den Raum unter ihrem Mantel beginnt auszustatten und mit Leben zu füllen. Erst später erscheint sie in den uns bekannten und überlieferten Darstellungen mit den Schutzsuchenden unter ihrem namensgebenden Umhang. Eine der wohl bekanntesten Darstellungen einer Schutzmantelmadonna ist jene plastisch ausgeführte Arbeit vom Ulmer Bildhauer Michel Erhart (ca. 1440–nach 1522) von 1480 (Abb. 2). Sie stammt ursprünglich aus der Liebfrauenkirche in Ravensburg und wird deshalb als „Ravensburger Schutzmantel- madonna“ bezeichnet. Heute ist diese spätmittelalterliche Skulptur im Bode-Museum in Berlin zu bestaunen. Unter ihrem ausgebreiteten Mantel beherbergt Maria zehn schutzbedürftige Gläubige. In der bildenden Kunst ist der Typus der Schutzmantelmadonna seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Besonders im 13. und 14. Jahrhundert erfährt dieser Bildtypus grössere Beliebtheit. In den Anfängen existiert noch kein einheitlicher Typus der Darstellung.1 So zeigt eine sehr früh bekannte, in der byzanti- nischen Tradition gemalte Darstellung um 1280 von Ducciò di Buoninsegna (ca. 1255–1319) aus Siena eine sitzende Madonna mit dem Jesuskind in ihrem linken Arm, die nur an ihrer rechten Seite unter ihrem Mantel drei schutzsuchende Franziskaner Mönche empfängt (Abb. 3). Allgemein lassen sich jedoch zwei typische Darstellungen unterscheiden, die sich in dieser Zeit herausgebildet haben: Maria mit und Maria ohne Kind. Abb. 2
Aus theologischer Sicht ist das Kind wichtiger als seine Mutter, daher wird in diesem Kontext vermieden, sie ohne Jesuskind wiederzugeben. Innerhalb der Manteldarstellungen ohne Kind gibt es nochmals zwei Unterscheidungen, entweder Maria hält ihre Hände betend zusammengefaltet oder sie hält den Mantelsaum mit weit ausgestreckten Armen zum Schutz geöffnet (Abb. 4). In der ersten Variante wird es stilistisch oft so gelöst, dass der Mantel der betenden Maria von Engeln oder anderen Helferinnen und Helfern offen gehalten wird. Die Variante des Arme-Ausbreitens gilt als die ursprünglichste Version. In den Dastellungen ohne Christkind wird Maria als „Mater omnium“ (aller Mutter) verstanden, als Beschützerin der Menschen, als Fürbitterin der Menschen beim himmlischen Gericht.2 Die vom Mantel Mariä beschützten Menschengruppen können je nach Entstehungsort und Anlass Einzelpersonen, Familien oder andere Gruppierungen sein. Der Mantel gilt als „unverletzlich“ und „undurchdringlich“, er schützt vor Witterung, vor Gewalt oder vor Krankheiten wie der Pest: Maria breit den Mantel aus, Abb. 3 mach Schirm und Schild für uns daraus, lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte.3 Das Motiv der Maria als Mantelschützerin hat sich durch die Marienverehrung in den ersten christlichen Jahrhunderten heraus gebildet. Ab Anfang des 13. Jahrhunderts werden die Kirchen der Zisterzienser der Maria geweiht, nach und nach ging diese Verehrung auch auf andere Orden über. Wohlgemerkt, Ma- ria als Mantelschützerin steht in der christlichen Ikonographie nicht alleine da. Seit dem 14. Jahrhundert sind auch Mantelbilder von Christus und Gottvater, von Ordensstiftern, Patronen von Bruderschaften, Städten oder anderen Gemeinschaften überliefert. Den Mantel als Symbol des Schutzes zu verwen- den, gilt freilich als die natürlichste Sache der Welt. In etlichen Sagen, Märchen oder Legenden hat der Mantel eine schützende Funktion vor verschiedensten Einflüssen (Abb. 5). Das Kleidungsstück spendet Wärme, verdeckt oder verhüllt. Symbolisch steht der Mantel für die menschliche Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit. „Jedenfalls ist die Gebärde des Schützens respektive des Schutzsuchens fast immer verbunden mit einem Bedecken respektive Bedecktwerdens. Überall liegt das gleiche Gefühl zugrunde, das letztlich auch die Entstehung der Schutzmantelsitten und der Schutzmantelbilder herbeiführte.“4 In diesem Zusammenhang wird in verschiedenen historischen Abhandlungen zum Begriff auch vom „unter den Arm nehmen“ gesprochen. Dieser Ausdruck verkörpert jedoch das Gleiche wie „unter den Mantel nehmen“. Abb. 4
Ursprünglich liegen die Wurzeln für das Motiv des schützenden Mantels im juristischen Bereich. So ist vor allem bei zwei Ereignissen vom Mantelschutz gesprochen worden: bei der Eheschliessung und der Adoption von Kindern. Vera Sussmann führt aus, dass beispielsweise bei den russischen Juden der Bräutigam die Braut unter den Mantel nehme, zum Zeichen des Schutzes, und die „filii mantelati“, die zur Adoption (und öffentlichen Legitimierung) unter den Mantel des Vaters genommenen Kinder, seien im französischen, englischen und nordischen Recht bekannt. Im urgermanischen Recht sei die Trauung als Hingabe der Braut in Adoption aufgefasst und unter anderen Adoptionsgebräuchen das Umfangen mit dem Mantel geübt worden.5 In Zusammenhang mit gerichtlich Verfolgten wird ebenfalls vom „Mantelschutz“ respektive „Mantelrecht“ gesprochen. Dieser Schutz ist im Mittelalter vor allem von Frauen ausgeübt worden: „Das mittelalterliche Recht, welches nur Extreme und absolut geltende Strafen kannte, brauchte in der Praxis Abstufungen der Strafen, welche durch das so genannte Gnadenbitten oder Fürsprechen veranlasst wurden. Die Sitte bestand darin, dass hochgestellte, angesehene Personen oder Verwandte des Strafbaren oder der Henker selbst für denselben baten, und zwar entweder vor Verkündigung des Urteils, sodass auf die gesetzliche Strafe garnicht erkannt wurde, oder nach Verkündigung des Urteils, um die Begnadigung Abb. 5 herbeizurufen. Es ist nun klar, dass derjenige am meisten um seinen Fürspruch angegangen wurde, der die meiste Aussicht auf Erfolg hatte, und das waren einerseits Fürsten, andrerseits die Frauen. Unter den Frauen, wenn sie nicht auch gerade durch ihre Stellung hervorragten, schrieb man den reinen Jung- frauen und den schwangeren Frauen besondere Schutzkräfte und –rechte zu. Und wie die Frauen als Fürsprecherinnen besondere Macht besassen, so genossen sie auch ein besonderes Mantelschutzrecht. Wer ihre Hand oder ihren Busen berührte oder unter ihren Mantel oder auch Schleier flüchtete, war vor dem Verfolger sicher.“6 Da nun Afterding sach, wi iz zu fur, do floch her undir den Mantil der edlen landgrafin, frowen Sophien, durch schutzes willen, den er da vant.7 Wir werden tagtäglich auf verschiedensten medialen Kanälen mit Bildern von Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen, mit Asyl und Schutz suchenden Menschen konfrontiert. Mit der Flüchtlingsthematik ist der Mantelschutz der Maria als „Mutter der Zuflucht“ aktueller denn je. In Zusammenhang mit der humanitären Hilfe ist es die Funktion und vor allem Aufgabe der Staaten geworden, Verfolgten Schutz und Sicherheit, Mantelrecht zu geben. Für viele ist der schützende staatliche Mantel die Rettung vor dem sicheren Tod. Magaros Umgang mit dem Schutzmantelmadonna-Motiv ist ein Desiderat aus den letzten Jahrhunderten, eine zeitgenössische Interpretation der Maria, die verschiedenste Assoziationen wach ruft: Sister Act- Schwester, Miss Fury, Superwoman, Catwoman und wie die weiblichen Heldinnen aus der Hoch- und Populärkultur alle heissen mögen. Ihren Mantel bereitet sie im urbanen Umfeld über ihre Schützlinge aus. Innerhalb ihres Mantels findet das pralle Leben statt, ausserhalb wartet der Tod (Abb. 6) Abb. 6
Der Mantel als Abgrenzung und Eingrenzung spielt dabei auch eine wichtige Rolle in formaler, gestalterischer Hinsicht. Immer wieder setzt der Künstler einen Rahmen um seine Bildräume, auch zu beobachten in der Serie der „Mantelschutzmadonna“. Die Begrenzung des Mantels zwischen Innen und Aussen wiederholt sich in der eigentlichen Begrenzung des Bildraumes. Vom Rahmen des Mantels zum Rahmen des Bildes werden illusionistische Bühnenräume geschaffen, in denen sich die Geschichten abspielen. Die Begrenzung des Bildraumes oder auch des Bildausschnittes ist ein wichtiger gestalterischer Schritt und von grosser Bedeutung für den Künstler: „Inhaltlich bedeutet dies vielleicht, dass meine imaginierte, manchmal ausufernde Welt so im Zaum gehalten wird. Denn auch wenn in meinen Arbeiten oft ein Durcheinander oder eine Fülle von Dingen zu sehen ist, so schafft eine trennende Linie am Bildrand immer auch eine Art Zaun, welche Ruhe bringt.“8 Auch der Mantel der Maria stiftet Ruhe und gibt Schutz. Auch deshalb mag der Bildtypus der Schutzmantelmadonna den Künstler beeindrucken. Nicole Seeberger, April 2018 1 Folgende Ausführungen basieren auf Vera Sussmann, Maria mit dem Schutzmantel, Marburg 1929. 2 Vgl. auch https://charismatismus.wordpress.com/2013/10/02/geschichte-symbolik-und-bedeutung- der-schutzmantel-madonna/ (Stand: 17.03.2018). 3 1. Strophe aus „Maria, breit den Mantel aus“, in: Gesangsbuch Gotteslob alt 595/neu 534. 4 Vera Sussmann, Maria mit dem Schutzmantel, Marburg 1929, S. 3. 5 Ebd. 6 Ebd., S. 4. 7 Sage vom Sängerkrieg auf der Wartburg, Grimm, Wörterbuch VI, 1608, S. 2. Zitat in Sussmann 1929, S. 4. 8 Valentin Magaro in Korrespondenz mit der Autorin, 18. März 2018. Abb. 1: Valentin Magaro, aus der Serie Schutzmantelmadonnen, Bleistift auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2017 Abb. 2: Michael Erhart (ca. 1440–nach 1522), Ravensburger Schutzmantelmadonna, Lindenholz gefasst, 1480, Bode-Museum, Berlin Abb. 3: Duccio di Buoninsegna (um 1255–1319), Madonna der Franziskaner, Tempera auf Holz, 23.5 x 16 cm, um 1300, Pinacoteca Nationale, Siena Abb. 4: Unbekannter Künstler, Fresko, um 1000, Kapelle Sogn Gieri bei Rhäzüns Abb. 5: Henry Justice Ford (1860–1941), Illustration zum Märchen „Allerleirauh“, 1892 Abb. 6: Valentin Magaro, aus der Serie Schutzmantelmadonnen, Acryl und Tusche auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2017
Ausstellungssituation, «Werkschau Thurgau 2016», Galerie widmertheodoridis, Eschlikon, 2016 (Foto: Jordanis Theodoridis)
Ausstellungssituation, «Werkschau Thurgau 2016», Galerie widmertheodoridis, Eschlikon, 2016 (Foto: Caroline Minjolle)
Ausstellungssituation, «Year of the Rooster» Ausstellungssituation, «Valentin Magaro / Patrick Graf» Peter Stohlers Roentgenraum, Zürich, 2017 On.Off Ausstellungsraum, Winterthur, 2016 (Fotos Patrick Graf)
Acryl, Bleistift, Tusche und Filzstift auf Papier/Collage, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Bleistift, Tusche und Filzstift auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Bleistift, Tusche und Filzstift auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Bleistift auf Papier, 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Popup, flach: 21 x 29.7 cm, 2017 Pop-up, flach: 21 x 29.7 cm, 2017
Pop-up, flach: 29.7 x 21 cm, 2017
Pop-up, flach: 29.7 x 21 cm, 2017
Pop-up, flach: 29.7 x 21 cm, 2017
Pop-up, flach: 29.7 x 21 cm, 2017
Tusche auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2017 Acryl und Tusche auf Papier/Collage, 42 x 59 cm, 2017 Bleistift, Filzstift und Tusche auf Papier/Collage, 59 x 42 cm, 2017
Bleistift, Acryl, Filzstift und Tusche auf Papier, je 42 x 59 cm, 2017 Bleistift und Tusche auf Papier, 86 x 70 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier/Collage, je 59 x 42 cm, 2017
Lithographie auf Japanpapier, 82 x 66 cm, 2017, Auflage: 20 Stück (und 5 EA) (Druck: Thomi Wolfensberger, Zürich)
Bleistift, Tusche und Filzstift auf Papier/Collage, 59 x 42 cm, 2017 Bleistift und Tusche auf Papier, 59 x 42 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, je 59 x 42 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Buntstift und Tusche auf Papier/Collage, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier/Collage, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 59 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, 59 x 42 cm, 2017 Bleistift auf Papier, je 42 x 59 cm, 2017
Bleistift, Acryl und Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 59 cm, 2017
Bleistift, Acryl und Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 29.5 cm, 2017
Bleistift und Filzstift auf Papier, 59 x 42 cm, 2017 Bleistift auf Papier, 42 x 29.7 cm, 2017
Bleistift auf Papier, je 42 x 29.7 cm, 2017 Tusche, Acryl und Buntstift auf Papier, 42 x 29.7 cm, 2017
Acryl auf Holz, 140 x 200 cm, 2018
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Ausstellungssituation, «Arbeiten auf Papier», Galerie Bleisch, Arbon, 2017
Ausstellungssituation, «Arbeiten auf Papier», Galerie Bleisch, Arbon, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Bleistift, Acryl und Tusche auf Papier/Collage, je 42 x 59 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier/Collage, 42 x 59 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Ausstellungssituation, «Remis:Minecraft», Raiffeisen Kunstforum, Winterthur, 2017 Ausstellungssituation, «Effort. Encore. Da Capo», Galerie Bleisch, Arbon, 2017 (Foto: Adrian Bleisch)
Ausstellungssituation, «Dezemberausstellung», Kunsthalle, Winterthur, 2017 Ausstellungssituation, «Neues aus der Zwischenwelt», Willi-Sitte-Stiftung, Merseburg, 2017Pigmente und Acrylbinder auf Papier, je 42 x 29.5 cm, 2017
Acryl und Tusche auf Papier, 59 x 42 und 42 x 59 cm, 2017
Bleistift, Filzstift, Acryl und Tusche auf Papier/Collage, je 59 x 42 cm, 2017
Acryl, Farbstift, Bleistift, Tusche und Klebepunkte auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Bleistift auf Papier, 42 x 29.5, 2017 Acryl und Tusche auf Papier, 42 x 29.5, 2017
Jahreskarte der Steindruckerei Wolfensberger und der J. E. Wolfensberger AG, Lithografie, signiert aber nicht nummeriert in einer Auflage von 700 Stück, 2017
Acryl, Farbstift, Bleistift und Tusche auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl, Bleistift, Tusche und auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl, und Tusche auf Papier, 29.5 x 42 cm, 2017
Bleistift auf Papier, 29.7 x 42, 2017 Bleistift und Tusche auf Papier, 42 x 29.5, 2017
Acryl, Farbstift und Tusche auf Papier, 42 x 29.5, 2017
Acryl, Bleistift und Tusche auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl, Farbstift, Bleistift und Tusche auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017
Acryl, Filzstift, Bleistift auf Papier, je 29.5 x 42 cm, 2017 Bleistift auf Papier, 42 x 29.5 cm, 2017
Valentin Magaro (1972 in Münstleringen) www.valentinmagaro.ch Auszeichnungen
2012 Förderbeitrag des Kantons Thurgau
Ausbildung 2012 Artist-in-Residence des Artkapital Verlages, Berlin
1992–1996 Wissenschaftliches Zeichnen an der Schule für Gestaltung Zürich 2010 Förderpreis der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK)
2008 Förderbeitrag der UBS Kulturstiftung
Einzelausstellungen (Auswahl) 2007 Adolf-Dietrich-Förderpreis der Thurgauischen Kunstgesellschaft
2018 «die teestunde», Galerie Sam Scherrer, Zürich
Unterstützungsbeiträge
2017 «Neues aus der Zwischenwelt», Willi-Sitte-Stiftung, Merseburg
Kulturstiftung des Kantons Thurgau
«Arbeiten auf Papier», Galerie Bleisch, Arbon
Steo-Stiftung, Zürich
2016 Willi-Sitte-Stiftung, Merseburg Cassinelli-Vogel-Stiftung
2015 Museum Rosenegg, Kreuzlingen Kulturstiftung Winterthur
2013 Pavillion am Milchhof, Berlin Georges-und-Jenny-Bloch-Stiftung
2012 «zwei Ausstellungen», Peter Bichsel Fine Books, Galerie Puechredon, Zürich Stadt Winterthur
2011 «l’entrée» (mit Gabriella Hohendahl), Kunstkasten, Winterthur Kulturstiftung Ottoberg
bergmanberglind contemporary art, Luxembourg TKB-Jubiläumsstiftung
2010 MARCdePUECHREDON, Basel
2009 Kunsthalle Winterthur Sammlungen
2008 KFA-Gallery, Berlin Kunstmuseum Winterthur
Kunstmuseum Thurgau
2007 Kunstraum Kreuzlingen
Kunstsammlung Roche, Basel
Galerie Krethlow, Bern Credit Suisse Kunstsammlung
2006 «Gebaute Fiktion», Schmidt Galerie, Berlin Johann Jacob Rieter-Stiftung
White Space (Projektraum), Zürich Swisscom Kunstsammlung, Zürich
2005 Galerie Krethlow, Bern Kantonsspital St. Gallen
2003 Galerie Krethlow, Bern Stadt Winterthur
Kanton Zürich
Gruppenausstellungen (Auswahl) Stadt Zürich
2017 «Impression», Kunsthaus, Grenchen Stadt Kreuzlingen
2016 «Face to Face», Kunstzeughaus, Rapperswil Sammlung Carola und Günther Ketterer Ertle
«Someone’s got to dance», Stadtgalerie, Bern Kunstsammlung ARTbon, Arbon
Müller und Schuhmacher Treuhand, Winterthur
2015 «Mit durchaus zeitgemässem Charakter», Kunstmuseum Olten
First Alliance Trust & Advisory Ltd, Zürich
«30 Jahre A.-Dietrich-Förderpreis», Kunstraum Kreuzlingen
RehaSuisse, Längenbold
«CH-Variationen», Kunstmuseum Winterthur
2014 «Neue Kollektion», Kunstmuseum Thurgau, Warth Publikationen (Auswahl)
2013 «Impression National», Kunsthaus Grenchen «Jahrbuch Winterthur, 2018»
«Werkschau Thurgau», neuer Shed, Frauenfeld «Mit durchaus zeitgemässem Charakter», Kunstmuseum Olten, 2015
2012 SingenKunst 2012, Kunstmuseum Singen Katalog, Dezember-Ausstellung: Focus, Kunstmuseum Winterthur, 2012
2011 «HOTSPOT BERLIN», Georg Kolbe Museum, Berlin Ausstellungskatalog, SingenKunst_2012, Kunstmuseum Singen, 2012
Dezember-Ausstellung, Kunstmuseum Winterthur OVRA ARCHIVES, 02 EDITION_VALENTIN MAGARO, 2011
2010 K10 – aktuelles Zürcher Kunstschaffen, Kunsträume oxyd, Winterthur Katalog der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) Förderpreise, 2010
2009 «Heimspiel», Kunstmuseum St.Gallen «Ortungen», Visarte Zürich präsentiert K10, Ausstellungskatalog, 2010
2007 «DESSIN-MOI UN MOUTON!», Kunstmuseum Thurgau «Valentin Magaro», Monografische Publikation (Arnoldsche), 2009
2006 Kunsthalle Winterthur «Radar», (Arnoldsche), 2007
«DESSIN-MOI UN MOUTON!», Ausstellungskatalog, Kunstmuseum Thurgau, 2007
Dezember-Ausstellung, Kunstmuseum Winterthur
«Reiz und Risiko», (Arnoldsche), 2006
«On the Road again ...», Haus für Kunst Uri, Altdorf
«Seedamm-Kultur-Bulletin», 2006
«Vom Schweifen der Linien», Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon «Kunst im Un-Privaten», (Edition Fink), 2004
2005 Dezember-Ausstellung, Kunstmuseum Winterthur
«HANDLUGGAGE 2005», Cafe Gallery Projects, LondonImpressum: In regelmässigen Abständen erscheinen Künstlerbücher von Valentin Magaro in limitierter Auflage. Die Bücher sind nummeriert und signiert und enthalten eine eingebundene Originalzeichnung oder Originalgrafik. Ziel die- ser Publikationen ist die fortlaufende Aufarbeitung der künstlerischen Arbeit. Bereits in dieser Reihe erschienen sind folgende Künstlerbücher: 2017 mit einem Text von Penelope Tunstall, Kunsthistorikerin, Zürich 2014/15 mit einem Text von Christin Müller-Wenzel, Kunstwissenschaftlerin, Halle (Saale) 2013 mit einem Text von Rudolf Velhagen, Kunsthistoriker, Zürich 2012 mit einem Text von Corinne Schatz, Kunsthistorikerin, St. Gallen 2011 mit einem Text von Paulina Szczesniak, Kunstkritikerin, Zürich 2010 mit einem Text von Richard Grayson, Kurator/Autor/Künstler, London 2009 mit einem Text von Dieter Schwarz, Direktor des Kunstmuseums Winterthur, Zürich 2008 mit einem Text von Dominique von Burg, Kunstkritikerin Zürich 2007 Interview mit Ralf Christofori, Kunstkritiker, Stuttgart 2005/06 mit einem Text von Peter Killer, Kunstkritiker, Olten 2004 mit einem Text von Isabella Jungo, Kunsthistorikerin, Bern 2003 mit einem Text von Michael Krethlow, Kunsthistoriker und Galerist, Bern 2000–2002 mit einem Text von Lucia Cavegn, Kunsthistorikerin, Winterthur 1995–1999 mit einem Text von Norberto Gramaccini, Professor für Kunstgeschichte, Bern Dank an: Autorin: Nicole Seeberger, Chur Buchbinderei Heggli, Winterthur Fotos: Michael Lio, Winterthur Druck: Rohner + Spiller AG, Winterthur Peter Bichsel, Fine Books, Zürich Galerie Adrian Bleisch, Arbon Galerie Sam Scherrer, Zürich © Text: Autorin Nicole Seeberger Valentin Magaro Die promovierte Kunsthistorikerin ist Co-Direktorin des Bündner Kunstmuseums Chur und hat mehrjährige Geboren 1972 in Münsterlingen, lebt und arbeitet in Winterthur. kuratorische Erfahrung. Von 2015 bis 2017 betrieb sie mit der Künstlerin Lydia Wilhelm den Ausstellungs- und Projektraum ON.OFF in Winterthur. Sie promovierte über den zeitgenössischen Konzeptkünstler Ilya Kabakov an der Universität Zürich und ist in der Fachkommission des Kunstraums Engländerbau, FL-Vaduz. Seeberger (*1980) stammt ursprünglich aus Zug und lebt heute in Chur.
Sie können auch lesen