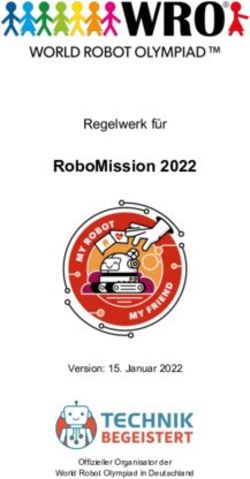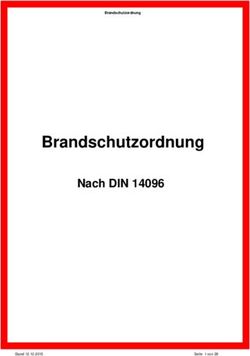Wahlrecht für alle!? Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich - Materialien für den Schulunterricht - Haus der Geschichte Österreich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wahlrecht für alle!?
Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich
Materialien für den SchulunterrichtWahlrecht für alle!?
Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich
Das Unterrichtsbeispiel setzt sich mit der Entwicklung
des Wahlrechts seit dem 19. Jahrhundert und den
ersten Wahlen 1919 auseinander. Die Einschätzungen
der SchülerInnen zur gegenwärtigen Bedeutung des
Wahlrechts werden reflektiert sowie dessen mögliche
Weiterentwicklungen diskutiert. In Zusammenhang
mit dem letzten Punkt befassen sich die SchülerInnen
kontrovers mit dem Vorschlag der Ausweitung des
Wahlrechts auf Personen, die nicht die österreichische
StaatsbürgerInnenschaft besitzen, aber im Land leben.
Lernziele
Die SchülerInnen …
analysieren Veränderungen im Wahlrecht seit
dem 19. Jahrhundert.
beziehen Position in Debatten und vertreten
Argumente.
setzen sich mit anderen Argumenten auseinander
und bewerten diese.
Bezüge zu den aktuellen Lehrplänen
BS: Politische Bildung Umfang
Kompetenzbereich Mitgestalten in der Gesellschaft: Demokratie, Politische Meinungsbildung. ca. 3 Unterrichtseinheiten
Politisches System Österreichs.
Auch geeignet im Rahmen des Unterrichts in folgenden Schultypen bzw. -fächern:
AHS / NMS: Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung
Inhalt
Sekundarstufe I 1 Einleitung/Hintergrundwissen für
3. Klasse: Modul 9 (Politische Bildung): Wahlen und Wählen
LehrerInnen
4. Klasse: Modul 8 (Politische Bildung): Politische Mitbestimmung
Sekundarstufe II 2 Methodisch-didaktische Überlegungen
8. Klasse: Kompetenzmodul 7
BAfEP: Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung 3 Ablauf
1. Jahrgang: 1. und 2. Semester
4 Arbeitsmaterialien
5. Jahrgang: 10. Semester
HAK: Politische Bildung und Geschichte M1 Arbeitsblatt: Flugblatt
2. Jahrgang: 3. Semester – Kompetenzmodul 3 M2: Arbeitsblatt: Die Entwicklung des
2. Jahrgang: 4. Semester – Kompetenzmodul 4 Wahlrechts in Österreich
M2-1: Arbeitswissen: Die Entwicklung des
HAS: Politische Bildung und Zeitgeschichte
Wahlrechts in Österreich
1. Jahrgang: 1. und 2. Semester
M3: Arbeitsblatt: Wahlrecht für alle, die hier
HLW: Geschichte und Kultur leben?
HTL: Geografie, Geschichte und Politische Bildung
2. Jahrgang: 3. Semester – Kompetenzmodul 3 5 Impressum
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 1/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 20181 Einleitung/Hintergrundwissen für LehrerInnen
Das Unterrichtsbeispiel setzt sich mit der Entwick- ist grundsätzlich nicht als moralische Verpflichtung,
lung des Wahlrechts seit dem 19. Jahrhundert und sondern nur im Zusammenhang mit einer kritischen
den ersten Wahlen 1919 auseinander. Die Einschät- Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zielgerich-
zungen der SchülerInnen zur gegenwärtigen Bedeu- tet zu vermitteln. Dabei stehen die Weiterentwick-
tung des Wahlrechts werden reflektiert sowie dessen lung der Demokratie, die Kritik an Machtverhältnis-
mögliche Weiterentwicklungen diskutiert. In Zusam- sen sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten auf allen
menhang mit dem letzten Punkt befassen sich die Ebenen als Ziele der Politischen Bildung im Zentrum.1
SchülerInnen kontrovers mit dem Vorschlag der Aus-
weitung des Wahlrechts auf Personen, die nicht die
österreichische StaatsbürgerInnenschaft besitzen, 1 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung,
aber im Land leben. Unterrichtsprinzip Politische Bildung, Grundsatzerlass 2015, S. 2,
https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/2015_12.pdf?61edq7
(abgerufen am 28.6.2018).
Die immer wieder erhobene Forderung nach einem
sogenannten AusländerInnenwahlrecht ist ein kon-
fliktreiches Thema. Die Bedeutung dieser Ausein-
andersetzung für die schulische Politische Bildung
hängt allerdings nicht bloß von aktuellen Debatten
und ihrer Brisanz ab. Vielmehr geht es darum, dass
sich der Unterricht an alle SchülerInnen unabhängig
von ihrer StaatsbürgerInnenschaft richtet. Wahlen
und das Wahlrecht nehmen in einer Demokratie
einen zentralen Stellenwert ein und sind dementspre-
chend wichtig für die Politische Bildung wie auch für
den Geschichtsunterricht. Daher dürfen SchülerInnen
mit einer ausländischen StaatsbürgerInnenschaft
nicht außen vor bleiben. Das geschieht etwa, wenn
versucht wird, die Wichtigkeit des Wahlrechts und
der Teilnahme an Wahlen herauszuarbeiten, ohne
auf den Umstand einzugehen, dass 15 Prozent der in
Österreich lebenden Menschen davon aufgrund ihrer
StaatsbürgerInnenschaft ausgeschlossen sind.
Im vorliegenden Unterrichtsbeispiel liegt der kontro
versen und ergebnisoffenen Auseinandersetzung
mit der Ausweitung des Wahlrechts auf Personen
ohne österreichische StaatsbürgerInnenschaft die
Reflexion der bisherigen Veränderungen im Wahl-
recht zugrunde. Hierbei zeigt sich, dass seit den
Anfängen des Wahlrechts dieses – mit Unterbre-
chungen durch Diktaturen – schrittweise auf gesell-
schaftliche Gruppen (Männer, Frauen, Jugendliche)
ausgeweitet wurde. Diese Veränderungen standen
mittel- und längerfristig in einem Zusammenhang
mit einer fortschreitenden Demokratisierung der
Gesellschaft, wobei die Interessen der betroffenen
Gruppen für eine Öffnung des Wahlrechts jeweils
maßgeblich waren. Die Bedeutung des Wahlrechts
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 2/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 20182 Methodisch-didaktische Überlegungen
Konfrontation mit dem Thema Wahlrecht: PartnerInnenarbeit zum historischen Flugblatt
Positionierung im Raum Im zweiten Schritt erhalten die SchülerInnen das
Zum Einstieg werden die SchülerInnen nach ihren Arbeitsblatt M1 und bearbeiten die Fragestellungen
Meinungen zum Wahlrecht gefragt, indem sie gebe- in PartnerInnenarbeit. Im Anschluss an die Partner-
ten werden, sich zu einigen vorgelesenen Aussagen Innenarbeit werden die Aufgabenstellungen/Fragen
im Klassenraum entlang einer gedachten Linie zu gemeinsam besprochen.
positionieren. Die Linie lässt sich auch mittels Klebe
band auf dem Boden, das quer durch den Klassen Besprechung in der Klasse: Entwicklung des
raum angebracht wird, visualisieren. Wer einer Wahlrechts
vorgelesenen Aussage zu 100 Prozent zustimmt, steht In der dritten Sequenz steht die Entwicklung des
zum Beispiel bei der Tafel, wer sie gänzlich ablehnt, Wahlrechts in Österreich im Mittelpunkt. Klären Sie
steht an der gegenüberliegenden Wand. Dazwischen zunächst, welches Vorwissen vorhanden ist: Wer darf
liegen viele Abstufungen. Die SchülerInnen sollen er- wählen? Seit wann ist das so (in Bezug auf die Grup-
mutigt werden, sich spontan zu positionieren. pen Jugendliche ab 16, Frauen und Männer)?
Bitten Sie einzelne SchülerInnen um eine Begründung Kleingruppenarbeit
oder Erläuterung ihrer Positionierung, aber akzeptie- Mithilfe des Arbeitswissens (Die Entwicklung des
ren Sie jedenfalls, wenn das abgelehnt wird. Zu die- Wahlrechts in Österreich, Arbeitsblatt M2-1) können
sem Zeitpunkt stehen die Meinungsäußerungen der die Aufgaben 1 und 2 eigenständig erledigt werden
SchülerInnen grundsätzlich nicht zur Diskussion, aber (Arbeitsblatt M2). Zentral ist, dass die SchülerInnen
gegensätzliche Standpunkte können selbstverständ- erkennen, wie das Wahlrecht seit seiner Einführung
lich geäußert werden. erweitert wurde (zuletzt 2007) und welche Gruppen
davon betroffen waren: Zuerst wurde die erforderli-
Aussagen zur „Positionierung“: che Mindeststeuerleistung reduziert, dann wurden
alle Männer wahlberechtigt und 1918 schließlich alle
Für mich ist wählen gehen eine BürgerInnenpflicht, Männer und Frauen (mit StaatsbürgerInnenschaft).
die ich immer erfüllen werde, wenn ich Seit den 1960er Jahren wurde schrittweise das aktive
wahlberechtigt bin. Wahlalter von 20 auf 16 und das passive Wahlalter
von 26 auf 18 Jahre gesenkt.
Wahlen ändern sowieso nichts. Also kann man
gleich daheimbleiben. Aufgabe 3 fokussiert vor diesem Hintergrund auf die
Bedeutung des Wahlrechts, die über das unmittelba-
Wenn nur wenige Leute an Wahlen teilnehmen, re Recht zu wählen und gewählt zu werden hinaus-
ist das ein Problem. geht. Die jeweilige Einschätzung als „richtig“, „unklar“
oder „falsch“ ist dabei in den allermeisten Fällen nicht
Wer nicht wählt, darf sich nachher auch nicht über eindeutig. Klar ist, dass zum Beispiel das Wahlrecht
die Arbeit der gewählten Parteien beschweren. nicht garantiert, dass sich jemand besser über Politik
informieren wird oder nicht diskriminiert wird. Den-
Es sollte eine gesetzliche Wahlpflicht eingeführt noch kommt dem Wahlrecht wohl in beiden Fällen
werden. Wer trotzdem nicht hingeht, zahlt eine eine gewisse Bedeutung zu. Dieser Diskussionsspiel-
Strafe wie beim Falschparken. raum trifft auch auf die Antwortmöglichkeiten bei der
Aufgabe 4 (Veränderungen durch die Ausweitung des
Wer mehr Steuern zahlt, dessen Stimme sollte Wahlrechts für jene, die bereits zuvor wählen konn-
bei Wahlen auch mehr Gewicht haben. ten) zu. So könnte durchaus argumentiert werden,
dass eine Ausweitung des Wahlrechts ein Macht-
Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem es verlust für jene ist, die bereits wählen durften, dass
keine Wahlen gibt. sie aber auch einen Gewinn für die Gesellschaft
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 3/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 2018insgesamt mit sich bringt. Aufgrund der Vielfalt bis zwei Runden ausreichen. Bitten Sie jeweils die zu-
möglicher Einschätzungen bleibt auch Raum für eine hörenden Gruppen, das vorgetragene Argument nach
individuelle Einschätzung. den folgenden Kategorien einzuschätzen:1
Diskussion der Einschätzungen in der Klasse Gesichertes Urteil Beruht auf gesicherten Untersu-
chungen oder ist daraus abzuleiten.
Wie in den vorangehenden Absätzen beschrieben,
Vorausurteil Ist nicht gesichert und wenig
verlangt nur die Aufgabe 1 nach einer eindeutigen
hinterfragt.
Antwort. Bei der Besprechung der Aufgabe 2 sollen
Vorurteil Ist einerseits leicht widerlegbar, aber
jeweils die subjektiven Gründe der SchülerInnen für andererseits ändern Informationen
die Wahl von bedeutenden Daten im Mittelpunkt oft nichts an den Standpunkten.
stehen. Die Aufgaben 3 und 4 verlangen nach einer
kontroversen Auseinandersetzung in der Klasse, Stellen Sie sicher, dass alle SchülerInnen diese Kri-
wobei das Hauptaugenmerk eben nicht auf „richtig“ terien sehen können (Projektion, Tafel, Kopie), aber
oder „falsch“, sondern auf den jeweiligen Argumenten stellen Sie sie nicht vorab zur Verfügung. Alle Ein-
liegt. Stellen Sie deshalb sicher, dass unterschiedli- schätzungen sind in einem gewissen Rahmen subjek-
che Standpunkte aufkommen, und bringen Sie diese tiv. Sollten in der Klasse verschiedene Standpunkte
gegebenenfalls – unabhängig von Ihrer eigenen Posi- zum Ausdruck kommen und gehört werden, können
tion – selbst ein. Sie sich zurückhalten. Sollte ein Standpunkt domi-
nieren, bringen Sie – unabhängig von Ihrer eigenen
Meinungsbild, Gruppenteilung Meinung – Gegenstandpunkte ein.
Machen Sie anschließend zum Thema, dass eine
Gruppe von in Österreich lebenden Menschen kein Urteilsbildung und Reflexion
Wahlrecht hat: Menschen ohne österreichische Abschließend stimmen die SchülerInnen noch ein-
(bzw. ohne EU-)StaatsbürgerInnenschaft. Bitten Sie mal über einen Vorschlag zum Wahlrecht für alle
die Klasse, sich so wie beim Stundeneinstieg zur im Land lebenden Menschen ab: „Wer schon fünf
folgenden Aussage zu positionieren: „Wer schon fünf oder zehn Jahre in Österreich lebt, sollte zumindest
oder zehn Jahre in Österreich lebt, sollte zumindest auf Gemeinde- oder Bezirksebene wählen dürfen.“
auf Gemeinde- oder Bezirksebene wählen dürfen.“ Reflektieren Sie gemeinsam, ob bzw. wie die Ausei-
Vermeiden Sie an dieser Stelle Diskussionen über die nandersetzung einen Einfluss auf die Positionierung
Aussage. Verweisen Sie auf einen späteren Zeitpunkt einzelner SchülerInnen hatte.
und die folgende Auseinandersetzung.
1 Vgl. Heinrich Ammerer, Warum denke ich, was ich denke? Politische
Kleingruppenarbeit: Argumente finden Teilurteile sichtbar machen und bewerten, in: Informationen zur Politi-
Bilden Sie Kleingruppen (drei bis sechs Personen), schen Bildung 29 (2008), S. 15–19.
die möglichst meinungshomogen sind, also entspre-
chend der Positionierung entlang der gedachten
Linie. Wenn alle in der Klasse zu einer Seite neigen,
trifft das für die Einzelnen trotzdem mit mehr oder
weniger Intensität zu. Lassen Sie die möglichst
homogenen Gruppen das Material M3 lesen und die
Aufgaben bearbeiten. Helfen Sie wenn nötig bei der
Klärung von Verständnisfragen in den Kleingruppen.
Gehen Sie zum nächsten Schritt über, wenn alle
Gruppen zumindest drei Argumente aufgeschrieben
und diese nach ihrem Gewicht gereiht haben.
Austausch und Bewertung von Argumenten
Ersuchen Sie die Gruppen, ihre Argumente – begin-
nend mit dem gewichtigsten – vorzulesen. Nach
jedem Argument folgt eine andere Gruppe, wobei ein
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 4/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 20183 Ablauf
Aktivität Materialien
Einstieg
Konfrontation mit dem Thema Wahlrecht:
Positionierung im Raum
Arbeitsphase
PartnerInnenarbeit zum historischen Flugblatt Arbeitsblatt (M1)
Besprechung in der Klasse: Entwicklung des Wahlrechts
Kleingruppenarbeit zur Entwicklung des Wahlrechts Arbeitsblatt (M2)
Arbeitswissen „Die Entwicklung
des Wahlrechts in Österreich“ (M2-1)
Diskussion der Einschätzungen in der Klasse
Meinungsbild, Gruppenteilung
Gruppenteilung in möglichst meinungshomogene Gruppen nach
Einschätzung zur Ausweitung des Wahlrechts
Kleingruppenarbeit: Argumente finden Arbeitsblatt (M3)
Bearbeitung der Aufgabenstellung M3
Abschluss / Diskussion
Austausch und Bewertung von Argumenten
Urteilsbildung und Reflexion Kriterien zur Einstufung
Abschließende Urteilsbildung und Reflexion der Auseinandersetzung (Projektion, Tafel, Kopie)
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 5/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 20184 Arbeitsmaterialien
M1 Arbeitsblatt: Flugblatt
M2 Arbeitsblatt: Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich
M2-1 Arbeitswissen: Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich
M3 Arbeitsblatt: Wahlrecht für alle, die hier leben?
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 6/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 2018ARBEITSBLATT M1
Objekt
Flugblatt
Wahlaufruf der Sozialdemokratischen Partei, Flugzettel, VGA, Wien
Auf dem Foto seht ihr ein Dokument aus der Ausstellung Aufbruch ins Ungewisse –
Österreich seit 1918 im Haus der Geschichte Österreich: ein Flugblatt, das zum
Wählen aufruft.
Seht euch zu zweit das Flublatt genauer an!
1. Beurteilt, ob ein Wahlaufruf heute noch so geschrieben werden könnte.
2. Aus welcher Zeit könnte das Dokument stammen?
Erklärt, wie ihr zu eurer Einschätzung kommt.
3. Vergleicht den oben abgebildeten Wahlaufruf mit jenem der Stadt Wien von
2017: Benennt Unterschiede und zieht Rückschlüsse auf gesellschaftliche
Veränderungen.
Wahlaufruf, Stadt Wien
Wahlrecht für alle!? 7/11
Die Entwicklung des Wahlrechts in ÖsterreichARBEITSBLATT M2
Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich
Lest den Text „Arbeitswissen“ zur Entwicklung des Wahlrechts in Österreich!
1. Beschreibt, wie sich die Zusammensetzung der Wahlberechtigten seit dem
Jahr 1848 verändert hat.
2. Nennt die aus eurer Sicht zwei wichtigsten Daten im Zusammenhang mit dem
Wahlrecht in Österreich. Begründet eure Auswahl.
3. Welche Rolle spielt das Wahlrecht für Einzelne bzw. für betroffene Gruppen
eurer Einschätzung nach?
Wer das Wahlrecht hat … richtig falsch unklar
a) kann selbst zum Beispiel als Abgeordnete/r kandidieren.
b) informiert sich besser über Politik.
c) wird nicht diskriminiert.
d) fühlt sich von gewählten PolitikerInnen besser vertreten.
e) kann sich leichter für eigene Interessen einsetzen.
f) wird in politischen Entscheidungen nicht übergangen.
g) wird sich eher politisch engagieren und die Gesellschaft mitgestalten.
4. Beurteile die Wahlrechtsänderungen von 1907 und 1918 aus der Sicht eines
Großgrundbesitzers, der bereits 1873 wählen durfte. Was hat sich aus seiner
Sicht verändert?
a) Er musste Macht abgeben.
b) Er profitierte von der Veränderung durch die Ausweitung der Demokratie
und der Wahlberechtigten.
c) Nichts. Er konnte ja schon wählen.
d) ………………………………………………………………………………………………
Wahlrecht für alle!? 8/11
Die Entwicklung des Wahlrechts in ÖsterreichARBEITSBLATT M2-1
Arbeitswissen
Die Entwicklung des
Wahlrechts in Österreich
1848: Erste Anfänge 1938 bis 1945: Nationalsozialismus
1848 finden in vielen Ländern Europas Revolutionen gegen Auch im Nationalsozialismus finden keine freien Wahlen
die Herrschenden statt. In der Folge entsteht zwar keine statt. Nach der Befreiung 1945 wird das Wahlrecht
Demokratie, aber es gibt zum Beispiel erstmals eine Ver- von 1923 im Wesentlichen wieder eingeführt. Etwa
fassung und so etwas wie ein Parlament. Dieses hat aller- 500.000 ehemalige NationalsozialistInnen dürfen bei
dings sehr wenig Macht. Wählen dürfen nur sehr wenige der ersten Wahl 1945 nicht teilnehmen.
Menschen, wie zum Beispiel reiche Großgrundbesitzer.
1968 und 1992: Herabsetzung des Wahlalters
1867: Staatsgrundgesetz Das aktive Wahlalter wird 1968 auf 19 und das passive auf
Erstmals beschließt der Reichsrat und nicht der Kaiser 25 Jahre herabgesetzt. 1992 wird es auf 18 (aktiv) bzw.
eine Verfassung. Damit wird die Macht des Kaisers 19 Jahre (passiv) nochmals gesenkt.
beschränkt und Österreich wird zu einer konstitutionellen
Monarchie. Es werden Grundrechte und auch ein neues 1999: Erste EU-Wahl
Vereins- und Versammlungsrecht beschlossen. In der Folge Nach dem EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995 werden
wird etwa die Gründung von Gewerkschaften und Parteien erstmals Abgeordnete zum Europäischen Parlament
möglich. gewählt. BürgerInnen aus anderen EU-Ländern dürfen in
dem Land, in dem sie leben, an Wahlen auf Gemeinde
1873: Kurienwahlrecht für den Reichsrat ebene (in Wien: Bezirksvertretung) teilnehmen.
Menschen werden nach ihrem Besitz in bestimmte Kurien
(= Gruppen) eingeteilt. Wie viel Grundbesitz man hat oder 2000: Wählen mit 16 in Bundesländern
wie viel Steuern man zahlt, bestimmt die Zugehörigkeit In den Bundesländern Burgenland und Kärnten darf erst-
zu einer Kurie. Davon hängt ab, ob man wählen darf und mals mit 16 Jahren gewählt werden. Das passive Wahlalter
wie viel die Stimme zählt. Wahlberechtigt sind nur sechs liegt bei 18 Jahren. Die anderen Bundesländer folgen.
Prozent der männlichen Bevölkerung ab 24 Jahren. In den
2002: Beschluss des „AusländerInnenwahlrechts“
folgenden Jahren wird die für das Wahlrecht erforderliche
auf Bezirksebene in Wien
Steuerleistung reduziert.
Im Wiener Landtag wird beschlossen, dass Personen ohne
1896: Alle Männer dürfen wählen österreichische StaatsbürgerInnenschaft, die fünf Jahre
Erstmals dürfen auch Männer wählen, die keinen nennens ununterbrochen in Wien wohnen, den Bezirksrat wählen
werten Besitz haben. Ihre Stimmen zählen allerdings deut- dürfen. Der Verfassungsgerichtshof hebt diesen Beschluss
lich weniger. Sie können nur 72 von insgesamt 425 Abge- 2004 auf, weil er die StaatsbürgerInnenschaft als notwen-
ordneten bestimmen. dige Voraussetzung sieht.
1907: Allgemeines, gleiches Wahlrecht für alle 2007: Wählen mit 16
Männer Jugendliche, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet
Die Kurien werden abgeschafft. Jeder Mann ab 24 Jahren haben, dürfen an Nationalratswahlen, an Gemeinderats-,
bekommt eine Stimme (= aktives Wahlrecht). Um gewählt Landtags- und Bundespräsidentenwahlen und an den
zu werden (= passives Wahlrecht), müssen Männer min- Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen. Das
destens 30 Jahre alt sein. passive Wahlalter wird auf 18 Jahre gesenkt. Österreich
nimmt mit der Senkung des aktiven Wahlalters auf
1918: Allgemeines und gleiches Wahlrecht für 16 Jahre in der EU eine Vorreiterrolle ein.
Frauen und Männer
Nach der Gründung der demokratischen Republik im
November 1918 erhalten alle Frauen und Männer, die Staats-
bürgerInnen sind, eine Stimme (ausgenommen waren
Prostituierte: Diese erhielten das Wahlrecht erst 1923).
Die erste Nationalversammlung der Republik wird im
Februar 1919 gewählt. 1923 wird das Wahlalter zunächst
gesenkt und 1929 auf 21 Jahre (aktives Wahlrecht) bzw.
auf 29 Jahre (passives Wahlrecht) hinaufgesetzt.
1933/34 bis 1938: Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur
Infolge der Ausschaltung der Demokratie werden Parteien
verboten – es finden keine Wahlen mehr statt.
Wahlrecht für alle!? 9/11
Die Entwicklung des Wahlrechts in ÖsterreichARBEITSBLATT M3
Diskussion
Wahlrecht für alle, die hier leben?
Bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 hatten 15 Prozent der in
Österreich lebenden Personen über 16 Jahre kein Wahlrecht, weil sie
nicht die österreichische StaatsbürgerInnenschaft besitzen. Das sind
rund 1,1 Millionen Menschen. In Österreich lebende EU-BürgerInnen
dürfen auf Gemeindeebene (in Wien: Bezirksebene) wählen. In Wien
wurde bereits 2002 ein Wahlrecht für alle in der Stadt lebenden Men-
schen auf Bezirksebene beschlossen. Der Verfassungsgerichtshof hat
diesen Beschluss im Jahr 2004 aufgehoben. Ob die StaatsbürgerInnen-
schaft eine Voraussetzung für das Wahlrecht sein muss, wird immer
wieder diskutiert.
Auch innerhalb der Parteien gibt es dazu unterschiedliche Positionen.
Vor Wahlen sind die Parteien gefordert, klar Stellung zu den verschie-
densten Themen zu beziehen. Das sind die Parteimeinungen zu diesem
Thema vor der Nationalratswahl im Oktober 2017:
Positionen der Parlamentsparteien vor der Nationalratswahl 2017:
Welche Parteien fordern ein Wahlrecht für (EU-)Ausländer?
Am weitesten gehen die Neos: EU-Ausländerinnen und EU-Ausländer, die in
Österreich leben, sollten nicht nur an Gemeinderatswahlen teilnehmen dür-
fen, sondern an allen Wahlen – also auch den Nationalrat wählen und selbst
kandidieren dürfen. Ausländer von außerhalb der EU sollten nach Vorstellung
der Neos erst nach einer Mindestzeit, etwa 10 Jahren, an Wahlen teilnehmen
dürfen, aber nicht kandidieren. SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne wollen am Wahl-
recht für den Nationalrat nichts ändern. Die Staatsbürgerschaft sei ein hohes
Gut und solle Voraussetzung bleiben. Damit sind am 15. Oktober rund 15% der
Bevölkerung im Wahlalter (ab 16) nicht wahlberechtigt.
Quelle: https://oe1.orf.at/artikel/636904 (abgerufen am 21.6.2018).
Arbeitsaufgaben (Gruppenarbeit)
1. Findet in der Kleingruppe drei bis vier Argumente zum Thema.
Schreibt diese verständlich auf.
Sucht zumindest ein Argument, das nicht eure eigene Position unter-
stützt. Auch wer eine klare Position hat, soll Gegenargumente kennen.
2. Einigt euch in der Gruppe darauf, welches Argument am meisten und
welches am wenigsten Gewicht hat. Reiht alle Argumente danach, für
wie wichtig ihr sie haltet.
Wahlrecht für alle!? 10/11
Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich5 Impressum
Autor: Stefan Schmid-Heher
Redaktion: Eva Meran, Louise Beckershaus
Lektorat: Julia Teresa Friehs
Grafik: zunder zwo
© 2018 Haus der Geschichte Österreich
Österreichische Nationalbibliothek
Standort: Heldenplatz
Postadresse: Josefsplatz 1, 1015 Wien
www.hdgoe.at
Diese Unterrichtsmaterialien erscheinen im Kontext der
Eröffnungsausstellung des Hauses der Geschichte Österreich
Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918 (11/2018–05/2020)
und wurden realisiert mit freundlicher Unterstützung von:
In Kooperation mit:
PH
Wien
Für Anregungen danken wir:
Andrea Brait (Institut für Zeitgeschichte/Institut für Fachdidaktik, Universität Innsbruck)
Alois Ecker (Fachdidaktikzentrum „Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung“/Institut für Geschichte, Universität Graz)
Thomas Hellmuth (Didaktik der Geschichte und Politischen Bildung /Institut für Geschichte, Universität Wien)
Philipp Mittnik (Zentrum für Politische Bildung/Pädagogische Hochschule Wien)
Lara Möller (Didaktik der Politischen Bildung/Zentrum für LehrerInnenbildung, Universität Wien)
Dirk Rupnow (Institut für Zeitgeschichte, Universität Innsbruck)
Heidemarie Uhl (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Moritz Wein (erinnern.at)
Bildnachweis:
Titelseite:
Großdemonstration in Wien für ein allgemeines Wahlrecht, Fotografie, Körperschaft: R. Lechner
(Wilh. Müller), Wien, 28.11.1905. ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung
Frauenwahlrechtstag, Fotograf: Karl Seebald, 19.3.1911. ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung
Arbeitsblatt M1:
Wahlaufruf der Sozialdemokratischen Partei, Flugzettel, 1919. VGA, Wien
Wahlaufruf, 2017. Stadt Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die Materialien dürfen in Schulen
zu Unterrichtszwecken vergütungsfrei vervielfältigt werden. Jede andere Verwertung ist unzulässig.
Haftungsausschluss: Die Redaktion ist für den Inhalt der angeführten Internetseiten nicht verantwortlich.
Unterrichtsmaterialien des Wahlrecht für alle!? www.hdgoe.at/unterrichtsmaterialien 11/11
Hauses der Geschichte Österreich Die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich Stand: November 2018Sie können auch lesen