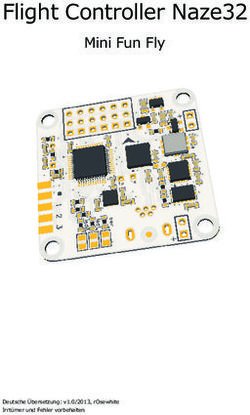"Waz skel iz sin?" Typologie der Verwendungsweisen des Verbes sculan im althochdeutschen Tatian und bei Otfrid - unipub
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„Waz skel iz sin?“
Typologie der Verwendungsweisen des Verbes sculan
im althochdeutschen Tatian und bei Otfrid
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
eines Magisters der Philosophie
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Philipp Raffael PFEIFER
am Institut für Germanistik
Begutachter: Assoz. Prof. Dr. phil. Christian Braun
Graz, 2021Diese Arbeit ist all jenen gewidmet, die das Feuer der Forschung und die
Freude für den Moment der Erkenntnis in sich tragen und teilen.
2Danksagung
Allen voran möchte ich meinem Betreuer, Assoz. Prof. Dr. phil. Christian Braun, herzlich für
die Forderung und Förderung während meines Studiums danken. Danken möchte ich diesem
außerdem für mein Feuer für das Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte, an
dem er einen großen Anteil hat, und für all die Möglichkeiten, meine Passion auch
professionell zu verfolgen!
Großer Dank gebührt auch Dr. phil. Elisabeth Scherr, M.A., für die vielen fachlichen Gespräche
und wissenschaftlichen Anregungen und Diskussionen.
Außerdem möchte ich an dieser Stelle Katharina Schwarzl, Michaela Green und Anita Riedl für
die vielen wertvollen Gespräche und interessanten Überlegungen und Kommentare danken.
Ich möchte auch meinen Eltern danken, die mich mein ganzes Studium und Leben hindurch
immer in allen Belangen von ganzem Herzen unterstützen!
Zuletzt möchte ich noch all meinen Professor*innen und Freund*innen danken, die mich mein
Studium hindurch begleitet und unterstützt haben.
3Inhaltsverzeichnis
Vorwort ............................................................................................................................ 5
1 Einleitung....................................................................................................................... 8
2 Theoretische Vorbemerkungen .................................................................................... 11
2.1 Modalität ..................................................................................................................................... 11
2.2 Modus, Aspekt und Tempus ........................................................................................................ 12
2.2.1 Modus ................................................................................................................................... 12
2.2.2 Aspekt und Aktionsart .......................................................................................................... 14
2.2.3 Tempus ................................................................................................................................. 16
2.3 Funktionen von Modalität ........................................................................................................... 18
2.4 Modalverben allgemein .............................................................................................................. 23
2.5 Etymologie und Verwendungsweisen von sculan/sollen ............................................................ 27
2.6 Theoretische Verortung .............................................................................................................. 35
2.7 Methodik ..................................................................................................................................... 37
2.8 Das Corpus ................................................................................................................................... 39
3 Analyse ........................................................................................................................ 41
3.1 Vollverbverwendungen ............................................................................................................... 41
3.2 Futurische Verwendungen .......................................................................................................... 42
3.2.1 Das prophetische Futur ........................................................................................................ 43
3.2.2 Das unmittelbare Futur ........................................................................................................ 47
3.2.3 Das neutrale Futur ................................................................................................................ 50
3.3 Deontische Verwendungen ......................................................................................................... 51
3.3.1 Das extrasubjektiv-volitive sculan ........................................................................................ 52
3.3.2 Das normative sculan ........................................................................................................... 54
3.3.3 Das adhortative sculan ......................................................................................................... 61
3.3.4 Zur Verneinung des deontischen sculan .............................................................................. 62
3.4 Epistemische Verwendungen ...................................................................................................... 63
3.4.1 Das quotative sculan ............................................................................................................ 64
3.4.2 Das hypothetische sculan ..................................................................................................... 66
Zusammenfassung ......................................................................................................................... 68
4 Fazit und Zusammenfassung ........................................................................................ 69
5 Ausblick ....................................................................................................................... 77
6 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis ............................................................................ 78
7 Literaturverzeichnis...................................................................................................... 79
4Vorwort
Wir schreiben das Jahr 2021: Nach hunderten von Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit konnten
viele der größten Rätsel der Geisteswissenschaft gelöst werden, und heute versucht eine
große Zahl an emsigen, interessierten, begeisterten und gebildeten Forscher*innen auch noch
den letzten Geheimnissen des menschlichen Geistes sowie dessen Schöpfungen auf den
Grund zu gehen. Doch halt! So ist es nicht!
In der postmodernen Wissenschaftskultur beschleicht einen immer mehr die Erkenntnis, dass
das Feuer abhandengekommen ist. Der platonische Eros, der immer danach strebt, einen Weg
zu finden, scheint irgendwo auf der Strecke verloren gegangen zu sein. Hat denn nach all der
Zeit von der Antike bis in die Postmoderne nun doch Penia, der Mangel, die Überhand
gewonnen und ihn hinabgezogen aus den hohen Gefilden erkenntnisgewinnender Ekstase?
Immer wichtiger werden, auch für die Geisteswissenschaften, Zahlen, in denen sich der
„scheinbare“ Erkenntnisgewinn diskret bestimmen lässt. Die Möglichkeit, viele Phänomene
messbar zu machen, der vor allem die Naturwissenschaften in den letzten Jahrhunderten viele
Erkenntnisse verdanken, hat sich zu einer Notwendigkeit der Be-wertung, am besten mit
monetären Werten, gewandelt. Sollte dies nicht möglich sein, so wird zumindest eine
möglichst objektive, internationalen Standards entsprechende Wertung gefordert, die
wiederum in ökonomische Werte umgerechnet werden kann. Scheinbar fortschrittliche und
angeblich objektive Bewertungssysteme erobern auch die geisteswissenschaftliche Bildung
wie im Sturm. Was dabei (sowohl in Schule wie an Universitäten) verloren geht, sind
Individualität und Kreativität; zwei Faktoren, auf die sich nicht nur die geisteswissenschaftliche
Forschung jahrhundertelang stützte. Die Notwendigkeit der Bezifferung von Leistung hat dazu
geführt, dass Wissenschaftler*innen nicht mehr an ihrer individuellen Fähigkeit, komplexe
Vorgänge und Sachverhalte kreativ zu vernetzen und umfassend darzustellen, gemessen
werden, wenn es beispielsweise um die Besetzung von Stellen an Universitäten und
Akademien geht, sondern oftmals allein anhand der Anzahl an publizierten Artikeln. Der
tatsächliche Inhalt dieser Artikel ist häufig zweitrangig. Zudem rauben knapp bemessene
Kettenvertragsregelungen aufstrebenden, engagierten und in höchstem Maße fähigen
Wissenschaftler*innen die Möglichkeit, ihrem Interessensgebiet an der Universität
nachzugehen und die Wissenschaft dadurch zu bereichern. O tempora, o mores!
5Entgegen dieser Entwicklung muss gesagt werden, dass sich – gerade in
geisteswissenschaftlichen Fächern – vieles, man könnte sogar behaupten alles, objektiver
Messbarkeit entzieht. Besonders in den historischen Wissenschaften und den Philologien
beruht jegliche Aussage auf der individuellen Interpretation von Wissen schaffenden
Forscher*innen. Diese hermeneutische Interpretation wie auch immer gearteter Quellen
muss wohl als einzige genuine Methode der Geisteswissenschaften gelten. Jegliche andere
Methode ist entweder von dieser ableitbar (wie bspw. quantitative Methoden in den
Philologien, deren Aussagekraft von einer verbundenen kritischen Interpretation abhängig ist)
oder unwissenschaftlich. Um jedoch zu einer adäquaten Interpretation der betrachteten
Quelle(n) zu kommen, müssen Geisteswissenschaftler*innen wohl über eine umfassende
(humanistische) Bildung verfügen, denn jegliche Erkenntnis ist im höchsten Grad der
Abstraktion wohl als Identifizierung von Mustern und Systemen zu sehen. Ob diese Muster
tatsächlich existieren oder nur von uns Menschen als solche wahrgenommen werden, sei hier
nicht diskutiert. Jede Wissen-Schaf(f)t jedoch kann als Entdeckung und Beschreibung von
Mustern und Systemen bezeichnet werden. Solche Muster finden sich überall, in den Natur-
wie auch in den Geisteswissenschaften und immer wieder sind sie ähnlich oder kongruent. So
wie die transzendente Zahl Pi in der Mathematik in vielen Zusammenhängen auftaucht, wo
Laien sie nicht erwarten würden, so finden sich oft Muster, die aus einem Bereich bekannt
sind, in gänzlich anderen Bereichen wieder. Um diese Ähnlichkeit jedoch zu erkennen und
beschreiben zu können, bedarf es einer umfassenden, universellen Bildung, ohne die viele
dieser Muster aus anderen Bereichen ja gar nicht erst in den Fokus der Aufmerksamkeit
gelangen würden. Genau hierfür wurde die Institution der Universität geschaffen, das ist ihre
Aufgabe! Es ist nicht die Aufgabe der Universität, ein Ausbildungsdienstleister zu sein oder gar
ein Produkt „Ausgebildeter“ (gleichsam am Fließband) zu produzieren, das dann seinen Platz
in der vom Markt dominierten Gesellschaft passgenau zu füllen hat. Genau dies scheint der
Universität jedoch durch diverse politische und universitätspolitische Maßnahmen
bevorzustehen. Ein Verfall zum Ausbildungszentrum für Spezialist*innen, deren weiteres
Leben genau vorgegeben ist.
Dagegen muss sich mit aller Vehemenz jede*r wenden, der das Ideal der universellen Bildung
nicht aus den Augen verloren hat, der*dem es etwas bedeutet, Wissen zu schaffen und
Erkenntnisse zu gewinnen. „Echten“ Wissenschaftler*innen bedeutet die Anwendbarkeit ihrer
Theorien für die Wirtschaft nichts! „Echten“ Wissenschaftler*innen bedeuten Prestige und
6Ehre nichts! „Echten“ Wissenschaftler*innen bedeuten Aufsatzquoten nichts! Denn sie
wissen, dass der schönste Moment der forschenden Tätigkeit der AUGENBLICK DER
ERKENNTIS ist! Jener Augenblick, in dem die Struktur erstmals durchschaut wird, in dem das
Muster erstmals offenbar wird, in dem der Schleier der Unkenntnis gelüftet wird und das
bisher Verborgene erkennbar wird, dieser Moment ist der Funke, durch den das Feuer des
Forschergeistes erneut entzündet wird. Ohne dieses Feuer muss die Wissenschaft als Ganze
in Dunkelheit und eisiger Kälte untergehen. Und dieser Winter hat bereits begonnen.
Lasst uns darum versuchen, dieses Feuer wieder neu zu entfachen. Gegen systemische
Einschränkungen, die der Flamme den Sauerstoff entziehen. Gegen die Engstirnigkeit des
übertriebenen Expert*innentums, der auf kurz oder lang das Feuerholz der vertrauten nahen
Umgebung ausgehen wird und gegen die Unterordnung von Bildung unter Kriterien der
Messbarkeit;
lassen wir die lodernden Flammen chaotisch und kreativ tanzen!
71 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem der wohl meistdiskutierten und
umstrittensten Bereiche nicht nur der germanistischen Sprachwissenschaft.
Sprachwissenschaftler*innen von vielen Sprachrichtungen haben sich in den letzten hundert
Jahren mit dem Phänomen der Modalität beschäftigt und auch in der Philosophie besteht kein
Mangel an Beschreibungen und Erklärungsansätzen. Grundlegend lässt sich die
wissenschaftliche Erforschung von Modalität auf genau diese Beschreibungen der
philosophischen Logik zurückführen. Diese Ableitung hat auch die linguistische Forschung
nachhaltig beeinflusst. Viele Ansätze, auch der neueren Forschung, basieren im Kern noch auf
der Modallogik des beginnenden 20. Jahrhunderts, die ihrerseits elementare Gedankengänge
auf die antike Philosophie, insbesondere auf Aristoteles zurückführt. Betrachtet man die
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Modalität, zeigt sich, dass diese (besonders im Kontext
als Phänomen der Sprache) ein inhärentes Problem aufweist: Sie entzieht sich jeglicher mehr
oder weniger universeller konziser Beschreibung. Einstein (1934: 165) schrieb einmal:
It can scarcely be denied that the supreme goal of all theory is to make the irreducible basic elements
as simple and as few as possible without having to surrender the adequate representation of a single
datum of experience.
Dieses supreme goal hat die Modalitätsforschung bisher noch nicht erreicht und es ist fraglich,
ob sie dieses je erreichen kann. Modalität findet sich (selbst wenn man die Erforschung auf
Sprache beschränkt) auf unterschiedlichsten Ebenen und Bereichen der Forschung, sie
umfasst eine Unzahl an sprachlichen Ausdrucksformen, die nur schwer auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen sind, zumal in der wissenschaftlichen Erforschung von
Modalität oft versucht wurde, eine allen (bzw. mehreren) Sprachen gemeinsame universelle
Modalität zu beschreiben. Diese Vielfalt an Phänomenen, die unter dem Begriff Modalität
subsummiert sind,1 hat dazu geführt, dass die Forschung versucht hat, sich ihrer von
verschiedensten Richtungen anzunähern; mit unterschiedlichen theoretischen Konzeptionen
im Kopf und auf beinahe allen Ebenen der linguistischen Beschreibung. Prominent vertreten
sind (insbesondere auch in der aktuellen Forschung) Ansätze, die sich in den wesentlichen
1
Siehe Kapitel 2.1 für eine kleine Übersicht für die deutsche Sprache.
8Konzeptionen auf generative Grammatiktheorien bzw. die Formale Semantik stützen. Seit den
späten 70ern und frühen 80ern kann Angelika Kratzers Theorie (vgl. 1981, 1991 u.a.) von den
Redehintergründen als kanonisch gelten, doch auch gegen diese hat sich bereits Kritik
erhoben.2 So bleibt also weiterhin nicht generell anerkannt, was Modalität ist, welchen
Parametern sie unterliegt und auf welche Art und Weise sie am besten zu beschreiben ist.
Theoretische Konzeptionen zur Modalität, die wie bereits erwähnt in Fülle existieren und eine
große Menge an Begrifflichkeiten hervorgebracht haben, stehen aber nicht im zentralen Fokus
der vorliegenden Arbeit. Vielmehr ist das Ziel dieser Arbeit, anhand einer umfänglichen
Korpusanalyse von Otfrids Evangelienbuch und dem ahd. Tatian die Verwendungsweisen des
Modalverbs sculan am Text zu untersuchen. Hierbei wurde zunächst die Frage gestellt, welche
Kategorisierung hier vorteilhaft erscheint, und eine entsprechende Typologie erstellt. Ein
weiteres zentrales Ziel dieser Arbeit liegt darin, formale Merkmale zu identifizieren, die als
Indikatoren oder Kontraindikatoren für gewisse Verwendungsweisen herangezogen werden
können, um eine intersubjektivere Interpretation zu erlauben, zum tieferen Verständnis der
Kategorien und des Phänomens Modalität an sich beizutragen und besonders auch bei
Zweifelsfällen als Entscheidungshilfe dienen können. Als Merkmale wurden bestimmte
semantische, syntaktische, morphologische und lexikalische Phänomene betrachtet.
Grundlegend besteht die vorliegende Arbeit aus zwei großen Hauptabschnitten: aus
theoretischen Vorbemerkungen und der praktischen Analyse. Die vorausgeschickten
theoretischen Vorbemerkungen setzen sich aus mehreren Teilen zusammen. Zunächst wird
auf Modalität an sich eingegangen und versucht, einen Einblick in den höchst komplexen
Zusammenhang zwischen Modus/Modalität, Aspekt und Tempus zu geben. Aufgrund des
Fokus dieser Arbeit auf einer historischen Sprachstufe des Deutschen beschäftigt sich dieser
Abschnitt vor allem mit den Voraussetzungen im Proto-Indogermanischen und deren
Transformationen in den späteren Sprachstufen des Deutschen.
Im nächsten Kapitel werden ausgewählte Aspekte der wissenschaftlichen Forschung zu den
einzelnen Funktionen von Modalität (insbesondere von Modalverben) dargestellt. Dieser
Überblick soll zur Orientierung in der bereits erfolgten Forschung dienen, wenngleich im
Rahmen dieser Arbeit nicht alle Ansätze und Beschreibungen thematisiert werden können.
2
Vgl. zu einer Beschreibung der Kritik Scherr 2019: 30.
9Da sich diese Arbeit im Speziellen mit einem Modalverb beschäftigt, ist es anschließend an
diese überblicksmäßige Einführung in die Forschung notwendig, einige allgemeine
Bemerkungen zu Modalverben und ihren spezifischen Eigenschaften – obgleich auch diese
nicht trivial eingrenzbar sind – vorzubringen. Daraufhin wird noch auf die Spezifika des Verbes
sculan selbst eingegangen, dessen Etymologie aufgerollt und dessen spezielle Funktionen, wie
sie von der Forschung der letzten Jahrzehnte beschrieben wurden, dargelegt.
Nach dieser Beschreibung der theoretischen Hintergründe folgt ein Kapitel über die speziellen
theoretischen Konzeptionen, die der Analyse dieser Arbeit zugrunde liegen. Hier wird auch
erklärt, welche Termini verwendet werden, was diese im Rahmen der Analyse dieser Arbeit
bezeichnen und auf welche Untersuchungen sie zurückzuführen sind. Danach folgt ein
Abschnitt, der die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit erläutert. Gemeinsam mit
theoretischer Verortung und Methodik bildet eine kurze Schilderung des Corpus und einer
Begründung für die Auswahl das Bindeglied zur praktischen Analyse.
Diese praktische Analyse, die auf einem induktiv-deduktiven Mischansatz beruht, ist in die
verschiedenen identifizierten Kategorien der für diese Arbeit auf Basis früherer
Untersuchungen erstellten Typologie gegliedert. In den Kapiteln zu den einzelnen
Verwendungsweisen finden sich jeweils eine Beschreibung der Konzeption der
Verwendungsweise, Beispiele sowie (auch mit Beispielen dargestellt) eine Erläuterung der
identifizierten formalen Merkmale und ihrer Aussagekraft. Den Abschluss des Kapitels bildet
jeweils eine kurze Zusammenfassung zu den wichtigsten Indikatoren und Kontraindikatoren.
Zuletzt werden noch einige Spezialfälle zur Diskussion gestellt, die sich einer Einteilung aus
unterschiedlichen Gründen entziehen.
Im abschließenden Fazit wird ein Überblick über die Typologie sowie eine Übersicht über die
einzelnen betrachteten Merkmale und ihre Brauchbarkeit als (Kontra-)Indikatoren gegeben.
Im Ausblick werden noch weitere Anschlussuntersuchungen diskutiert und Möglichkeiten
erörtert, wie die Erkenntnisse dieser Arbeit in anderen Analysen benutzt und durch andere
Studien vertieft und erweitert werden könnten.
102 Theoretische Vorbemerkungen
Betrachtet man Eigenschaften und Spezifika von Modalverben, so muss – nicht zuletzt
aufgrund des langen und intensiven Forschungsdiskurses, innerhalb dessen nicht immer
Einigkeit vorherrscht – zunächst eine allgemeine Beschäftigung mit Modalität vorausgeschickt
werden. Hier ist zu beschreiben, wie Modalität mit den grammatischen Kategorien Tempus
bzw. Aspekt und Aktionsart verwoben ist. Außerdem ist zu klären, welche Funktionen
Modalität erfüllen kann und welche Besonderheiten Modalverben aufweisen.
2.1 Modalität
Während Abraham (2009b: 251) noch darauf hinweist, dass der Grammatikduden (von 1995)
unter Modalität „überhaupt nichts“ versteht, erläutert die neuere Auflage der
Dudengrammatik (DUDEN 2016: 510f.) Modalität folgendermaßen:
Es handelt sich dabei um Ausdrucksmöglichkeiten, die den Redehintergrund des Sprechers zur
Sprechzeit widerspiegeln: seine Auffassung davon, was in der Wirklichkeit der Fall und was
nicht der Fall ist, den Geltungsbereich seiner Aussage, seinen Wissenshorizont und die Quellen
seines Wissens, seine Glaubenswelt, seinen Willen und seine Wünsche mit Bezug auf die
Wirklichkeit, seine Einstellung zu dem was gesagt wird, usw. [H.i.O.]
Diese Redehintergründe wurden zuerst von Kratzer (vgl. 1981, 1991 u.a.) beschrieben und
später auch in die IDS-Grammatik (vgl. Zifonun et al. 1997) in vereinfachter Form
übernommen. (Eine nähere Betrachtung dieser Theorie findet sich in Kapitel 2.3).
Das Neuhochdeutsche bietet unterschiedliche Möglichkeiten, Modalität auszudrücken. So
kann diese entweder durch den Modus des Verbs, durch ein Verbaladjektiv (Gerundiv), durch
Modalwörter, -partikel, -adjektive, -adverbien oder Modalsubstative, mithilfe modaler
Infinitive3, durch gewisse Derivationsmorpheme von Adjektiven (z.B. {-bar}, {-wert}, {-
würdig} etc.), durch futurum in praeterito4 sowie durch Modalverben und Modalitätsverben5
realisiert werden (vgl. Milan 2001: 15). Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf Letzteren,
3
Sein und haben mit Infinitiv: bspw. ‚es ist zu erledigen‘ (vgl. Milan 2001: 2 sowie 15 und genauer (in anderer
Terminologie) Zifonun et al. 1997: 1897f.).
4
Die bei Milan (vgl. 2001: 15) als „hypothetisches Futur“ bezeichnete Form, wird hier am Sinne von (Scherr
2019:229) als epistemische Verwendung des Verbes werden aufgefasst.
5
Auf die Eigenschaften und die Unterschiede zwischen Modalverben und modalverbähnlichen Verben wird
unten (Kapitel 2.4) kurz eingegangen. Diese Beschäftigung steht jedoch nicht im Zentrum dieser Arbeit.
11auf die anderen Fälle soll nur eigegangen werden, wenn sie zum tieferen Verständnis eines
bestimmten untersuchten Satzes beitragen können.
2.2 Modus, Aspekt und Tempus
2.2.1 Modus
Das Neuhochdeutsche umfasst drei Modi: Indikativ, Konjunktiv und Imperativ. Von diesen drei
Modi ist das Paradigma des Imperativs gegenüber den anderen beiden vollständigen
Paradigmata äußerst defektiv. Das Nhd. besitzt vom Imperativ formal nur noch die
2.P.Sg.Präs.; die 2.P.Pl.Präs. ist dem Indikativ gleich, andere Formen existieren nicht (vgl.
DUDEN 2016: 445f.). Das Althochdeutsche zeigt bisweilen auch noch einen Imperativ der
1.P.Pl.Präs (vgl. Braune 2018: 356). Der Konjunktiv des Neuhochdeutschen wird heute
üblicherweise in Konjunktiv I und Konjunktiv II unterteilt, wobei dadurch ausgedrückt wird,
dass der Unterschied in der Bildung (der Konjunktiv I wird vom Präsensstamm, der Konjunktiv
II vom Präteritumstamm gebildet) kein temporales Moment mehr aufweist. Auch dieser
Modus ist also im Tempus-Modus-System des Deutschen nicht gänzlich vertreten. Der
Konjunktiv wird im Nhd. dazu benutzt, einen Irrealis oder Potentialis, eine indirekte Rede oder
eine Aufforderung zu markieren (vgl. DUDEN 2016: 527). Für das Ahd. hält Schrodt (2004: 130)
grundlegend fest, dass die nicht-indikativischen Modi „keinen bestimmten Wahrheitswert
haben“. Die Funktionen des Konjunktivs umfassen somit zielgerichtete und nicht-zielgerichtet
Modalität (vgl. Schrodt 2004: 1316). Der Konjunktiv II kann zusätzlich dazu dienen, eine
Vorstellung in die Vergangenheit zu verlegen, besitzt hier also noch teilweise eine temporale
Komponente. Daneben kann der Konjunktiv II jedoch auch herangezogen werden, um auf die
Irrealität eines Sachverhaltes zu referieren, eine Verwendungsweise, in der er seine temporale
Funktion verliert (vgl. Schrodt 2004: 131).
Grundlegend entspringt der germanische Konjunktiv aus dem indogermanischen Optativ, der
ursprünglich Wunsch und Möglichkeit ausdrückt, während der idg. Konjunktiv dazu diente,
Wollen und Voraussicht auszudrücken (vgl. Brugmann 1970: 578). Tichy (vgl. 2009: 103ff.)
führt das Verhältnis zwischen idg. Konjunktiv und Optativ noch näher aus. Mithilfe des
6
Der sich hier Wunderlis Terminologie bedient, um im Wesentlichen auf nicht-epistemisch und epistemisch zu
referieren.
12Optativs wird die „Möglichkeit einer gegenwärtigen, zukünftigen oder zeitstufenlosen
Handlung aus der Sicht des Sprechers“ zum Ausdruck gebracht (Tichy 2009: 103). Hierbei ist
es unerheblich, ob diese Handlung als möglich (im Sinne eines Potentialis) oder als nicht
realisierbar (im Sinne eines Irrealis) eigeschätzt wird (vgl. Tichy 2009: 103). Zudem drückt der
Optativ, wie auch bei Brugmann (vgl. 1970: 578) erwähnt, den Wunsch des Sprechers aus (vgl.
Tichy 2009: 104). Nicht zuletzt dient der Optativ auch dazu, „allgemeine Anweisungen und
Vorschriften“ (als präskriptiver Optativ) auszudrücken (vgl. Tichy 2009: 104).
Der Konjunktiv wird primär eingesetzt, um die Erwartung des Sprechers (expektiv)
wiederzugeben. Eine weitere Funktion des Konjunktivs ist der Hortativ, der in allen Personen
auch als volutativer Konjunktiv bezeichnet wurde, laut Tichy (vgl. 2009: 105) aber immer
auffordernd ist. Tichy (2009: 105) schlägt hier die Paraphrase „ich erwarte, dass“ für alle
Personen vor. Sie weist jedoch darauf hin, dass sich der Bezug in deliberativen Fragen auf die
zweite Person verschiebt und hier von „erwartest du, dass“ als Paraphrase auszugehen ist
(Tichy 2009: 106). Der Konjunktiv unterscheidet sich von speziellen Verwendungen des
Präsens, die oft semantische Ähnlichkeit zu den Funktionsweisen des Konjunktiv aufweisen,
dadurch, dass jene immer „die Gewilltheit, den Wunsch oder die Absicht des
Handlungsträgers“ wiedergeben, während der Konjunktiv immer einen Bezug zum Sprecher
aufweist (Tichy 2009: 107). Meier-Brügger (2010: 393) attestiert dem Konjunktiv die
„Grundbedeutung Zukunft‘“, was sich auch darin zeigt, dass bspw. das lateinische e-Futur auf
dem idg. Konjunktiv basiert (vgl. Meiser 2010: 199).
Diese Tempus-Modus-Beziehung ist auch für die Untersuchung der Modalverben von
Interesse. Auch hier sind – zumindest in den nicht-epistemischen modalen Verwendungs-
weisen – (prospektive)7 Temporalität und Modalität inhärent verknüpft; da ein Sachverhalt
durch einen modalen Ausdruck „eine Verbalhandlung als faktisch offen markiert [wird]“
(Scherr 2019: 82), liegt die Entscheidung über die Faktizität zwingendermaßen in einem
(prospektiven)8 temporalen Verhältnis zur Referenzzeit.
7
In ähnlicher Weise wird auch der Begriff projektiv gebraucht (vgl. bspw. Zemann 2013)
8
Dies ist bspw. bei den deontischen Verwendungen der Fall, wenn Aufforderungen transportiert werden, deren
potentielle Ausführung zur Aufforderung in der Zukunft liegen muss.
132.2.2 Aspekt und Aktionsart
Sowohl Aspekt als auch Aktionsart drücken die zeitliche Ausdehnung bzw. den zeitlichen
Verlauf einer Handlung aus (vgl. Heinold 2015: 17, 19). Im Gegensatz zum Aspekt, bei dem es
sich um eine grammatische Kategorie handelt, ist die Aktionsart einem einzelnen Wort
anhaftend, also lexikalisch verankert (vgl. Schrodt 2004: 101). Die Aktionsarten können
grundlegend in zwei Kategorien geteilt werden: durativ und terminativ. Durative Verben
beschreiben eine Handlung, die nicht punktuell, sondern andauernd ist, und lassen sich in die
Unterkategorien semelfaktiv und iterativ unterteilen. Außerdem ist jedes durative Verb
entweder statisch oder dynamisch, d.h. es wird entweder ein Zustand ausgedrückt oder ein
Vorgang. Die terminativen Verben sind in punktuelle und nicht-punktuelle Ausdrücke geteilt
(vgl. Schrodt 2004: 102). Während nicht-punktuelle Verben eine „wenn auch noch so kurze
zeitliche Ausdehnung“ aufweisen und telisch sind, i.e. „Prozesse [beschreiben], die im Hinblick
auf ein Ziel ablaufen“ (Schrodt 2004: 103), drücken punktuelle Verben „ein Ereignis, das ohne
zeitliche Ausdehnung punkthaft geschieht“, aus (Schrodt 2004: 102). Zu den terminativen
Verben lassen sich zusätzlich noch die Untergruppen inchoativ (auch ingressiv, i.e. den Beginn
eines Vorgangs beschreibend) und egressiv (auch effektiv, finitiv, konklusiv, resultativ, i.e. das
Ende eines Vorgangs beschreibend) bilden (vgl. Schrodt 2004: 103). Im Idg. wurde die
Aktionsart teilweise durch Suffixe bzw. Wurzelerweiterungen transportiert, die sich mitunter
auch einzelsprachlich erhalten haben (vgl. Watkins 1969: 56; vgl. auch Tichy 2009: 122f.)). Im
Ahd. können die Klassen der schwachen Verben in Fällen, in denen Opposition besteht, d.h.
wenn von einem Stamm mehrere Klassenbildungen existieren, als Träger von Aktionsarten
gelten (vgl. Schrodt 2004: 103). Man vergleiche bspw. die Bedeutung der Wörter wahhēn
(‚erwachen‘), wecken (‚wecken, aufwecken‘) und wahhōn (‚wach sein‘) (vgl. Köbler 2014 s.v.
wahhēn; wahhōn; wekken). Im Nhd. sind die Aktionsarten hauptsächlich lexikalisch
ausgedrückt, können aber auch durch Präfixe realisiert werden (vgl. Heinold 2015: 30), man
denke bspw. an er-, das oft für die ingressive Aktionsart benutzt wird, oder ver-, das häufig die
gegenteilige egressive Aktionsart kennzeichnet (vgl. bspw. blühen, erblühen und verblühen).
Im Unterschied zu den lexikalischen Aktionsarten handelt es sich beim Aspekt um eine
grammatische Kategorie, die morphologisch markiert wird bzw. wurde (vgl. Schrodt
142004: 102). Grundlegend werden die Aspekte perfektiv und imperfektiv unterschieden.9 Tichy
(2004: 126) unterscheidet die beiden Aspekte folgendermaßen.
a) Der Bezugspunkt liegt innerhalb der Handlung, läuft daher auf der Zeitachse mit der Handlung mit:
imperfektiver Aspekt. [H.i.O]
b) Der Bezugspunkt liegt außerhalb der Handlung, auf der Zeitachse liegt er nach deren Abschluss:
perfektiver Aspekt. [H.i.O.]
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich im Laufe der Geschichte des Proto-
Indogermanischen das System der Aktionsarten in ein Aspektsystem wandelte (vgl. LIV 2001:
36; Meier-Brügger 2010: 390).
Dabei wurden alle Wurzelbildungen und (fast?) alle derivierten Aktionsartenkategorien einem der
beiden Aspekte zugewiesen; telische Wurzelbildungen und Aktionsarten wurden als perfektiv, atelische
als imperfektiv interpretiert.
(LIV 2001: 36)
Das Aspektsystem des Proto-Indogermanischen war stark mit dem Tempussystem verwoben.
So wurden Aspekt und Tempus gemeinsam durch die Stammbildung markiert. Zu diesem
Zweck verfügte das Proto-Indogermanische über drei Aspekt-Tempus-Stämme: den
Präsensstamm, den Aoriststamm und den Perfektstamm (vgl. Meier-Brügger 2010: 390; Tichy
2009: 127). Der Präsensstamm – und das aus diesem gebildete Imperfekt – drückte den
imperfektiven Aspekt aus, der Aoriststamm den perfektiven Aspekt. Der Perfektstamm
bezeichnete das andauernde Resultat einer abgeschlossenen Handlung.10 Dies kann entweder
als eigener Aspekt (resultativ), als imperfektiv oder als außerhalb des Aspektsystems gedeutet
werden (vgl. Meier-Brügger 2010: 391; Tichy 2009: 127). Zusätzlich zu diesen Aspekten wurde
eine Zeitstufe markiert, Zeitstufenlosigkeit, Gegenwart oder Vergangenheit, wobei der
perfektive Aspekt aus handlungslogischen Gründen die Gegenwart ausschließt (vgl. Meiser
2010: 39).
Die folgende Tabelle aus Meiser (2010: 39) veranschaulicht den Zusammenhang zwischen
Aspekt, Tempus und Modus im Proto-Indogermanischen.
9
Gegen diese Terminologie Schrodt (vgl. 2004: 104), der stattdessen die Begriffe kursiv und komplexiv vorschlägt.
10
Funktional vergleichbar mit dem nhd. Zustandspassiv.
15Aspekt Tempora Modi
Gegenwart Außerzeitlich Präteritum Konjunktiv Optativ Imperativ
Perfektiv --- Injunktiv Indikativ Konjunktiv Optativ Imperativ
Aoriststamm Aorist Aorist Aorist Aorist Aorist
Imperfekt.
Präsensstamm Indikativ Injunktiv Imperfekt Konjunktiv Optativ Imperativ
Präsens Präsens Präsens Präsens Präsens
Perfektstamm Indikativ Injunktiv Plusquamperfekt Konjunktiv Optativ Imperativ
Perfekt Perfekt Perfekt Perfekt Perfekt
Tabelle 1: Aspekt-Tempus-Modus im Proto-Indogermanischen (Meiser 2010: 39)
In den Einzelsprachen ist dieses (auch idealisierte) System zumeist nicht mehr erhalten. Im
Deutschen wurde das Aspektsystem (als grammatische Struktur) völlig aufgegeben11. Dieser
Vorgang wurde auch in Zusammenhang mit der Entwicklung des Systems des definiten Artikels
gestellt (vgl. Härd 2003: 2570)12. Doch nicht nur die Entwicklung eines Systems von definiten
Artikeln läuft parallel zum Verfall des Aspektsystems. Leiss (vgl. 2002: 75) hält fest, dass mit
dem Abbau eines Aspektsystems erst ein System von Modalverben entstehen kann. „Der
Umfang von Aspekt- und Modalverbsystemen verhält sich nach dieser These jeweils
umgekehrt proportional zueinander“ (Leiss 2002: 75). Es scheint also einen Zusammenhang
zwischen Aspekt und Modalität zu geben. Abraham (vgl. 2008: 187) betont (mit Verweis auf
Arbeiten von Elisabeth Leiss), dass eine enge Verknüpfung zwischen nicht-epistemischer
Modalität13 und perfektivem Aspekt einerseits und epistemischer Modalität und
imperfektivem Aspekt andererseits besteht.14
2.2.3 Tempus
Das Ahd. verfügt im Verhältnis zum Nhd. nur über zwei Tempora: Präsens und Präteritum. Das
Präteritum drückt Vergangenheit aus, das Präsens Gegenwart und Zukunft (vgl. Braune 2018:
11
Im Ahd. kann der (perfektive) Aspekt noch bspw. durch das Präfix gi- markiert werden (vgl. Schrodt 2004: 106).
Eine genauere Übersicht über die Aspekt- und Aktionsartfunktionen im Althochdeutschen (bzw. bei Otfrid) findet
sich bei Schrodt (vgl. 2004: 109–127).
12
Diese These beruht auf der Annahme, dass Definitheit und perfektiver Aspekt korrelieren und umgekehrt
Indefinitheit und imperfektiver Aspekt. Dadurch würden beide Phänomene (Definitheit und Aspekt) dieselbe
Funktion erfüllen (vgl. Härd 2003: 2570).
13
Er spricht hier von „Grundmodalität“.
14
Dieser Zusammenhang wurde in der vorliegenden Arbeit nicht systematisch überprüft und bedarf einer
separaten Spezialanalyse.
16351). Das indogermanische Tempussystem kann nicht vom Aspekt getrennt betrachtet
werden (siehe Abschnitt 2.2.2). Das Proto-Indogermanische markierte den Aspekt durch
spezielle Stammbildungen für das Präsens (eig. imperfektiver Aspekt), den Aorist (eig.
perfektiver Aspekt) und das Perfekt (eigentlich resultativer Aspekt als Spezialfall des
imperfektiven Aspektes), die dann einzelsprachlich zur Markierung von Zeitstufen (wie bspw.
im Lat. und den germanischen Sprachen) benutzt werden (vgl. Meiser 2010: 38f.). Zu diesen
Aspektstammbildungen konnte das Idg. drei Zeitstufen unterscheiden, die auch formal
markiert wurden: den Injunktiv (Zeitstufenlosigkeit), den Parontiv (Gegenwart) und das
Präteritum (Vergangenheit) (vgl. Meiser 2010: 39). Der Injunktiv wurde durch die einfachen
sog. Sekundärendungen gekennzeichnet, der Parontiv durch die Primärendungen15. Das
Präteritum wurde durch Sekundärendungen und ein Präfix *e-16 (Augment), das ursprünglich
ein Adverb mit der Bedeutung ‚damals‘ gewesen sein könnte (vgl. Meier-Brügger 2010: 315),
gebildet (vgl. Meiser 2010: 39). Fügte man also (bei einer athematischen Verbalbildung17) an
eine Verbalwurzel eine Sekundärendung, hatte man einen Injunktiv gebildet. Erweiterte man
diese Form nun um ein *-i oder *-s am Ende (vgl. Meiser 2010: 40), konnte man aus dem
Injunktiv den Parontiv bilden. Präfigierte man stattdessen den Injuktiv mit *(h1)é-, handelte es
sich um das Präteritum.
Wurzel: *h1es- (‚dasein, sein‘) (LIV 2001: 241)
Injunktiv: *h1es-m (1.P.Sg.)
Parontiv: *h1es-mi (1.P.Sg.Präs.)
Präteritum: *(h1)e-h1es-m (1.P.Sg.Imperf.)
Es ist wichtig festzuhalten, dass nicht von allen Aspektstämmen jedwede Zeitstufe abgeleitet
werden konnte. So konnten der Injunktiv und das Präteritum zu allen drei Aspektstämmen
gebildet werden, der Parontiv jedoch aus logisch-zeitstrukturellen18 Gründen nur zum Präsens
und Perfekt (also den imperfektiven Stämmen) (vgl. Meiser 2010: 39; vgl. auch Tab. 1)
15
Es handelt sich hier um durch *-i oder *-s erweiterte Sekundärendungen (vgl. Meiser 2010: 40).
16
Manchmal auch als *(h1)é- rekonstruiert (vgl. Meier-Brügger 2010: 315).
17
Bei thematischen Bildungen konnten noch allerlei Suffixe zwischen Wurzel und Endung auftreten (vgl. Meiser
42f.; 45f.)
18
Abgeschlossene Handlungen müssen zwangsweise in der Vergangenheit liegen.
172.3 Funktionen von Modalität
In der Forschung viel diskutiert sind auch die verschiedenen Funktionen von Modalität. Der
Ursprung dieses Forschungsdiskurses liegt in philosophischen Beschäftigungen mit
Modallogik19. Diese, die in ihrer modernen Ausformung auf C. I. Lewis zurückgeführt wird (vgl.
Hughes & Cresswell 1978: IX), gilt vor allem in ihrer Beschreibung bei von Wright (vgl. 1977)
als Grundlage für linguistische Forschung (vgl. Palmer 1979: 2). Grundlegend werden durch
die Modallogik die Wahrheitswerte (wahr und falsch) der Philosophie modifiziert und mit den
Modalbegriffen Notwendigkeit20, Möglichkeit, Unmöglichkeit und Kontingenz21 verknüpft (vgl.
Hughes & Cresswell 1978: 20). Weitaus näher ausgeführt und erweitert umfasst das System
von Wrights (vgl. 1977: 1) drei Hauptgruppen von Modalbegriffen: alethische, epistemische
und deontische (sowie eine mögliche vierte, die existentielle genannt wird). Innerhalb der
alethischen Gruppe finden sich die eben erwähnten Begriffe Notwendigkeit, Möglichkeit und
Kontingenz wieder. Die epistemischen Modi, die von Wright (1977: 1) auch als „Modi des
Wissens“ bezeichnet, umfassen das Verifizierte, das Unentschiedene und das Falsifizierte. Zur
letzten Hauptgruppe, jener der deontischen Modi, zählen das Gebotene, das Erlaubte und das
Verbotene (vgl. von Wright 1977: 1). Über das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen
Gruppen der Modi äußerst sich von Wright (vgl. 1977: 19f; 22ff.) ausführlich, für die
Darstellung in dieser Arbeit soll es jedoch genügen, darauf hinzuweisen, dass die einzelnen
Modalitäten nicht analog zueinander zu verstehen sind, d.h. in diesem Zusammenhang vor
allem, dass nicht alle Axiome der Logik von einem modalen System problemlos in das andere
überführbar sind.22 Vielmehr handelt es sich hierbei um einen Ausschnitt aus Logik der
Bedingungen, die „ihrerseits wiederum ein Ausschnitt aus der Modallogik“ ist (von Wright
1977: 21). Diese Theorie einer deontischen Logik ist für die linguistische Forschung insofern
von großer Relevanz, als sich diese, zunächst inhaltlich, vor allem aber terminologisch, direkt
an jene anschließt. In die Sprache wurden hauptsächlich die Kategorien der deontischen und
19
Die philosophischen Beschäftigungen stehen nicht im Fokus dieser Arbeit und sollen nur soweit für die
linguistische Beschäftigung grundlegend erwähnt und neure philosophische Theorien ausgeklammert werden.
20
Als notwendig werden innerhalb der Theorie von Hughes & Cresswell (vgl. 1978: 19f.) nur Aussagen
verstanden, die unabhängig von den Gegebenheiten der Welt unbedingt notwendig sind. Als Beispiel wird hier
bspw. „alle Junggesellen [sind] unverheiratet“ angeführt (Hughes & Cresswell 1978: 19).
21
Als kontingent wird alles bezeichnet, das nicht notwendig, aber auch nicht unmöglich ist. Es handelt sich hier
also um den Bereich der Möglichkeit, in dem Notwendigkeit ausgeschlossen ist (vgl. Hughes & Cresswell 1978:
19)
22
Von Wright (vgl. 1977: 19) weist bspw. darauf hin, dass das „Prinzip Np→ p der Modallogik [in der deontischen
Logik] fehlt: Was notwendigerweise der Fall ist, ist der Fall; was hingegen der Fall sein soll, ist nicht
notwendigerweise auch der Fall.
18epistemischen Modi übernommen, die alethischen Modi wurden hier ausgeklammert, da sie
in der Sprache kaum Anwendung finden (vgl. Palmer 1979: 3). Diese finden sich seit den
frühesten Beschäftigungen der Sprachwissenschaft in unterschiedlicher Terminologie und
unterschiedlicher Ausprägung im Wesentlichen wieder. Die folgende kurze Zusammenschau
berücksichtigt neben germanistischen Arbeiten besonders Untersuchungen zur englischen
Sprache, die sich besonders intensiv mit Modalität auseinandersetzen.
Halliday (vgl. 1970: 338) unterteilt grundlegend in modality und modulation. Modality drückt
hier „speakers comments“ aus, während modulation „conditions of the process referred to“
widerspiegelt (Halliday 1970: 338). Calbert (vgl. 1975: 16) teilt die Verwendungsweisen von
Modalverben in inferential und non-inferential23, je nachdem, ob etwas schlussgefolgert wird
oder nicht. Palmer (vgl. 1974: 102f.) unterscheidet grundlegend zwischen epistemic und non-
epistemic, während die Gruppe der nicht-epistemischen Modi noch in subject oriented und
discourse oriented unterschieden wird (vgl. Palmer 1974: 103). In seinem späteren Werk (vgl.
Palmer 1979: 35–39) verweist Palmer auf die Unschärfen dieser Theorie und schlägt eine
alternative Trennung in epistemische, deontische (die discourse oriented ersetzt) und
dynamische – die noch in neutral und subject oriented untergliedert wird24 – vor (vgl. Palmer
1979: 36f.). Lyons (vgl. 1977: 841) unterscheidet im Wesentlichen ähnlich zwischen
epistemischer und deontischer Modalität. Coates (vgl. 1983: 21) kritisiert Palmers Theorie,
einerseits weil der Begriff deontisch sich in der Logik nur auf „obligation and permission“
beziehe, nicht-epistemische Modalität jedoch ein größeres Spektrum an Bedeutungen
aufweise, und andererseits, da die Unterteilung hierbei mitunter zu Problemen führe. Sie
entwirft ein neues Modell, das die Kategorie epistemic beibehält, alle nicht-epistemischen
Verwendungsweisen jedoch als root modality25 bezeichnet (vgl. Coates 1983: 20). Eine
gänzlich andere Einteilung trifft Brinkmann (vgl. 1971: 360), der für die Modalverben die
Gruppen Realisierung und Information einteilt. Innerhalb der Realisierung „werden
Voraussetzungen für eine Realisierung formuliert“, während durch die Information „die
Geltung von Information“ wiedergegeben wird (Brinkmann 1971: 360).
23
Zu Englisch to infere ‚schließen, folgern‘ (Nehls 1986: 6, Anm. 12).
24
Es werden auch Überlegungen zu einer circumstantial modality getätigt, die in der Phrase have (got)
to Ausdruck findet (vgl. Palmer 1979: 37).
25
Ein Terminus, der auch sonst weit verbreitet ist und für den im Deutschen der Begriff Grundmodalität
verwendet wird (vgl. bspw. Abraham 2008; u.a. Abraham & Leiss 2013)
19Einer wiederum anderen Terminologie und Einteilung bedienen sich Quirk et al. (vgl. 1985:
219). Hier wird zwischen intrinsic und extrinsic unterschieden, je nachdem, ob die Kontrolle
über die Vorgänge bei Menschen liegt oder nicht. Die epistemische Verwendungsweise
rechnen Quirk et al. (vgl. 1985: 220; 221) als Subkategorie der extrinsic modality. Nehls (1986),
der eine gute Übersicht über die bis dahin getätigte Forschung gibt (vgl. Nehls 1986: 6),
erweitert das Spektrum der Bezeichnungen um die Begriffe handlungsorientiert und
wahrscheinlichkeitsorientiert. Handlungsorientiert entspricht hier der nicht-epistemischen
Verwendung und wahrscheinlichkeitsorientiert der epistemischen. Diese Begrifflichkeit
basiert auf der Idee, dass es sich bei den zwei Typen nicht um absolute Gegensätze, sondern
lediglich um Tendenzen handelt (vgl. Nehls 1986: 9). Eine weitere, noch umfassendere
Darstellung der unterschiedlichen Terminologien gibt Öhlschläger (vgl. 1989: 28), der seine
kritische Analyse der Erforschung von Modalverben auch in die Kategorien nicht-epistemisch
und epistemisch einteilt und zu dem Schluss kommt, dass die nicht-epistemischen
Verwendungen von Modalverben eine einheitliche Bedeutung26 haben (vgl. Öhlschläger 1989:
183). Besonders bemerkenswert an Öhlschlägers (vgl. 1989: 192ff.; 197ff.) Arbeit ist, dass sie
innerhalb der epistemischen Verwendung zwischen objektiv-epistemischem und subjektiv-
epistemischem Gebrauch unterscheidet, die darin verschieden sind, dass Erstere auf streng
logischen Folgerungen beruhen, Zweitere nicht. Diewald (vgl. 1999: 13), die sich mit
Grammatikalisierungsprozessen von Modalverben beschäftigt hat, unterscheidet einen nicht-
deiktischen (auch lexikalischen bzw. weniger grammatikalisierten) Gebrauch und einen
deiktischen (grammatischen bzw. grammatikalisierten) Gebrauch. Diese Einteilung beruht
darauf, dass Diewald davon ausgeht, dass sich die beiden Verwendungsweisen „vorrangig
durch das Merkmal der Deiktizität unterscheiden“ (Diewald 1999: 13). Der nicht-deiktische
Gebrauch wird hier noch weiter in deontisch, volitiv und dispositionell unterteilt (vgl. Diewald
1999: 75). Engels (vgl. 2004: 245) Deutsche Grammatik spricht im Zusammenhang mit
Modalverben von subjektbezogenem Gebrauch und sprecherbezogenem Gebrauch, da bei der
einen Verwendung ein Bezug zum Subjekt (bzw. zu den Handlungen des Subjekts) hergestellt
wird, bei der anderen jedoch ein Bezug zum Sprecher (bzw. seinen Vorstellungen).
Ein großer Umbruch in der Modalitätsforschung geschah durch die Untersuchungen von
Kratzer (vgl. 1981: 42), die das Konzept des Redehintergrundes in der Wissenschaft etablierte.
26
Von zwei Bedeutungen geht er bei können und mögen aus; sollen, wollen und mögen weisen Sonderfälle auf
(vgl. Öhlschläger 1989: 183).
20Dieses basiert auf dem Modell der possible-worlds semantics. In Kratzers System (vgl. 1981:
42) sind Modalverben durch zwei Faktoren zu beschreiben: Redehintergrund (conversational
background) und modal force (vgl. Kratzer 1991: 649; Kratzer 1981: 51 spricht hier von modal
relation). Der Redehintergrund „contributes to the premises from which conclusions are
drawn“ und die modal force/relation „determines the ‚force‘ of the conclusion [H.i.O.]“
(Kratzer 1981: 42). Hierbei spielen für jeden modalen Ausdruck zwei Redehintergründe eine
Rolle. Zum einen die modal base und zum anderen die ordering source (Kratzer 1981: 47; 1991:
644). Die „modal notions“ eines Modalausdrucks nun sind „doubly relative“, sie sind von
diesen beiden Redehintergründen abhängig (Kratzer 1991: 644). Kratzer definiert über die
logischen Zusammenhänge dieser Relationen folgende modal forces: necessity, weak
necessity, good possibility, possibility, at least as good as a possibility, better possibility sowie
slight possibility und weist darauf hin, dass es zusätzlich auch noch andere geben könnte
(Kratzer 1991: 649). Insgesamt lassen sich modale Ausdrücke also in drei Dimensionen fassen:
in der modal base, einem Redehintergrund der entweder epistemic oder circumstantial27 sein
kann28, der ordering source, einem weiteren Redehintergrund, der den Zugriff auf die
möglichen Welten ordnet, sowie der modal force (vgl. Kratzer 1991: 649). Wichtig hierbei ist,
dass nicht alle modal bases mit allen ordering sources kompatibel sind. So verbinden sich mit
der epistemic modal base Redehintergründe „related to information“, während sich zur
circumstantial modal base „ordering sources realted to laws, aims, plans, wishes“ gesellen
(Kratzer 1991: 649). Als mögliche Redehintergründe nennt Kratzer (vgl. 1981: 44f.) bspw.
realistic (‚auf Fakten bezogen‘), totally realistic (‚was Sache ist‘), epistemic (‚was gewusst
wird‘), stereotypical (‚übliche Abläufe‘), deontic (‚Aufforderung‘), teleological (‚auf ein Ziel
gerichtet‘), buletisch (‚Wünsche‘) und empty.
Die IDS-Grammatik (vgl. Zifonun et al. 1887: 1886) übernimmt im Wesentlichen dieses System.
Für eine (vereinfacht dargestellte) Beschreibung der Verwendungsweisen von Modalverben
werden hier folgende Typen von Redehintergründen unterschieden: der epistemische
Redehintergrund (RH), der zusätzlich den Untertyp stereotypischer RH aufweist, der normative
RH, der teleologische RH, der volitive RH sowie der circumstantielle RH, innerhalb dessen noch
zwischen extrasubjektiv-circumstantiell und intrasubjektiv-circumstantiell unterschieden wird
27
Diese beiden kongruieren laut Kratzer (1991: 650) mit den Begriffen root and epistemic aus früheren
Untersuchungen.
28
Kartzer (vgl. 1991: 649) merkt an, dass innerhalb dieser Großgruppen noch weitere Unterklassifikationen
möglich sein könnten.
21(vgl. Zifonun et al. 1997: 1884). Jedem Modalverb werden hier verschiedene
Verwendungsweisen nach diesen Redehintergründen zugewiesen (vgl. Zifonun et al. 1997:
1888ff.).
von Wright (1977) deontisch epistemisch
Halliday (1970) modulation modality
Brinkmann (1971) Realisierung Information
Palmer (1974) non-epistemic epistemic
subject o. discourse o.
Palmer (1979) dynamic deontic epistemic
neutral subjec o.
Calbert (1975) non inferential inferential
Coates (1983) root epistemic
Quirk et al. (1985) intrinsic extrinsic
Nehls (1986) handlungsorientiert wahrscheinlichkeitsorientiert
Kratzer (1991) circumstantial (modal base) epistemic (modal base)
nicht-epistemisch epistemisch
Zifonun et al. (1997) norm. tele. voli. circum. stereotypisch
extrasub. intrasub.
Diewald (1999) nicht-deiktisch (weniger grammatikalisiert) deiktisch (grammatikalisiert)
Engel (2004) subjektbezogen sprecherbezogen
Tabelle 2: Übersicht über die beschriebenen Modalitätskonzepte (für weitere Begriffe siehe Milan 2001: 35).
222.4 Modalverben allgemein
In Kapitel 2.1 wurde gezeigt, dass es in der deutschen Gegenwartssprache (wie auch in deren
historischen Sprachstufen) multiple Möglichkeiten gibt, um Modalität auszudrücken. Eine
dieser Möglichkeiten steht in dieser Arbeit im Fokus der Aufmerksamkeit: die Realisierung von
Modalität mithilfe von sog. Modalverben. Nun mag die Frage, welche deutschen Verben zu
den Modalverben zu zählen sind, trivial erscheinen, in diesem Abschnitt soll jedoch gezeigt
werden, dass sich die Abgrenzung zwischen Modalverben und anderen Verben im Umfeld von
Modalität oft nicht einfach gestaltet, weshalb in der Wissenschaft viel Uneinigkeit darüber
besteht, welche Verben als Modalverben zu klassifizieren sind, bzw. wie die den Modalverben
ähnlichen Verben zu benennen sind.
Die meisten der traditionell als Modalverben bezeichneten Verben müssen, sollen, dürfen,
mögen/möchte und können sind diachron betrachtet sog. Präteritopräsentia (vgl. Zifonun et
al. 1997: 53). Das bedeutet, dass es sich beim Präsens dieser Verben um ein formales
Präteritum handelt, das eine präsentische Bedeutung aufweist. Sie werden in der
Indogermanistik aufgrund der Zurückführbarkeit des deutschen Präteritums auf das idg.
Perfekt auch als Perfektopräsentia bezeichnet29 (vgl. Braune 2018: 420). Diese flektieren auch
im Ahd. weitgehend analog zum Präteritum der starken Verben und bilden ein neues
Präteritum nach dem Vorbild der schwachen Verben (vgl. Braune 2018: 420). Zu den
Präteritopräsentia gehören im Ahd.30 wizzan (Inf.; Abl. I), eigan ‚besitzt‘ (Part. II; Abl. I), toug
‚es hilft, es nützt‘ (3.P.Sg.Prä.; Abl. II), unnan ‚gönnen‘ (Inf.; Abl. III), kunnan ‚wissen, können‘
(Inf.; Abl. III), durfan ‚nötig haben, bedürfen‘ (Inf.; Abl. III), gitar ‚ich wage‘ (1.P.Sg.Präs.; Abl.
III), skolan/skulan (Inf.; Abl. IV), ginah ‚es genügt‘ (3.P.Sg.Präs.; Abl. IV), magan/mugan
‚können, vermögen (Inf.; Abl. V) und muoʒ ‚ich habe Gelegenheit, ich mag‘ (1.P.Sg.Präs.; Abl.
VI) (vgl. Braune 2018: 420–424). Von diesen flektieren nhd. nur noch wissen, können, dürfen,
sollen, mögen und müssen nach dem Flexionsschema der Präteritopräsentia und weisen
darum die von Öhlschläger (1989: 4) als „Besonderheiten in der Flexion“ der Modalverben
bezeichneten Merkmale auf. So haben die 1. und 3. P. Sg. Ind. Präs. keine Endung (analog zum
29
Dieses Phänomen findet sich auch in anderen indogermanischen Sprachen. Vgl. bspw. altgriechisch οἶδα (‚ich
weiß‘) Perfekt zu idg. *u̯ ei ̯d- (‚erblicken‘). Dazu auch got. wait (‚wissen‘) (vgl. LIV 2001: 666) und ahd. wizzan (vgl.
Köbler 2014: s. v. wizzan*).
30
In Klammern ist die jeweilige grammatische Form sowie die Ablautreihe der Verben angegeben.
23Präteritum der starken Verben)31, einen Wechsel im Stammvokal zwischen Singular und Plural
im Ind. Präs.32 und einen Vokalwechsel zwischen Präs. und Infinitiv. Diese Eigenschaften
finden sich in der synchronen Betrachtung des Neuhochdeutschen nicht bei allen
Präteritopräsentia wieder, was durch verschiedene Lautwandel- und Ausgleichsprozesse
bedingt ist. So gibt es bspw. im Paradigma von sollen keinen Vokalwechsel mehr im Ind. Präs.33
(vgl. Öhlschläger 1989: 4). Im Fall von sollen ist dieser Vokalwechsel im Ahd. aber sehr wohl
noch erhalten.34
Das zweite Merkmal, das laut Öhlschläger (vgl. 1989: 4) als eine Möglichkeit angeführt wird,
ein Verb zu einem Modalverb zu machen, ist das Fehlen eines Imperativs, da dieser „vom
Präsensstamm gebildet (wird), der ja bei ihnen [den Präteritopräsentia] verlorengegangen ist“
(Nehls 1986: 19). Dieses Kriterium führen auch Zifonun et al. (vgl. 1997: 1253) als Merkmal
von Modalverben an.
Nach Öhlschläger (vgl. 1989: 4) wird überdies erwähnt, dass Modalverben kein Passiv bilden
können35, er räumt jedoch ein, dass dieses Kriterium nicht uneingeschränkt gelte (vgl.
Öhlschläger 1989: 5). Zifonun et al. (vgl. 1997 1253) und Nehls (vgl. 1986: 17ff.) erwähnen
dieses Kriterium nicht und ist es überhaupt überaus fraglich.36 Dieses Merkmal ergibt sich
wohl daraus, dass Modalverben erst spät ein Partizip II bilden (vgl. Brünner & Redder 1983:
16; Nehls 1986: 19), das ja zur Bildung des Passivs gebraucht wird. Aus diesem Grund werden
auch das Perfekt und Plusquamperfekt von Modalverben mitunter nicht mit dem Partizip II,
sondern mit dem Infinitiv gebildet (vgl. Nehls 1986: 19).
31
(Ich) soll-Ø = er soll-Ø vgl. zu (ich) tat-Ø = (er) tat-Ø.
32
(ich) darf – (wir) durften. Dieser Wechsel ist auf den Wechsel zwischen o-Stufe und Schwundstufe bzw. eine
Reduplikation im indogermanischen Perfekt, auf dem das deutsche Präteritum basiert, zurückzuführen (vgl. Meid
1983: 329; 333).
33
(ich) soll – (wir) sollen
34
(ih) scal – (wir) sculun (vgl. Braune 2018: 423).
35
Vgl. auch Brünner & Redder 1983: 17, die dieses Argument mit „gewöhnlich“ abschwächen.
36
Das zeigt schon eine kurze Korpusabfrage in den DWDS Kernkorpora (vgl. DWDS 2021): „[...]
und zwar auf die Differenzierung zwischen einer Grundeinstellung gegenüber der objektiven Welt
dessen, was der Fall ist, und einer Grundeinstellung gegenüber der sozialen Welt dessen, was legitimerweise er
wartet werden darf, was geboten oder gesollt ist.“ (Habermas 1981: 80). oder
„Ungarn habe schon einmal, nach dem Jahr 1919, gezeigt, daß es die Nation von ordnungsstörenden
Elementen säubern könne, und er könne dem Land die Versicherung geben, daß von dem, was damals gekonnt
wurde, nichts vergessen worden sei“ (Archiv der Gegenwart 2001 [1938]). [beides DWDS]
24Sie können auch lesen