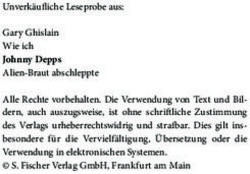Welche Diakonie brauchen wir?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
Vortrag am 04.06.2011 auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden
im Rahmen der Veranstaltung „Welche Diakonie brauchen wir?. Gemeinwesen-
diakonie - verfasste Diakonie - politische Diakonie?“:
Welche Diakonie brauchen wir?
von Reiner Anselm
Wer eine klare Frage stellt, erwartet eine deutliche Antwort. Darum möchte ich
Sie auch nicht mit langen Vorbemerkungen quälen, sondern Ihnen direkt meine
Antwort präsentieren: Ich möchte eine glaubwürdige Diakonie, die sich als christ-
lich motivierte Liebestätigkeit begreift und dabei den Unterschied zwischen Ge-
rechtigkeit und Barmherzigkeit selbst beachtet und zugleich öffentlich einzuschär-
fen hilft.
Wir brauchen eine glaubwürdige Diakonie. Die Glaubwürdigkeit ist das wichtigs-
te Kapital der Diakonie. Nach wie vor wird der Diakonie ein enormer Vertrauens-
vorschuss entgegengebracht, auch wenn er vielleicht durch die Missbrauchskanda-
le, insbesondere im Heimerziehungsbereich, in der jüngsten Vergangenheit gelit-
ten haben könnte. Mehr als alle anderen Tätigkeitsbereiche wird die Hinwendung
zu den Bedürftigen, zu den sozial, psychisch und physisch Schwachen als Kern-
aufgabe der Kirchen gesehen. Wie die letzte Mitgliedschaftsuntersuchung deutlich
gemacht hat, gilt das auch für die Konfessionslosen. Glaubwürdigkeit ist damit
nicht nur ein Kapital für die Diakonie, sondern auch für die Kirche.
Glaubwürdigkeit hat viel stimmigem Handeln zu tun. Nur wer deutlich machen
kann, dass er sich auch selbst an die Standards hält, die er gegenüber anderen ein-
fordert, wird auf Dauer glaubwürdig bleiben. Doch das ist nur die eine Seite. Denn
gleichzeitig gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem eigenen Tun
und dem als glaubwürdig erlebt werden: Glaubwürdig ist man in den Augen ande-
rer, das eigene Handeln ist zwar eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man2 glaubwürdig erscheint, kann dieses Bild aber nicht selbst herstellen. Dies asymme- trische Struktur begründet, warum es so schwierig ist, eine einmal verloren gegan- gene Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Umso problematischer erscheint es mir, dass diese Glaubwürdigkeit durch ein unklares, vor allem inkonsistentes Ver- halten aufs Spiel gesetzt wird. Die Glaubwürdigkeit der Diakonie scheint mir dabei nicht allein durch die nun ans Licht gekommenen Verfehlungen der Vergangenheit bedroht. Schwerer wiegt in meinen Augen, dass das unklare Verhältnis zur Kirche und die daraus erwachse- nen Unklarheiten in der eigenen Positionierung die Glaubwürdigkeit der Diakonie nachhaltig zu unterwandern drohen. Hier ist eine Neubesinnung auf den Charakter der Diakonie als christlicher Liebestätigkeit vonnöten. Wolfgang Huber hatte schon 1998 darauf hingewiesen, dass die zunehmende Positionierung als Sozial- unternehmungen die Legitimität der Diakonie zu unterminieren drohe. Mit seinen Worten: „Ursprünglich aus der Liebestätigkeit christlicher Gemeinden herausge- wachsen, hat sich die Diakonie zu einer großen, verselbständigen Institution ent- wickelt. Die innere Verbindung von Kirche und Diakonie hat darunter gelitten; sie muss neu geknüpft werden. Denn nur dann verfügt die Diakonie über eine Legiti- mation, die sich nicht nur aus dem sozialstaatlichen Subsidiaritätsprinzip, sondern aus dem eigenständigen Auftrag der Kirche ergibt“.1 Eine solche Legitimation der Diakonie als Teil des kirchlichen Auftrags und des kirchlichen Handelns ist nun aber keineswegs nur der Eitelkeit der Organisation Kirche geschuldet, die auch am Glanz der gesellschaftlich stärker akzeptierten Diakonie teilhaben möchte. Vielmehr muss eine solche Legitimation des eigenen Tuns als klar identifizierbarer Teil der Kirche im ureigensten Interesse der Diako- nie liegen, weil sich sonst die organisationsrechtlichen Besonderheiten, von denen die Diakonie profitiert, schnell als Bumerang erweisen können: Alle Vorteile, die aus der Inanspruchnahme des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts für die Diako- nie resultieren, insbesondere im Arbeitsrecht, sind nur solange legitim, solange 1 Wolfgang Huber: Kirche in der Zeitenwende. Gesellschaftlicher Wandel und Erneuerung der Kirche, Gütersloh 1989, 321.
3 sich diakonisches Handeln als genuiner und vom sozialstaatlichen Pflichtangebot klar geschiedener Teil kirchlicher Verkündigung identifizieren lässt. So gibt es etwa in diakonischen Unternehmungen mit Verweis auf das kirchliche Selbstbe- stimmungsrecht kein Streikrecht – man versteht sich als eine Dienstgemeinschaft in der Nachfolge Jesu, bei der es kein Gegenüber von Arbeitnehmern und Arbeit- gebern gibt, sondern nur gleichberechtigte Mitarbeiter, die gemeinsam die Ge- meinschaft nach dem Vorbild der Glieder am Leib Christi, nach Vorbild des Ko- losserbriefes, bilden. Dieses ist solange vollkommen in Ordnung, solange die in- ternen Organisationsstrukturen diesem Gemeinschaftsgedanken auch wirklich Rechnung tragen und das diakonische Handeln tatsächlich ein Teil der Verkündi- gung darstellt – wer wollte hier von einem Streikrecht ausgehen? Sobald sie je- doch als Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Trägern in Anspruch gebracht werden, etwa bei Klinikübernahmen, drohen sie die Legitimität und die Glaub- würdigkeit nicht nur diakonischen, sondern des kirchlichen Engagements für den Nächsten überhaupt zu unterminieren. Besonders deutlich wird dies, wenn gleich- zeitig von Vertretern der Diakonie die mit der Privatisierung des sozialen Sektors verbundenen Entwicklungen und der damit verbundene Wettbewerb kritisiert wer- den. Die Liste der sich hier anschließenden Probleme ist lang, ich nenne nur kurz und ohne Anspruch auf Vollständigkeit das bereits kurz angesprochene Span- nungsfeld zwischen der Rede von der Dienstgemeinschaft und einer eben doch existierenden, oft erheblichen Lohnspreizung innerhalb der Unternehmungen,2 die Problematik von Ausgründungen in diakonischen Unternehmen zum Umgehen der tarifrechtlichen Regelungen aber auch das Eingehen von problematischen Kompromissen mit den Kommunen, wenn es etwa um das evangelische Profil von Kindertagesstätten geht. Schließlich zeugt es auch nicht gerade von einer glaub- würdigen Realisierung eigener christlicher Liebestätigkeit, wenn – von Seiten der Diakonie – immer wieder beklagt wird, dass in den staatlichen Kostenrahmen eine entsprechende Zuwendung zu den Pflegebedürftigen nicht vorgesehen ist. Diakonie kann ihre Sonderstellung nur dann mit Recht beanspruchen, wenn sie bewusst und profiliert sich abgrenzt von einer allgemeinen Sozialstaatstätigkeit, 2 Vgl. dazu ausführlicher die Beiträge in Reiner Anselm und Jan Hermelink (Hg.): Der Dritte Weg auf dem Prüfstand, Göttingen 2006
4 auch wenn die Eingliederung der Diakonie in das sozialstaatliche Handeln den steilen Aufstieg der Diakonie allererst möglich gemacht hat. Diese Abgrenzung dient ihrer eigenen Legitimation, sie dient aber, und damit bin ich beim dritten Element meiner Eingangsthese, auch einer klareren Abgrenzung zwischen dem aus Gerechtigkeit gebotenen und dem aus Barmherzigkeit resultierenden Handeln. Worin besteht der Unterschied: Während das, was aus der Gerechtigkeit resultiert, notfalls auch gerichtlich eingeklagt werden kann, besteht auf das, was aus Barm- herzigkeit geschieht, allenfalls ein moralischer Anspruch.3 Diese Differenz ist im Interesse der Betroffenen deutlich zu markieren – und gleichzeitig droht diakoni- sches Engagement ebendiese Differenz zu unterlaufen. So stellen Sozialleistungen in der Bundesrepublik kein Almosen dar, sondern die Betroffenen haben einen verfassungsmäßig verbrieften und gesetzlich abgesicherten Anspruch auf diese Leistungen. Diakonisches Engagement darf diesen Anspruch nicht verdecken und ihn – ungewollt bzw. in bester Absicht – relativieren. Bei allen Dingen, die aus der Gerechtigkeit resultieren, ist zunächst der Staat in der Pflicht und er sollte hier auch maßgeblicher Akteur sein. Denn er allein verfügt über die Möglichkeiten, die Ressourcen dafür, die ja verpflichtend aufzuwenden sind, nötigenfalls mit Zwangsgewalt einzutreiben. Unbeschadet dieser grundsätzlichen Zuständigkeit kann das Gemeinwesen natürlich, im Sinne des Gemeinwohlpluralismus, sein En- gagement durchaus Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft überlassen, dann aber sollte auch klar sein, dass die entsprechenden Leistungen nur stellvertretend durch diese Träger für den Staat erbracht werden und keine genuinen Äußerungs- formen des Christentums darstellen. In diesem Fall ist es aber weder sinnvoll noch legitim, unter Verweis auf das kirchliche Selbstbestimmungsrecht etc. zu agieren und gegenüber anderen Leistungserbringern – in denen ja durchaus auch Christin- nen und Christen tätig sein können und tätig sind – die daraus resultierenden Vor- teile in Anspruch zu nehmen. Ebenso erscheint es in solchen Fällen als durchaus problematisch, von den eigenen Beschäftigten die Mitgliedschaft in einer christli- chen Kirche zu verlangen, eine Problematik, die ja gerade in den östlichen Bun- desländern nicht unbekannt ist. 3 Vgl. zu dieser Unterscheidung und den daraus resultierenden Konsequenzen bes. auch Otfried Höffe: Gerechtigkeit, München 32007.
5 Zwischen den aus der Gerechtigkeit gebotenen und den aus Barmherzigkeit resul- tierenden Leistungen zu unterscheiden erscheint auch deshalb angebracht, weil es durchaus legitim ist, für die durch den Staat verpflichtend geschuldeten Leistun- gen eine Gegenleistung zu verlangen. Die Architektur von „Hartz IV“ sucht die- sem Gedanken Rechnung zu tragen. Noch einmal: Staatliche Daseinsvorsorge ist kein Geschenk und kein Almosen, für das man keine Gegenleistung erwarten dürf- te, sondern eine sich aus dem Gedanken der Gerechtigkeit ergebende Pflicht. Auf- gabe diakonischen Handelns in diesem Kontext ist es darum, den Staat – und das heißt in einem demokratischen Gemeinwesen: die Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass die Unterstützung von Schwachen eine Pflichtaufgabe des modernen Rechtstaates und keine Wohltätigkeit eines paternalistisch organisierten Gemein- wesens darstellt. Dieser Aspekt ist gemeint, wenn ich davon spreche, dass es zum erstrebenswerten Profil der Diakonie gehört, den Unterschied zwischen Gerechtig- keit und Barmherzigkeit nicht nur selbst zu beachten, sondern auch öffentlich im- mer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Dazu gehört es, sich durchaus auch aus Ar- beitsgebieten zurückzuziehen, die in den Kernaufgabenbereich des Sozialstaats gehören, etwa im Blick auf das Bereitstellen von Kinderbetreuungsplätzen, wenn damit nicht eine über die auch durch staatliche Finanzierung gesicherte Versor- gung mit Kinderbetreuungsplätzen hinausgehendes, klar dem Verkündungsauftrag der Kirche zugeordnetes Engagement verbunden ist. Nur wenn man zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unterscheidet, kommt auch in den Blick, dass es neben den Aufgaben staatlicher Wohlfahrtspflege noch zahlreiche Gebiete sozialdiakonischen Engagements gibt, die über die einklagba- ren Rechte hinausgehen, die aber dennoch unbedingt wünschenswert sind. Das gilt etwa da, wo Menschen durchaus in Ausübung ihrer Freiheit in Not geraten sind und daher nur bedingt Anspruch auf Unterstützung durch den Staat haben, sei es durch das Eingehen von unternehmerischen Risiken oder aber auch durch geschei- terte Beziehungen. Es gilt aber auch da, wo sich die Not nicht auf materielle Fra- gen reduzieren lässt, sondern wo es um Zuwendung und Wertschätzung geht. Bei- des kann der Staat nicht gewährleisten, er kann zwar effektiv Ressourcen verteilen und materielle Not lindern, aber er kann – um es knapp und pointiert zu sagen –
6 nicht lieben. Genau darum bringt in meinen Augen die etwas altmodische Rede als der christlichen Liebestätigkeit deren eigenständiges Profil gut zum Ausdruck. Diese Unterscheidung zwischen staatlichem und diakonischem Handeln sollte der Fokus für eine Weiterentwicklung der Diakonie sein, die sich in ihrem Handeln stärker auf ihre – auch finanzielle – Unabhängigkeit gegenüber dem Staat besin- nen sollte, ohne das Gemeinwesen aus seinen Pflichten zu entlassen. Umgekehrt aber sollte auch die Diakonie sich nicht damit zufrieden geben, die durch den Staat vorgegebenen Rahmenbedingungen des eigenen Handelns zu problematisie- ren, sondern kreativ nach neuen Möglichkeiten der Profilierung und der Weiter- entwicklung ihres aus der durch die Liebe Gottes an uns Christen motivierten Auf- trags zur Nächstenliebe auch unter den Bedingungen eines modernen Sozialstaats suchen.
Sie können auch lesen