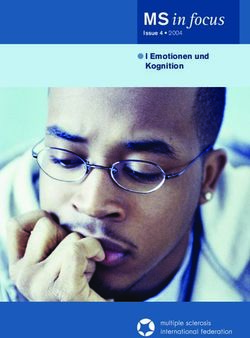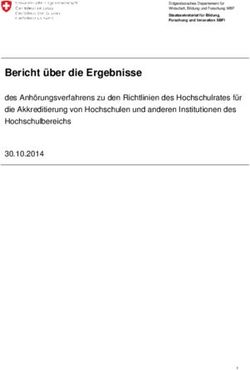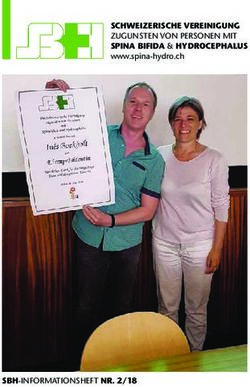Welt-Aids-Tag Dossier 2014
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt 3 Einleitung 3 HIV – unter Kontrolle? 3 Betroffene weiterhin stigmatisiert 3 HIV darf nicht verharmlost werden! 4 Die Entwicklung in der Schweiz 5 Statements zum Welt-Aids-Tag 2014 11 Factsheet: Menschen mit HIV 11 Die globale HIV Epidemie (gemäss UNAIDS-Angaben) 11 Die Epidemie in der Schweiz (gemäss BAG-Angaben) 11 Soziale Situation der HIV-positiven Personen in der Schweiz 12 Herausforderungen der HIV-Arbeit heute 13 Was tut die Aids-Hilfe Schweiz für die Zielgrupe der Menschen mit HIV? 14 Die Aids-Hilfe Schweiz 14 Die Ziele der Aids-Hilfe Schweiz 15 HIV 2020: Ausblick und Hoffnung 16 Diskriminierungen im HIV-Bereich 16 Anzahl und Bereiche der gemeldeten Diskriminierungen von 2010 bis 2014 18 Keine Rechtfertigung von Berufsverboten für HIV-positive Arbeitnehmende 19 Interview mit und Portraits von HIV-positiven Menschen 27 Interviews mit Fachpersonen aus dem Bereich HIV 27 Fana Asefaw, Oberärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 29 Franziska Schöni-Affolter, Epidemiologin in der HIV/Aids-Forschung 31 Stephan Dietiker, Psychologe und Psychotherapeut Checkpoint Zürich 34 Hinweise und Kontakte Herausgeberin: Aids-Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, www.aids.ch Illustrationen: © Aids-Hilfe Schweiz / Daniel Müller, Zürich 2 WAT Dossier 2014
Einleitung Welt-Aids-Tag 2014 Der 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag! Menschen auf der ganzen Welt sind dazu aufge- fordert, aktiv zu werden im Kampf gegen Aids und ihre Solidarität gegenüber Menschen mit HIV zu zeigen. HIV – unter Kontrolle? Zuerst die gute Nachricht: Heute bedeutet eine HIV-Infektion nicht mehr eine tödliche Bedrohung. Die Lebenserwartung für Menschen mit HIV gleicht sich immer mehr der- jenigen der Allgemeinbevölkerung an. Auch eine erfüllte Sexualität ist möglich und einem Kinderwunsch steht nichts mehr im Wege. Über 80% der HIV-positiven Menschen sind im Arbeitsalltag integriert. Ein Blick zurück: Mitte der 90er-Jahre kamen wirksame HIV-Medikamente auf den Markt. Kam früher eine HIV-Infektion einem Todesurteil gleich, wurde die Krankheit ab Mitte der 90-er Jahre mit der Entwicklung wirksamer HIV-Medikamente, immer kontrollierbarer. Was im kollektiven Gedächtnis haften blieb, sind die Schreckensbilder der 80er-Jahre. In Europa und der Schweiz hat sich die Situation aber drastisch verändert: heute stehen über 25 HIV-Wirkstoffe zur Verfügung. Dank den medizinischen Fortschritten konnten Menschen mit HIV und AIDS ihre Lebensperspektive zurück-gewinnen. Doch in ärmeren Regionen unserer Welt ist Aids immer noch eine nicht kontrollierbare Epidemie, die Familien und Menschen ins Elend stürzt. Betroffene weiterhin stigmatisiert Was wie eine Erfolgsgeschichte aussieht, hat auch seine Schattenseiten. Noch immer ziehen sich Freunde und Partnerinnen und Partner von Betroffenen zurück, wenn sie von deren HIV-Infektion erfahren. Von einer Normalisierung sind wir immer noch weit entfernt. Obwohl die meisten HIV-positiven Menschen unter Therapie nicht mehr infektiös sind, ver- hindern Angst und Vorurteile einen schuldfreien und befreiten Umgang im Alltag und mit der Sexualität. Auch ausserhalb von Beziehungen sind mit der Infektion lebende Menschen noch immer von missbräuchlichen Kündigungen, Mobbing am Arbeitsplatz und Versicherungsausschluss bedroht. Reisen ins Ausland können auch heute noch zu einem Spiessrutenlauf werden. Ein realistischer Umgang mit der chronischen Krankheit wird uns erst gelingen, wenn Betroffene angstfrei über ihre Infektion sprechen können. HIV darf nicht verharmlost werden! Eine Infektion mit dem HI-Virus ist eine schwere chronische Krankheit, die ein komplexes Behandlungsregime benötigt und einen Menschen sein Leben lang von der Behandlung abhängig macht. Eine Heilung ist weiterhin nicht in Sicht. Für Betroffene und ihre Ange- hörigen ist die Infektion eine Belastung. Zudem stört die Diagnose HIV das Intimste, was Menschen erfahren können: Liebe, Beziehungen und die Sexualität. 3 WAT Dossier 2014
Die Entwicklung in der Schweiz Heute leben knapp 25‘000 Menschen mit HIV in der Schweiz. Die Zahlen der Neuin- fektionen sind stabil auf einem hohen Niveau. Pro Jahr stecken sich rund 600 Menschen neu mit dem HI-Virus an. Die Gesamtzahl der durch HIV/Aids verursachten Todesfälle nimmt von Jahr zu Jahr ab und liegt unter 10 Fällen pro Jahr. Diese hoffnungsvollen Zahlen bestärken uns in unserer Arbeit. Steckt doch hinter jeder Zahl ein Schicksal. 4 WAT Dossier 2014
Statements zum Welt-Aids-Tag 2014
«Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung
weiss, wie sie sich vor HIV schützen kann. Und dass bei keinem
einzigen HIV-positiven Menschen Aids mehr ausbricht.»
Doris Fiala (Nationalrätin, FDP)
«Der Welt-Aids-Tag ist wichtig, weil dieser Tag zeigt, dass es nicht
nur um Geld geht. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen,
Vorurteile zu bekämpfen und die Prävention zu stärken.»
Daniel Seiler, Geschäftsführer Aids-Hilfe Schweiz
«Der Welt-Aids-Tag ist wichtig, um darauf hinzuweisen, dass
diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber
Menschen mit HIV auch heute noch Realität sind, gegen die es mit
allen Mitteln und auf allen Ebenen anzukämpfen gilt.»
Caroline Suter, Dr. iur., LL.M, Aids-Hilfe Schweiz
Rechtsberatung und Diskriminierungsmeldungen.
«Der Aids-Welt-Tag ist wichtig, weil immer noch über eine Million
Menschen pro Jahr an Aids sterben.»
Claire Comte, Aids-Hilfe Schweiz
Leiterin Programm Menschen mit HIV
«In Zeiten des Übergangs – zwischen einstmals tödlicher
Bedrohung und normaler Lebenserwartung – scheint es mir wichtig,
die Vergangenheit nicht zu vergessen. Und trotzdem in die Zukunft
zu schauen. Den Kampf haben wir dann gewonnen, wenn wir die
Solidarität nicht mehr brauchen und Leben mit HIV zur Normalität
gehört.»
Andreas Lehner, Aids-Hilfe Schweiz, Leiter Programm MSM
5 WAT Dossier 2014«Der Welt-Aids-Tag 2014 ist wichtig, weil nach wie vor nicht alle
Menschen Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten haben und
Menschen mit HIV immer noch Diskriminierung erfahren.»
Barbara Caroline Schweizer, Aids-Hilfe Schweiz
Leiterin Programm Migration
«La Journée mondiale du sida est importante parce qu’elle nous
rappelle que toute personne sexuellement active est concernée
par le VIH d’une façon ou d’une autre. Avec plus de 36 millions de
morts jusqu'en octobre 2013, le VIH continue d’être un problème
de santé publique majeur. En 2012, il y avait environ 35,3 [32,2–
38,8] millions de personnes vivant avec le VIH (OMS), qui doivent
encore faire face à la discrimination en 2014.
La sexualité, ce n’est pas seulement la génitalité, mais surtout une
relation conditionnée par notre histoire personnelle, nos aptitudes
sociales, la communication interpersonnelle, nos croyances, notre
corps, les maladies, la culture, le machisme, le féminisme, les
relations et l’interaction dans et en dehors des couples, qui
peuvent encore nous exposer au VIH. Les nouvelles générations
ont, face au VIH, un regard différent de celui des adolescents des
années 80 ou 90 qui ont vu des amis disparaître, et elles vivent
dans un contexte où tout va plus vite et où elles sont parfois
exposées à des risques. Le contexte et les croyances évoluent, le
public cible se renouvelle, et le VIH change aussi. Même si les
avancées scientifiques sont importantes, je crois que nous ne
pouvons garder le contrôle que si nous conservons en mémoire la
manière dont le VIH affecte aujourd’hui encore des millions de
personnes, et si nous travaillons ensemble tous les jours pour
améliorer l’information, les rapports interpersonnels et la
communication par rapport à la sexualité, en étant conscients que
c’est le sida qu’il faut exclure, pas les personnes séropositives »
Julio Bernasconi, Aide Suisse Contre la Sida c/o Checkpoint Vaud
Coordinateur régional HSH de Suisse Romande
«Der Welt-Aids-Tag erinnert uns daran, dass Gesundheit und
Prävention kein Ablaufdatum haben. Sie sind immer aktuell.»
Barbara Beaussacq, Aids-Hilfe Schweiz
Leiterin Programm Female Sex Work
6 WAT Dossier 2014«Die Medizin ermöglicht Menschen mit HIV heute ein fast
normales Leben. Die Gesellschaft nicht. Zum Welt-Aids-Tag 2014
fordern wir ein Ende der Stigmatisierung und Diskriminierung.»
Béatrice Aebersold, Aids-Hilfe Bern
Geschäftsführerin
«To me, World Aids Day should remind us of the important role
each and every person can play in enhancing awareness.»
Laura Otieno, Miss Africa Switzerland
«La Journée Mondiale du Sida 2014 est importante, parce que le devoir de mémoire est
essentiel pour les générations futures.»
Cand Jean-Philippe, fondation Profa, Chef de servcie
«La Giornata mondiale di lotta all'Aids è importante perché ricorda
che lottare contro la diffusione dell'Aids vuol dire, oltre che avere i
mezzi per informare le giovani generazioni e i gruppi più esposti,
lottare per il diritto di tutti a una cura efficace e soprattutto
prendere coscienza che le discriminazioni verso le persone
sieropositive sono ancora troppo pesanti e troppo presenti.»
Vittorio Degli Antoni, Coordinatore di Zonaprotetta
7 WAT Dossier 2014«Information und Aufklärung sind die wirkungsvollsten Mass-
nahmen gegen das Unwissen, das den normalen Umgang mit HIV
erschwert und auch heute noch viel Leid verursacht.»
Franco Rogantini, Zürcher Aids-Hilfe, Geschäftsführer
«Medizinisch mögen wir auf einem guten Weg sein. HIV-positive Menschen sehen sich
aber weiterhin vielfachen Diskriminierungen ausgesetzt. Aufklärung und Prävention sind
deshalb so nötig wie eh und je.»
Hans-Peter Fricker, Präsident der Zürcher Aids-Hilfe
«Der Welt-Aids-Tag ist wichtig, weil viele Menschen immer noch
zu wenig über das Thema wissen und sich von Vorurteilen leiten
lassen.»
Vinicio Albani, Aids-Hilfe Schweiz, MSM Redaktor, Dr. Gay
«Weil HIV nicht sichtbar ist. Ich nehme alle Menschen wie sie
sind.»
Carina (20), Lehrerin in Ausbildung, Aids-Hilfe Graubünden, Freelancer
8 WAT Dossier 2014«Weil es eine Infektion (Krankheit) ist wie jede andere auch.»
Lilly (17), Kantischülerin, Aids-Hilfe Graubünden, Freelancer
«Weil ich bin, mit oder ohne HIV.»
Nina (17), Ewa (16), Aliena (17), Kantischülerinnen, Aids-Hilfe
Graubünden, Freelancer
«Weil ich die Krankheit hab und nicht die Krankheit mich.»
Fabio (20), FAGE in Ausbildung, Stephan (19), Elektrotechniker, Aids-Hilfe
Graubünden, Freelancer
«Mensch ist Mensch unabhängig des HIV-Status.»
Fabian (19), Kantischüler, Aids-Hilfe Graubünden, Freelancer
9 WAT Dossier 2014«Der Welt-Aids-Tag 2014 ist wichtig, weil HIV und Aids noch
immer tiefste Ängste in der Gesellschaft berühren. Benennen baut
Angst ab.»
Bruno Willi, Leiter der HIV-Aidsseelsorge, Zürich
«…weil wir mit HIV und Aids als Teil unserer schwulen Geschichte
und Gegenwart auch über den eigenen Suppentopfrand
hinausblicken wollen!
Jürg Bläuer, Aidshilfe St. Gallen und Gesundheit Schwyz
Projektleiter MSM
10 WAT Dossier 2014Factsheet: Menschen mit HIV
Epidemiologie der HIV-Infektion: Global und in der Schweiz
HIV/Aids ist weltweit die Infektionskrankheit mit den meisten Todesfällen und allge-
mein die dritthäufigste Todesursache (WHO).
Die globale HIV-Epidemie (gemäss UNAIDS-Angaben)
35 Millionen Menschen lebten mit HIV Ende 2013
2,1 Millionen neue HIV-Infektionen wurden 2013 gemeldet; 38 % weniger als
noch 2001
1,5 Millionen Menschen starben 2013 an Aids; 35% weniger als 2005
61% der Menschen mit HIV haben heute Zugang zur Therapie.
Die Epidemie in der Schweiz (gemäss BAG-Angaben)
0,4% beträgt die HIV-Prävalenz in der Schweizer Bevölkerung
22 000 - 29'000 Menschen mit HIV lebten 2013 in der Schweiz;
575 neue HIV-Infektionen wurden 2013 in der Schweiz gemeldet
- davon 49% Heterosexuelle
- davon 39% Männer, die Sex mit Männer haben
- davon unter 3 % Drogen konsumierende Personen
125 neue Aids-Fälle wurden 2013 in der Schweiz gemeldet
12 Aids-Todesfälle wurden 2013 in der Schweiz gemeldet
Mehr als 7'000 Aids-verursachte Todesfälle wurden bis Ende 2013 gemeldet
Rund 60 - 80% der Menschen mit HIV haben eine HIV-Therapie
Soziale Situation der HIV-positiven Personen in der Schweiz
ca. 70% der Menschen mit HIV haben eine Teil- oder Vollzeitstelle
ca. 70% davon arbeiten in einer 90%-Erwerbsstelle oder mehr
ca. 30% der Menschen mit HIV sind Nichterwerbspersonen
Die Mehrheit der Menschen mit HIV sind zwischen 30 und 44 Jahre alt
11 WAT Dossier 2014Herausforderungen der HIV-Arbeit heute
Diskriminierung und Stigmatisierung: Trotz der medizinischen Fortschritte zieht eine
HIV-Diagnose auch heute noch eine deutliche Schlechterstellung in zahlreichen Be-
reichen des alltäglichen Lebens nach sich. Benachteiligungen im Arbeitsumfeld, Be-
nachteiligungen in Bezug auf Sozial- und Privatversicherungen, aber auch Verletz-
ungen des Persönlichkeitsrechts und des Datenschutzes. Dabei ist der Abbau von
Diskriminierungen nicht nur für die Betroffenen wichtig, sondern muss auch auf der
strukturellen Ebene angegangen werden.
Neuer Stellenwert der HIV-Therapie: Die Medizin hat in den letzten Jahren grosse
Fortschritte gemacht, was die Verträglichkeit und Einfachheit der HIV-Therapie betrifft.
Die Lebenserwartung von Menschen mit HIV ist dank HIV-Therapien im günstigen Fall
wie die von Menschen ohne HIV-Infektion. Heute ist klar, dass die antiretrovirale
Therapie (ART) als Präventionsmassnahme eingesetzt werden kann. Die Wahrschein-
lichkeit, den Partner anzustecken, reduziert sich bei HIV-positiven Menschen unter
Therapie auf ein Minimum.
Rechtzeitiger Therapiestart: Ein rechtzeitiger Therapiebeginn erhöht die Chancen auf
ein langes Leben und einen möglichst komplikationsarmen Verlauf der Infektion. Aber
bei bis zu 15% der Menschen mit HIV werden der Test und die Therapie zu spät
angeboten, was gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Der rechtzeitige
Therapiestart ist deshalb wichtig und muss gefördert werden. Hier tun vollständige,
fundierte und aktuelle Informationen not.
Therapietreue: Gewisse Patienten haben Schwierigkeiten, die medikamentöse
Therapie ohne Unterbrüche durchzuhalten. So hat die Schweizer Kohortenstudie ge-
zeigt: Wer die antiretrovirale HIV-Behandlung unterbricht, läuft Gefahr, mehrere Jahre
danach noch schlechtere CD4-Werte zu haben als jemand, der die Therapie nie unter-
brochen hat. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, an den Folgen von HIV zu
sterben oder HIV-assoziierte Krankheiten zu entwickeln.
Partnerinformation: Übertragungen in serodifferenten Paaren sind häufig: Als wahr-
scheinliche Quelle der Infektion gaben Frauen vorwiegend den festen Partner an
(59%); bei heterosexuellen Männer waren es 31% und bei MSM 26% (CH.A.T.-
Survey, KSSG 2007). Die Angst vor Abweisung und Diskriminierung verunmöglichen
es vielen Menschen mit HIV, ihren Status gegenüber ihren Partnern und Partnerinnen
(dies betrifft auch Gelegenheitspartner) offen zu legen.
12 WAT Dossier 2014Was tut die Aids-Hilfe Schweiz für die Zielgruppe
Menschen mit HIV?
Die Aids-Hilfe Schweiz setzt folgende Massnahmen um:
Interessensvertretung und Lobbying
Kämpft gegen Ausschluss aus der Krankentaggeldversicherung
Vernehmlassungen zu ausgewählten Gesetzesthemen mit Bezug zu HIV
Gratis Rechtsberatung und Rechtsvertretung von Menschen mit HIV
(telefonisch & schriftlich)
Finanzielle Nothilfe für Menschen mit HIV durch den Solidaritätsfonds des Verbands
Nationale Meldestelle für Diskriminierungen und Datenschutzverletzungen im Bereich
HIV
Sammlung von Rechtsfällen auf www.hivlaw.ch (gemeinsam mit FHNW und ZHAW)
Medienarbeit und Medienberichte zu Themen rund um Menschen mit HIV und Leben
mit HIV
Publikationen für Menschen mit HIV, www.aids.ch/leben-mit-hiv / www.shop.aids.ch
Weiterbildungen und Vorträge für Fachpersonen in der Beratung von Menschen
mit HIV
Zusammenarbeit und Unterstützung von Organisationen von Menschen mit HIV
Fundraising für Projekte zugunsten von Menschen mit HIV und Aids
Monitoring der Entwicklungen und Trends im Bereich HIV
13 WAT Dossier 2014Die Aids-Hilfe Schweiz
Die Aids-Hilfe Schweiz ist der Dachverband der acht regionalen Koordinationszentren, den
sogenannten Aktivmitgliedern+, sowie weiterer über 40 im HIV/Aids-Bereich tätigen oder
engagierten Organisationen. Die Aids-Hilfe Schweiz ist seit 1985 aktiv. 2015 feiert sie ihr
30-jähriges Bestehen.
Der Verein Aids-Hilfe Schweiz finanziert sich aus Geldern des Bundesamts für Gesund-
heit BAG und aus privaten Zuwendungen. Die Mitglieder der Aids-Hilfe Schweiz sind
rechtlich und finanziell von der Dachorganisation unabhängig. Der Verein Aids-Hilfe
Schweiz ist eine Non-Profit-Organisation (ZEWO). In der Geschäftsstelle in Zürich arbeiten
rund 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die Ziele der Aids-Hilfe Schweiz:
Neue Infektionen mit dem HI-Virus verhindern,
Die Lebensqualität von betroffenen Menschen und ihnen Nahestehenden verbessern,
die Solidarität der Gesellschaft mit HIV-positiven Menschen, ihren Familien und
Freunden stärken.
Die Aids-Hilfe Schweiz sammelt und verwertet Informationen zu HIV/Aids und weiteren
Geschlechtskrankheiten. Diese Informationen stellt sie sämtlichen in der Beratung und
Begleitung engagierten Mitgliedern zur Verfügung.
Die Aids-Hilfe Schweiz realisiert – zum Teil im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit –
verschiedene Präventionsprojekte insbesondere für Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem
Risiko.
Für Menschen mit HIV und Aids bietet die Aids-Hilfe Schweiz Informationen medizinischer
und rechtlicher Art in Form von Broschüren und regelmässigen Publikationen sowie
Beratungen an. Neben Aus- und Weiterbildung in Form von Intervisionen und Fachtag-
ungen für Fachpersonen finden auch Seminare und Kurse statt. Diese sprechen Betrof-
fene, ihre Partner und Partnerinnen, Angehörige und Begleitende an, mit dem Ziel, die
Autonomie und Lebensqualität der Direktbetroffenen zu sichern und zu fördern.
14 WAT Dossier 2014HIV 2020: Ausblick und Hoffnung Der Herausforderungen gibt es viele. In den letzten Jahren infizierten sich in der Schweiz jährlich rund 600 Menschen neu mit HIV. Das macht die Schweiz zu einem der am meisten von HIV betroffenen westeuropäischen Ländern. Wir müssen unsere Anstrengungen in der Prävention verstärken, damit diese Zahlen nachhaltig sinken. Das nationale Programm des Bundesamts für Gesundheit „HIV und andere sexuell über- tragbare Infektionen (NPHS) 2011 – 2017“ setzt sich zum Ziel, die Anzahl der Neudiag- nosen von HIV und anderer Geschlechtskrankheiten bis 2017 zu halbieren. Ein ehrgei- ziges Ziel, dass wir durch die Konzentration unserer Kräfte und gemeinsam und mit unseren Partnern erreichen wollen. Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV soll bald der Vergangenheit angehören. Gesetze und Praxis müssen der Realität angepasst werden, sodass Benach- teiligungen von Menschen mit HIV nicht mehr länger auftreten. Denn wenn sich Menschen fürchten einen HIV-Test zu machen, wenn sie sich fürchten, Beratungen und Unter- stützung aufzusuchen, weil sie möglicherweise mit Benachteiligung, Ausgrenzung und Zurückweisung konfrontiert werden, verpassen wir damit wichtige Chancen der Prävention. Die Herausforderungen sind auf dem Tisch, packen wir sie an. Die Aids-Hilfe Schweiz und ihre Partner sind bereit. 15 WAT Dossier 2014
Diskriminierungen im HIV-Bereich
Die Aids-Hilfe Schweiz ist die vom Bundesamt für Gesundheit ernannte eidgenössische
Meldestelle für Diskriminierungen im HIV-Bereich. Sie sammelt die ihr gemeldeten Fälle
und leitet diese halbjährlich an die Eidgenössische Kommission für Sexuelle Gesundheit
(EKSG) weiter. Die Aids-Hilfe Schweiz interveniert bei Fällen von Diskriminierungen, berät
HIV-positive Menschen in Rechtsfällen kostenlos. Darüber hinaus setzt sie sich dafür ein,
dass politische, gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die Diskriminierungen verhindern.
Bis 31. Oktober 2014 wurden der Aids-Hilfe Schweiz in diesem Jahr bislang 117
Diskriminierungen und Datenschutzverletzungen gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr
bedeutet dies eine Zunahme von 40%.
Anzahl und Bereiche der jährlich gemeldeten Diskriminierungen
von 2010 bis 2014:
117
Datenschutzverletzungen
80 84 85
Diverse
70
Einreise/Aufenthalt
Gesundheitswesen
Strafrecht
Privatversicherungen
Sozialversicherungen
Erwerbstätigkeit
2010 2011 2012 2013 2014
Die meisten Meldungen betrafen 2014 den Bereich der Privatversicherung (26), gefolgt
vom Arbeitsumfeld (20) und den Sozialversicherungen (17).
Hinter solchen Diskriminierungen stecken häufig irrationale Ängste vor der Übertragung
des HI-Virus und Vorurteile gegenüber Menschen mit HIV. Um Diskriminierungen wirksam
zu bekämpfen, reicht der Rechtsschutz in der Schweiz nicht aus. Die Einführung eines
Antidiskriminierungsgesetzes nach Vorbild der EU-Länder würde Abhilfe schaffen, liegt je-
doch in weiter Ferne. Umso wichtiger sind deshalb die Aufklärungskampagnen der Aids-
Hilfe Schweiz, deren Rechtsberatung für Menschen mit HIV und die Zusammenarbeit der
Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit.
16 WAT Dossier 2014Nachfolgend eine Auswahl der diesjährigen Meldungen:
Ein Mann musste seinen Traum von der Selbstständigkeit aufgeben, weil ihn die
Einzeltaggeldversicherung infolge seiner HIV-Infektion abgewiesen hatte.
Einer HIV-positiven Arbeitgeberin wurde von einer gekündigten Mitarbeiterin ge-
droht, ihre HIV-Infektion der ganzen Firma bekannt zu geben, wenn sie die
Kündigung nicht zurückziehe.
Einem Mann wurde der Untermietvertrag gekündigt, weil die Mieterin herausfand,
dass er HIV-positiv ist.
Ein Exmann erzählte der gemeinsamen kleinen Tochter von der HIV-Positivität ihrer
Mutter, worauf diese nicht mehr bei ihrer Mutter leben wollte.
Einer HIV-positiven Frau, die sich in ein Tattoo stechen lassen wollte, wurden straf-
rechtliche Folgen angedroht.
Ein Mann outete seine Exfreundin via Facebook als HIV-positiv.
Nachdem ein Stellenbewerber im Bewerbungsgespräch seinen HIV-Status mitge-
teilt hatte, brach die HR-Verantwortliche das Gespräch ab.
Ein Wohnungsmieter wurde von einem Nachbarn aufgrund seiner HIV-Infektion
gemobbt und tätlich angegriffen.
17 WAT Dossier 2014Keine Rechtfertigung von Berufsverboten für HIV-positive Arbeitnehmende In der Schweiz leben zwischen 22`000 und 29`000 Menschen mit HIV, darunter auch Ärztinnen, Polizisten, Pilotinnen. Viele von ihnen werden im Alltag und in der Berufs- welt mit Diskriminierung und Stigmatisierung konfrontiert. Es gibt in der Schweiz theoretisch keine verbotenen Berufe für Menschen mit HIV. Faktisch gibt es aber leider immer noch Einschränkungen. So wird im Bewerbungs- verfahren einer Kantonspolizei explizit nach dem HIV-Status gefragt. Trotz Intervention der Aids-Hilfe Schweiz hält die besagte Kantonspolizei an der Frage nach dem HIV-Status fest. Diskriminierung von Menschen mit HIV geschieht häufig nicht aus böser Absicht, sondern ist vielmehr auf fehlendes Wissen rund um HIV/Aids zurückzuführen. Das tatsächliche Übertragungsrisiko von HIV wird häufig überschätzt. Das Risiko einer HIV-Transmission ist direkt abhängig von der Viruskonzentration im Blut. Unter einer gut durchgeführten antiretroviralen Therapie ist die HI-Viruskonzentration im Blut in der Regel nicht mehr messbar. Aus der Situation der sexuellen Übertragung wissen wir, dass eine HIV-positive Person ohne andere sexuell übertragbare Krankheit unter einer antiretroviralen Therapie (ART) mit vollständig supprimierter Virämie nicht infektiös ist, das heisst sie gibt das HI-Virus über Sexualkontakte nicht weiter. Bisher wurde noch nie ein Fall einer sexuellen Übertragung von einer Person mit nicht nachweisbarer Viruslast doku- mentiert. Das Gleiche gilt für Nadelstichverletzungen. Selbst bei einer nicht vollständig supprimierten Virämie ist eine Übertragung im Alltag kaum möglich. Beim Erste-Hilfe-Leisten kann eine Ansteckung praktisch ausgeschlossen werden, selbst wenn keine Handschuhe verwendet werden (was jedoch trotzdem stets getan werden sollte, (zum Beispiel wegen Hepatitis). Die Person, die hilft, müsste selber auch eine grosse offene Wunde haben, und es müssten die Wunden von beiden Personen gegeneinander massiert werden. Durch den venösen Druck läuft das Blut zudem nach aussen, das HI-Virus kann schwerlich gegen den Blutstrom in den Körper des anderen Menschen gelangen. Auch im medizinischen Bereich ist die Übertragung des HI-Virus äusserst unwahrscheinlich. So sind seit Beginn der HIV-Epidemie weltweit lediglich vier HIV-Übertragungen von medizinischem Personal auf Patienten bekannt, davon keine in der Schweiz. Auch die HIV-Medikamente hindern HIV-positive Menschen nicht daran, gute und belast- bare Arbeitnehmende zu sein. So gelten Menschen mit HIV unter antiretroviraler Therapie im Flugverkehr gemäss einer Richtlinie grundsätzlich als tauglich. Mit den heutigen Kombi- nationstherapien ist das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko von HIV-positiven Menschen mit demjenigen HIV-negativer Menschen vergleichbar. Menschen mit HIV können genauso sportlich, gesund und leistungsfähig sein, wie Menschen ohne HIV. In Anbetracht des fehlenden Ansteckungspotenzials ist rechtlich niemand verpflichtet, über seinen/ihren HIV-Status zu informieren. HIV-positive Polizistinnen und Polizisten stellen weder für sich, noch für ihre Kolleginnen und Kollegen oder für Dritte eine Gefahr dar – weder an der Front, noch beim Leisten von Erster-Hilfe. 18 WAT Dossier 2014
Interview mit und Portraits von HIV-positiven Menschen „Kranke Menschen brauchen medizinische Hilfe, aber auch Nähe.“ HIV-positiv, schweres Nierenversagen, keine Arbeit, unsicherer Aufenthaltsstatus in der Schweiz, beide Eltern tot. Ibu Lawal*, 26-jährig, bleibt anscheinend nichts erspart. Trotzdem betrachtet er sein Leben als Geschenk. Und möchte in Zukunft anderen kranken Menschen die wichtigste Hilfe geben, die ihm manchmal gefehlt hat: menschliche Nähe. Herr Lawal, als wir einen Termin für dieses Interview suchten, haben Sie gesagt, dass Ihnen unter der Woche jeweils nur Dienstag und Donnerstag passen, die anderen Tage seien Sie jeweils im Spital. Weshalb? Ich gehe jeden Montag, Mittwoch und Freitag für mehrere Stunden ins Spital zur Dialyse, bei der mein Blut gereinigt wird. Das ist notwendig, weil ich unter Nierenversagen leide: Meine Nieren reinigen das Blut nicht mehr selber. Die Dialyse ist anstrengend, ich bin danach jeweils müde und kraftlos. Hängt das Nierenversagen mit Ihrer HIV-Infektion zusammen? Das kann man nicht genau sagen. Wahrscheinlich gibt es schon einen Zusammenhang, denn meine HIV-Infektion war ziemlich weit fortgeschritten, als ich die Diagnose HIV- positiv erhielt. Es kann also sein, dass die Infektion meinem Körper Langzeitschäden zugefügt hat, bevor die HIV-Medikamente sie zurückdrängen und stabilisieren konnten. Das Nierenversagen folgte nach der HIV-Diagnose, als Sie bereits HIV-Medikamente nahmen? Zumindest hat man es erst nachher bemerkt, als es akut wurde. Das war 2010. Ich litt unter plötzlicher Atemnot, wurde notfallmässig ins Spital gebracht, wo sie acht Liter Wasser aus meinem Körper holten. Die ganzen Lungen waren voll davon. Und wann hatten Sie die HIV-Diagnose erhalten? Zwei Jahre früher, 2008, kurze Zeit nach meiner Ankunft in der Schweiz. Ich ging zum Arzt, weil ich mich schlecht fühlte, unter anderem auch Fieber hatte. Der Arzt liess mein Blut im Labor auf verschiedene Krankheiten untersuchen. Als ich wenige Tage später ins Sprech- zimmer kam, sass er mit mir hin und schaute sehr ernst. „Ich bin ganz Ohr“, sagte ich – und erfuhr, dass ich HIV-positiv bin. Da war die Infektion bereits weit fortgeschritten. Ja, nach einigen weiteren Tests im Unispital erklärten mir die Ärzte, ich müsse sofort mit den HIV-Medikamenten beginnen. Meine Blutwerte waren schlecht. 19 WAT Dossier 2014
Sie gingen im Alter von zwanzig Jahren wegen unbestimmter Krankheitszeichen zum Arzt – und erfuhren da, dass Sie sofort mit einer lebenslangen Therapie gegen HIV beginnen sollten. Wie gingen Sie damit um? Es war ein harter Schlag. Zuerst dachte ich: „Das kann nicht sein. Warum ich?“.Aber es war mir schnell klar, dass ich das akzeptieren muss, wenn ich leben will. Alle haben ihre Prüfungen zu bestehen. Gerieten Sie nie in eine Lebenskrise wegen der Krankheit? Ich glaube an Gott, ich bin mit ihm in Frieden. Zweimal pro Woche gehe ich in die Kirche und danke ihm, dass es eine Lösung gibt für mich. Die Medikamente retten mein Leben, das ist ein grosses Geschenk. Im Vergleich mit all jenen, die im Moment an Ebola erkranken und keine Hilfe erhalten, kann ich mich glücklich schätzen. Sie sind mit der Therapie von Beginn weg gut klargekommen? Ja. Medizinisch gesehen. Und nicht medizinisch gesehen? Da gab es Probleme. Ich teilte zu dieser Zeit mit fünf anderen Männern ein Zimmer im Asylheim. Ich schämte mich sehr und wollte unbedingt vermeiden, dass meine Zimmergenossen von meiner HIV-Infektion erfuhren. Deshalb rief mich der Leiter des Heims jeden Tag unter einem Vorwand in sein Büro, wo ich meine Medikamente einnehmen konnte, ohne dass es die anderen bemerkten. Trotzdem erfuhren sie es. Wie? Nach einer Weile bekam ich ein Einzelzimmer. Die Leitung hielt das für besser. Doch wenn man ein Einzelzimmer erhält, ist für die anderen eigentlich schon klar, dass man irgendeine Krankheit hat. Wahrscheinlich hat dann einfach jemand gesagt: „Ibu hat sicher Aids“–, und schon stand es für alle fest. Was waren die Folgen? Ich war augenblicklich isoliert: Alle mieden mich, hielten Distanz. Da habe ich gelernt, dass ich besonders unter Afrikanern, nicht zuletzt unter meinen Landsleuten aus Nigeria, kein Wort über die Infektion verlieren darf. Das gilt immer noch? Unter Afrikanern ist die Angst vor HIV gross. Viele haben falsche Vorstellungen und denken, sie können sich selbst bei alltäglichen Begegnungen anstecken. Deshalb kann ich niemandem in der afrikanischen Gemeinschaft von meiner Infektion erzählen. Wenn das die Runde macht, wenden sich alle ab. Mit Ihrer Familie können Sie auch nicht darüber sprechen? Meinen Eltern habe ich es gesagt. Das musste ich einfach. Meine Mutter hat viel geweint. Aber die Eltern sind zu Ihnen gestanden? Ja. Es gab keine schlechten Gefühle. Leider sind beide 2010 gestorben. 20 WAT Dossier 2014
Wer unterstützt Sie heute? Ich erhalte viel Unterstützung vom medizinischen Personal, ebenso von der kantonalen Aids-Hilfe. Auch in meinem Privatleben habe ich mittlerweile gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel war die Infektion für meine Exfreundin, eine Schweizerin, kein Problem. Sie wusste, wenn wir uns schützen, kann nichts passieren. Wenn es die Leute wissen und gut reagieren, dann ist HIV schnell kein Thema mehr. Es ist, als ob man es ganz vergisst. Aber wenn man nicht darüber sprechen kann, dann bleibt es immer da, unausgesprochen, aber unangenehm präsent. Vor allem die Nierenschwäche schränkt Sie ziemlich fest ein. Schmieden Sie dennoch Zukunftspläne? Auf jeden Fall. Mein Traum ist eine eigene Familie. Doch als Erstes muss ich eine Arbeit finden. Dann kann ich den B-Ausweis beantragen. Und wenn ich den erhalte, kann ich langfristig planen. Zugegeben, das ist nicht ganz einfach: Ich habe schon über 180 Bewerbungen geschrieben, bisher leider ohne Erfolg. Beim Schweizerischen Roten Kreuz konnte ich aber einen Pflegekurs machen. In dieser Richtung sehe ich meine Zukunft. Erklärt sich das aus Ihrer eigenen Geschichte? Kranke Menschen brauchen medizinische Hilfe, aber auch menschliche Nähe. Denn Distanz tötet innerlich, das weiss ich aus eigener Erfahrung. Umso wichtiger ist es mir, nun anderen Menschen zu helfen und ihnen die notwendige Nähe zu geben. *Name geändert 21 WAT Dossier 2014
„Man müsste eigentlich hinstehen und sein Gesicht zeigen“ Sara L.*, ist eidgenössisch diplomierte Pflegefachfrau HF, Mutter von zwei Kindern, allein-erziehend, HIV-positiv und bei bester Gesundheit. Mit viel Kraft bringt sie Familie und Beruf unter ein Dach. Sie gehört zu den Working-Poor in unserem Land, aber darüber klagen ist nicht ihr Ding. Sara L.* lebte zwei Jahre mit ihrem Partner zusammen, als dieser ihr rät, einen HIV-Test zu machen. Er selbst hatte sich kurz zuvor, auf Anraten seiner Expartnerin, testen lassen. Zum 20. Geburtstag, man schreibt das Jahr 1997, erhält Sara L.* die Diagnose HIV-positiv. Völlig unerwartet, aber ohne Stress. Sara L.*: „Ich nahm das alles easy. Wir blieben zu- sammen, die Infektion war für mich kein Trennungsgrund. Ich dachte, diese Diagnose kann jeden treffen. Ich stellte mir auch nie die Frage, warum ich? Es war einfach so. Punkt. Auch wenn ich es rückblickend himmeltraurig finde. Infizierte er doch mich und seine Ex- partnerin.“ Die junge Frau ist zu diesem Zeitpunkt in ihrem ersten Ausbildungsjahr. Sie teilt ihrer Lehrerin die Diagnose mit. Als sie kurz darauf auch noch feststellt, dass sie schwanger ist, lässt diese sie nicht hängen und ermutigt sie, die Lehre weiterzuführen. Auf dem Aids- Pfarramt erhält sie ebenfalls Unterstützung, um den richtigen Weg zu finden. Sie bricht die Schwangerschaft ab. Zu unsicher sind ihre Lebenssituation und die Aussichten für HIV- positive Schwangere. Parallel dazu beginnt sie sofort mit der antiretroviralen Therapie. Das heisst jeden Tag, alle 8 Stunden 13 bis 15 Pillen einzunehmen. Sara L., die bis da-hin einzig die Alternativmedizin kennt, so ist sie aufgewachsen, legt eine erstaunliche Therapietreue an den Tag. Zehn Jahre lang wird sie jeden Tag, ohne das Ganze einmal zu hinterfragen, ihre Tabletten einnehmen. Nebenwirkungen spürt sie praktisch keine. Outen: Ja oder nein? Von ihrer Diagnose erfahren einzig ihre Eltern und Geschwister. Für ihre Mutter ist die Diagnose ihrer Tochter ein Schock. Sie reagiert mit gesundheitlichen Problemen. Mit Männern, mit denen sie nach der Diagnose gerne eine Beziehung eingehen möchte macht sie unterschiedliche Erfahrungen. Ein langjähriger Bekannter kann überhaupt nicht mit der Diagnose umgehen. Er hat grosse Angst vor dem Virus und kann, trotz Information und Erklärung, nicht über seinen Schatten springen. Das Paar kommt sich nicht näher, und trennt sich. Andere Männer haben gar kein Problem mit Safer Sex. Vom Aids-Pfarramt wird sie angefragt, ob sie in einer Fernsehsendung anonym, jedoch mit eigener Stimme über ihre Infektion sprechen mag. Sara L. sagt zu. „Als meine Stimme erkannt wird, beschliesse ich nur noch gänzlich unerkannt über meinen HIV-Status zu sprechen. Zwar überlege ich mir immer wieder mal, mich zu outen. Es ist wichtig, dass HIV-positive Menschen hinstehen und ihr Gesicht zeigen, aber solange meine Kinder klein sind, geht das für mich einfach nicht. Zudem bräuchte ich die Unterstützung eines Partners.“ Auch heute wissen an ihrem Arbeitsplatz einzig ihre Vorgesetzten von ihrer Infektion. „Man kann einfach nie voraussagen, wie das Gegenüber reagiert.“ Früher wäre sie gerne einer Selbsthilfegruppe beigetreten. Doch diese waren meist auf Homosexuelle und Menschen mit Suchtproblemen ausgerichtet, eine Gruppe für heterosexuelle Frauen fand sich nicht, oder die junge Frau hatte keine Kenntnisse davon. 22 WAT Dossier 2014
Kinderwunsch und Kindererfüllung
Nach rund fünf Jahren stellt Sara L. ihre Medikamente um. Das bedeutet nur noch zwei
Tabletten am Tag und ist eine grosse Erleichterung. An ihrem damaligen Arbeitsplatz lernt
sie auch den Vater ihrer Kinder kennen. Er ist Pfleger und leidet seit einer erfolgreich über-
wundenen Drogentherapie unter Hepatitis C. „Er hatte überhaupt keine Probleme mit
meiner chronischen Krankheit, er litt ja selber unter einer“, erzählt Sara L. „Dass er bereits
zu diesem Zeitpunkt unter einem Alkoholproblem litt, sah ich nicht, oder wollte es nicht
sehen. Mir gefielen die stundenlangen Gespräche bei einem Glas Wein.“
Als sie mit 27 Jahren schwanger wird, ist für Sara L. klar, dass sie das Kind behalten will.
Sara L.: „Ich wollte immer Kinder, ich wollte immer Mami sein, daran änderte auch die
Diagnose HIV-positiv nichts.“ Und jetzt ist auch der Zeitpunkt der richtige, zumal die
Medizin grosse Fortschritte in Bezug auf HIV gemacht hat. Sara L.’s Töchterlein kommt,
entgegen den damaligen Vorschriften nicht per Kaiserschnitt, sondern durch eine Spontan-
geburt zur Welt und erhält unmittelbar nach der Geburt eine antiretrovirale Therapie. Sie
wird der damaligen Praxis folgend nicht gestillt und ist HIV-negativ. Bald realisiert die junge
Mutter, dass der Alkohol ihren Partner stark im Griff hat. Er ist unzuverlässig und der
jungen Familie keine Stütze. Im Gegensatz zu seinem Beruf, da arbeitet er professionell,
niemand weiss von seiner Sucht. Doch zu Hause zeigt er ein anderes Gesicht. Immer
wieder unternimmt er Versuche, um vom Alkohol wegzukommen, - erfolglos. Das Zusam-
menleben funktioniert nicht mehr, und so beschliesst Sara L., ihr Kind alleine aufzuziehen.
„Ein Lebensentwurf, den ich mir nie erträumte. Ich wollte immer eine Bilderbuchfamilie,
aber so war das eben nicht.“
Die junge Mutter organisiert ihren Alltag mit Kind und Arbeit. Jeder Tag muss bewältigt
werden und braucht viel Kraft. Ihre HIV-Medikamente setzt sie auf eigene Verantwortung
ab. Ihre Werte sind gut. Später kommt das Paar wieder zusammen. Sara L. möchte dem
Vater ihres Kindes helfen, ihm in seiner Sucht beistehen. Sie unterstützt und ermutigt ihn,
eine Weiterbildung in Angriff zu nehmen. Und dann wird sie erneut schwanger. Im vierten
Monat ihrer Schwangerschaft beginnt sie wieder mit der Therapie, um eine HIV-Über-
tragung auf das Ungeborene zu verhindern. Ihr zweites Kind bringt Sara L. ohne Probleme
zu Hause auf die Welt. „Eigentlich war alles perfekt. Er hatte seine Ausbildung abge-
schlossen und nochmals einen begleiteten Entzug gemacht. Ich gebar einen gesunden
HIV-negativen Sohn, stillte entgegen den Empfehlungen, und er kümmerte sich rührend
um uns im Wochenbett. Genau sechs Tage lang. Dann stürzt er erneut ab. Es war hart,
sehr hart. Niemand der kochte, keine Haushalthilfe. Ich hätte alles selber bezahlen müssen
und hatte schlicht kein Geld. Einzig meine Eltern unterstützen mich finanziell und
moralisch.
„Der Welt-Aids-Tag ist für mich ein heiliger Tag.
Wenn immer möglich nehme ich daran teil. Das ist der einzige Tag
im Jahr, an dem ich meiner Krankheit Raum geben kann
und der mich mit anderen HIV-positiven Menschen verbindet. “
Strenger Alltag
Sozialhilfe beantragen will Sara L. nicht, obwohl sie Anspruch darauf hätte. Doch sie will
unabhängig und nicht kontrolliert sein. Heute arbeitet sie halbtags in ihrem Beruf, während
ihre beiden Kinder die Schule besuchen. Sara L. über ihren Beruf: „Als Mädchen wollte ich
immer Ärztin werden, doch als Pflegefachfrau bin ich viel näher an den Menschen, und das
gefällt mir.“ Sie wohnt in einem kleinen Eckhaus, dass ihre Eltern für sie und die Kinder
gekauft haben. Im Garten hoppeln zwei Kaninchen, und eine junge Katze übt sich im
23 WAT Dossier 2014Mäusefangen. Ein junger Hund tobt sich aus, und im Gemüsebeet stehen noch ein paar Fenchel. Diese überlässt Sara L. den Schmetterlingsraupen, aus denen nächstes Jahr Schwalbenschwänze schlüpfen werden. Ihr Alltag ist streng und nicht immer einfach. Der Vater ihrer beiden Kinder ist heute trocken, doch gesundheitlich sehr angeschlagen. Er leidet unter Leberzirrhose und wartet auf eine Spendeleber. Wenn es sein Zustand zulässt, schaut er ab und an zu seinen Kindern, wenn Sara L. Elternabend oder dergleichen hat. Wenn der Himmel über ihr einzustürzen droht, besucht sie temporär ihre Therapeutin. Dort ist der Ort, wo sie sich aussprechen und ausheulen kann. „Man kann ja nicht jeden Tag dieselbe Leier spielen. So ist es aber, jeden Tag dieselbe Melodie. Oft wünsche ich mir Hilfe, aber ich gehe nicht gerne betteln. Ich kämpfe jeden Tag, und manchmal habe ich die Schnauze gestrichen voll. Aber es ist mein Weg, und den muss ich gehen. Ich weiss, dass ich das schaffe. Es ist streng, aber die Kinder werden ja auch grösser.“ Sara L.’s grösster Wunsch sind Ruhe, Gelassenheit und tolle Ferien mit den Kindern. Doch Letzteres kann sie sich bis heute nicht leisten. .* Name geändert 24 WAT Dossier 2014
„Das Positive im Schweren sehen“ René W.* lebt seit bald 13 Jahren mit der Diagnose HIV. Als er von seiner Diagnose erfuhr, haderte er lange mit seinem Schicksal. Erst als er einen verständnisvollen Partner fand und lernte über seine Krankheit zu sprechen, konnte er die Isolation durchbrechen. Noch immer ist sein Leben von Ups und Downs geprägt, aber er hat gelernt damit umzugehen. Bereits vor seiner Diagnose wusste René W. viel über Aids und HIV. 1985 outete sich André Ratti, ein bekannter Fernsehjournalist, vor laufender Kamera als schwul und an Aids erkrankt. Ein Jahr darauf verstarb er. „Ratti war für mich schon immer eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen. Als ich ihn so krank im TV sah, war das ein Schock für mich und zeitgleich der Auslöser für meinen ersten HIV-Test.“ Der zweite folge kurz darauf. René W. machte sich selbstständig und benötigte dazu ein Attest seines Vertrauensarztes. Von da an liess sich René W. jedes Jahr auf HIV testen. „Ich war ja viel unterwegs und mir der Risiken bewusst. Trotzdem steckte ich mich an.“ Aus Angst Status verheimlicht Gegen Ende des letzten Jahrhunderts führte René W. eine Beziehung mit einem HIV- positiven Mann, der ihm aber seinen Status verheimlichte. Nach einem halben Jahr Safer Sex schlägt René W. vor, man möge doch gemeinsam einen HIV-Test machen, damit man künftig ohne Präservativ bumsen könne. René W.: „Mein Test viel negativ aus, seiner positiv. Ich fiel aus allen Wolken. Als ich ihn darauf ansprach, erklärter er mir, dass er mir aus Verlustangst seinen Status verheimlicht habe. Denn wenn immer er sich als HIV- positiv outete, wurde er verlassen“. Also zurück zu Safer Sex. Kurz darauf erkrankt René W.’s Partner. Er weigert er sich einen Arzt aufzusuchen, weil er das Warten auf den Befund psychisch nicht aushält. Als es endlich wieder einmal so weit kommt, ist sein Immunsystem sehr geschwächt. René W.: „Er war schwer krank. Zusätzlich zu HIV litt er auch noch unter Warzen (Papillomaviren). Sein Selbstwertgefühl war klein, er fühlte sich mies, er brauchte und suchte meine Nähe. In so einem Moment der körperlichen Nähe „vergass“ ich das Präservativ. Und obwohl er bereits Medikamente einnahm, steckte ich mich an.“ Liebeskummer und Suizidgedanken Als ihm sein Arzt den positiven Status mitteilt, ist das für René W. eine Katastrophe. Aber eine, die er mit keinem Menschen teilen will, teilen kann. Nicht mit seinen konservativen Pflegeltern, denn die hatten bereits grosse Mühe mit seiner Homosexualität und seinem Coming-out. Auch nicht mit seinem leiblichen Vater, nicht mit Freunden. Kurz vor der Diagnose hatte er sich auch von seinem Partner getrennt. René W.: „Ich liess mir nichts anmerken. Ich markierte den starken Mann, dabei fühlte ich mich total mies. Ich habe mich so geschämt. Die Mischung aus Liebeskummer und Diagnose HIV-positiv brachte mich beinahe um. Doch als Selbstständigerwerbender musste ich einfach funktionieren.“ René W. fällt in eine Depression. Telefonanrufe nimmt er nicht ab, er pflegt keine Kontakte mehr. Einzig die Arbeit zwingt ihn nach draussen. Die Abwärtsspirale dreht sich immer schneller. Er überlegt, wie er sich umbringen kann. Er will sich die Pulsadern aufschneiden, schafft es aber nicht und fühlt sich noch schlechter. René W. dachte: „Ich bin so ein Feigling, ich kann mich nicht mal umbringen. Und jetzt?“ Er will sterben, und jeden Tag fordert er seine Viren auf, sich rasant zu vermehren und ihn bald zu erlösen. An seinem Geburtstag sind 25 WAT Dossier 2014
seine Werte so schlecht, dass sein Arzt dazu rät, sofort mit der Behandlung zu beginnen.
Nicht wirklich überzeugt von deren Wirkung, willigt René W., quasi als Geburtstags-
geschenk für sich selber, ein. Die Nebenwirkungen sind happig und bald denkt der Arzt
über einen Therapiewechsel nach. Ein Apotheker gibt ihm den entscheidenden Tipp zur
Medikamenteneinnahme – kurz vor dem Einschlafen einnehmen – der Wirkung zeigt.
Langsam, langsam findet er den Ausweg aus seiner Lethargie, und sein Leben pendelt
sich wieder ein, mehr oder weniger.
„Der Welt-Aids-Tag ist ein Feiertag für mich. An diesem Tag zelebrieren wir
die Solidarität mit HIV-positiven Menschen. Wir werden sichtbar, wir zeigen
der Welt, dass wir unter euch sind. Diese Solidarität ist wichtig,
auch als Gegengewicht zu jenen, die uns noch immer stigmatisieren.“
Skol und eine neue Liebe
Ein Freund aus der Ferne, der als einer der wenigen weiss, wie es um René W. wirklich
steht, lädt ihn zu Ferien auf Grand Canaria ein. René W.: „Weihnachten stand an, und ich
hatte überhaupt keine Lust, mit meiner Familie zu feiern. Dieses Friede-Freude-Eier-
kuchen-Getue war für mich zu diesem Zeitpunkt ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann
geschah es am Jahreswechsel, an der Tür zu einem Fetischclub. Er überreichte mir einen
Drink, sagte 'Skol!', und ich war hin und weg. So ein erotisch schöner Mann!“ Bald darauf
ist der erste Flug nach Dänemark gebucht, und die Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf.
Auch das Positiv-Outing von René W. schreckt den neuen Mann in seinem Leben nicht ab.
Denn der schöne Mann aus Skandinavien lebte bereits mit einem HIV-positiven Mann
zusammen. Eine neue Erfahrung für René W., zogen doch bis anhin alle seine Bekannt-
schaften, die über eine Sexgeschichte hinausgingen, die Reissleine, wenn sie von seinem
Status erfuhren. „Weisst du, ich habe keine Angst vor einer Ansteckung. Aber ich könnte
dich nicht pflegen oder gar in den Tod begleiten“, hört René W. mehr als einmal.
Überhaupt staunt er immer wieder darüber, dass unter Schwulen das Thema HIV und Aids
oft nicht zur Sprache kommt. Man weiss vieles rund um die Infektion, man weiss, dass
dieser oder jener Mann positiv ist, aber darüber sprechen, sich damit auseinandersetzen
mag man doch nicht.
Im Leben angekommen
Auf der Regenbogenwolke schwebend, entschliesst sich René W. sein Leben wieder in
die Hand zu nehmen und sich mehr auf die Ups und weniger auf die Downs zu
konzentrieren. Er realisiert aber auch, wie viel er in Bezug auf seine Homosexualität, in
Bezug auf HIV, seine Kindheit bei Pflegeeltern etc. verdrängt hat. Ein Psychologe des
Checkpoint Zürich (mycheckpoint-zh.ch) unterstützt ihn auf seinem Weg. Er macht die
Erfahrung, dass „darüber reden“ heilsam ist. Erzählen, sich öffnen als Therapie. Im
Rückblick bezeichnet René W. seine Diagnose als Startschuss zu einer Metamorphose:
„Die Verwandlung eines Würmchens in einen selbstbewussten Schmetterling, der seine
Flügel ausbreitet und das Leben geniesst.“
Das schönste Geschenk macht ihm sein leiblicher Vater zu seinem 50. Geburtstag. 13
Jahre nach seiner Diagnose zeigt er u.a. voller Stolz vor versammelter Festgemeinde
einen TV-Bericht über seinen HIV-positiven Sohn. Renè W. ist angekommen.
* Name geändert
26 WAT Dossier 2014Interviews mit Fachpersonen aus dem
Bereich HIV
„Wir müssten auf sie zugehen und sie an unserem guten
Gesundheitssystem teilnehmen lassen“
Fana Asefaw, gebürtige Eritreerin, Oberärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie an der Klinik Clienia Littenheid, durfte von
derselben im Oktober den Preis für Soziales Engagement ent-
gegennehmen. Dies für ein HIV-Aufklärungsprojekt in Eritrea.
Auch in der Schweiz setzt sich Asefaw für die Belange
eritreischer Flüchtlinge ein, unter anderem ist sie
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Unterstützungskomitees
für Eritrea (SUKE).
Frau Asefaw, Eritrea gehört zu den afrikanischen Ländern mit vergleichsweise
niedrigen HIV-Prävalenzen. Allerdings gibt es Hinweise, dass HIV-Infektionen bei
den in der Schweiz lebenden rund 15'000 Eritreerinnen und Eritreern deutlich
häufiger sind als in Eritrea selbst. Gibt es dafür eine Erklärung?
Die Erklärung dafür ist auf dem Weg hierher zu suchen. Vor allem Frauen erleben auf der
Flucht teilweise mehrfach sexuelle Übergriffe. Patientinnen erzählen immer wieder von
erschütternden Erlebnissen vor allem in Libyen und dem Sinai, den Transitrouten für
Eritreerinnen und Eritreer nach Europa. Auch unabhängige Berichte zeigen, dass
eritreische Frauen dort in Gefängnissen und von Schleppern und anderen Kriminellen
systematisch vergewaltigt werden. Dabei stecken sich nicht wenige Frauen mit HIV an.
Es sind also vor allem Frauen betroffen?
Es sind sicher mehr Frauen betroffen, aber nicht nur. Es findet im Übrigen auch nicht nur
erzwungener Sex statt auf der Flucht. Doch viele Menschen aus Eritrea sind sich der
Risiken von ungeschütztem Sex überhaupt nicht bewusst, was HIV betrifft. In Eritrea leben
sie oft nach strengen Sitten, Sex ist stark tabuisiert, HIV-Aufklärung gibt es kaum – nur
eine NGO betreibt Aufklärung und Prävention. Wenn dann auf der Flucht plötzlich jede
soziale Kontrolle fehlt, haben gerade jüngere Menschen häufiger riskanten Sex.
Wenn sie sich der Risiken nicht bewusst sind, lassen sie sich auch nicht auf HIV
testen?
Genau. Oft wissen sie deshalb nicht von der eigenen Infektion, wenn sie die Schweiz
erreichen.
Werden sie hier aufgeklärt, sodass sie einen HIV-Test machen können?
Die meisten Menschen, die aus Eritrea in die Schweiz kommen, erhalten in den Asyl-
empfangszentren einige grobe Informationen über verschiedene Krankheiten und über das
Gesundheitswesen hier. Aber die Informationen kommen kaum an, weil die Menschen in
dem Moment ganz andere Sorgen haben. Bei vielen HIV-infizierten Eritreerinnen und
Eritreern wird die Infektion deshalb erst später diagnostiziert. Häufig ist es ein Zufalls-
27 WAT Dossier 2014befund: Der Verdacht auf eine HIV-Infektion entsteht bei der Abklärung wegen etwas anderem. Wie gestaltet sich dann die medizinische Betreuung? Sie haben in einem Interview gesagt, Sie würden immer wieder von Ärztinnen und Ärzten kontaktiert, die Hilfe suchen im Umgang mit Patientinnen und Patienten aus Eritrea. Die Sprache ist das erste Problem: Viele Eritreerinnen und Eritreer sprechen nur Tigrinya und verschiedene lokale eritreische Sprachen. Hinzu kommen oft kulturell bedingte Miss- verständnisse zwischen Schweizer Ärzten und eritreischen Patienten. Können Sie ein Beispiel nennen? Frauen aus Eritrea sprechen selten für sich selbst. In ihrer Kultur ist es Brauch, dass ein anderes Familienmitglied mit zum Arzt kommt und die Probleme benennt. Und wenn man doch von sich selbst spricht, dann nur indirekt und verklausuliert. Das erschwert die Kom- munikation natürlich ungemein, umso mehr, als Eritreerinnen und Eritreer zum Teil völlig andere Vorstellungen über Ursachen von Krankheiten haben und darüber, wie man sie behandelt. Das müssen Sie erklären. Ich hatte gerade heute eine Patientin aus Eritrea, die war zuvor schon bei mehreren Ärzten, die ihr nicht helfen konnten. Sie klagte über Schmerzen an diversen Orten, unter anderem in einer Fettwulst am Arm. Nach einer halben Stunde war klar: Man muss sich nicht um die Fettwulst kümmern – bei dieser Patientin äussert sich eine tiefe traumatische Erfahrung von Flucht und von einem zurückgelassenen schwer kranken Mann in physischem Schmerz. Diese Patientin benötigt psychotherapeutische Betreuung, keine Schmerzmedikamente. Vermindern solche Missverständnisse eine gute HIV-Therapie? Ja, das kann sich schlecht auf die HIV-Therapie auswirken. Denn es fehlt das notwendige Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Selbst mit Schweizer Patientinnen und Patienten beginnt man ja oft erst nach langer Vorarbeit mit der HIV-Therapie, wenn eine Vertrauens- basis besteht. Aber die erreicht man kaum, wenn sich der Patient überhaupt nicht ver- standen fühlt, jederzeit mit seiner Ausweisung rechnen muss und ein unbehandeltes Trauma hat. Diese Dinge liegen natürlich nicht in der Hand des HIV-Spezialisten. Das ist das Problem: Es kommen so viele Dinge zusammen, dass sich meistens niemand mehr zuständig fühlt. Das medizinische, aber auch das soziale System ist schlecht auf so komplexe Situationen vorbereitet, wie sie bei vielen eritreischen Patientinnen und Patienten vorliegen. Sie haben es unter grossen Entbehrungen bis hierher geschafft, in den vermeintlich sicheren Hafen – und hier lässt man sie alleine. Wie kann man dafür sorgen, dass diesen Menschen besser geholfen wird? Ich habe den Eindruck, Flüchtlinge aus Eritrea werden häufig bloss als Belastung und Kostenpunkt wahrgenommen. Das ist beschämend. Stattdessen müssten wir auf sie zu- gehen, sie an unserem guten Gesundheitssystem teilhaben lassen. Auch wenn das heisst, dass man mehr transkulturelle Übersetzer engagieren muss, dass man sich mehr Zeit nehmen muss, dass man sich zwischen verschiedenen medizinischen Fachpersonen besser absprechen muss. Die HIV-Medizin hat so grosse Fortschritte gemacht, und doch gibt es selbst hier in der Schweiz HIV-positive Menschen, die davon kaum profitieren. Das dürfen wir nicht zulassen. 28 WAT Dossier 2014
Sie können auch lesen