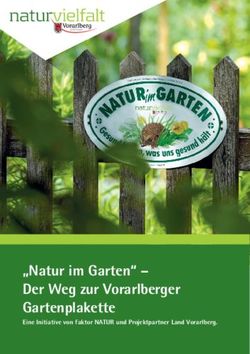Allergien im Garten? Tipps zur Gartengestaltung für Menschen mit Allergien.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Ratgeber „Allergien im Garten?“
des Deutschen Allergie- und
Asthmabundes (DAAB)
Liebe Leserinnen und Leser,
zu den Folgen des Klimawandels zählt auch die Verbreitung
allergener Pflanzenarten. Umso wichtiger ist es zu wissen,
wie man die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken möglichst gering halten kann.
Die einfachsten Maßnahmen lassen sich im eigenen Garten umsetzen. Hier finden wir in-
zwischen immer öfter Pflanzen, die aus anderen Weltregionen stammen und teilweise ein
hohes Allergiepotenzial in sich tragen. Nur mit dem nötigen Wissen über die entsprechen-
den Pflanzenarten kann eine mögliche allergene Sensibilisierung durch Anpflanzungen
vermieden werden. Der vorliegende Ratgeber des Deutschen Allergie- und Asthmabundes
gibt Ihnen die notwendigen Informationen und viele praktische Tipps, wie Sie die Ge-
sundheit Ihrer Familie und Ihrer Nachbarn wirksam schützen können.
Ihre
Dr. Barbara Hendricks
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Dieser Ratgeber wurde im Rahmen des Projektes „Klimawandel und Neue Allergene“
gefördert durch das Umweltbundesamt (UBA) mit Mitteln des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Mittelbereit-
stellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung
für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Deutschen Allergie- und
Asthmabund (DAAB).
1
Als Bestandteil des Projektes hält der DAAB auf der Internetseite www.daab.de
weitere Infos für Sie bereit.
2 Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
Liebe Leserinnen und Leser, Liebe Leserinnen und Leser,
immer mehr Kinder und Erwachsene haben Allergien können körperlich und seelisch sehr
eine oder mehrere Allergien. Beschwerden belastend sein. Und sie können in ihrem
durch Pollenflug starten oftmals schon im Schweregrad zunehmen, wenn sie nicht
Winter mit den ersten Frühblühern wie der zutreffend diagnostiziert und ausreichend
Hasel und dauern für so manchen bis zum behandelt werden. Auslöser allergischer Be-
November mit den letzten Gräsern und schwerden sind sogenannte Allergene, zum
Kräutern noch an. Beispiel Pflanzenpollen. Ein Mensch mit
Es wird angenommen, dass der Klimawan- einer Allergie kann „sein“ auslösendes Aller-
del dazu beiträgt, dass die Pollenflugsai- gen meiden, wenn er es kennt (Diagnostik!)
son inzwischen fast ganzjährig andauert. und wenn es vermeidbar ist – wie im Fall
Was kann man im eigenen Garten oder von Allergien gegen bestimmte Nahrungs-
auch auf der Terrasse, dem Balkon tun, um mittel. Aber auch der Kontakt mit luftge-
nicht noch im direkten Umfeld zusätzlich tragenen Allergenen wie Pflanzenpollen
unter Allergien zu leiden? lässt sich reduzieren. So ist auf der Inter-
Und wie kann ein schöner Garten unter Al- netseite des Deutschen Wetterdienstes
lergiegesichtspunkten aussehen? Der oft- eine tagesaktuelle Pollenflugvorhersage
mals vermutete „einfache“ Garten, der nur zu finden, mit deren Hilfe Pollenallergiker
noch aus Steinen und einigen Koniferen an Tagen mit entsprechender Pollenbelas-
besteht, hat sich meist als die schlechtere tung abwägen können, welche Aktivitäten
und wenig pflegeleichte Lösung entpuppt. im Freien in dieser Zeit wirklich notwendig
Mit diesem Ratgeber erhalten Sie erste sind. Darüber hinaus lässt sich der eigene
Hinweise und Ideen. Garten allergenarm gestalten. Wie das
geht? Der vorliegende Ratgeber verrät es
Ihnen. Viel Freude bei der Lektüre.
Andrea Wallrafen Ihre
Bundesgeschäftsführung Maria Krautzberger
Deutscher Allergie- und Asthmabund Präsidentin des Umweltbundesamtes
3
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Deutscher Allergie- und
Asthmabund (DAAB)
Der DAAB arbeitet seit über einhundert Jahren
(gegründet 1897) als Verbraucherschutzorga-
nisation für Kinder und Erwachsene mit Aller-
gien, Asthma, Lebensmittelunverträglichkeiten,
Neurodermitis und Urtikaria. Bei uns finden Sie
Experten, die unabhängig und neutral beraten
und konkrete Vorschläge und Hilfen bieten – von
der richtigen Hautpflege bis zur Ernährungsbera-
tung.
Das DAAB-Beratungsteam kommt aus den Be-
reichen Ernährungswissenschaft, Biologie und
Chemie, Asthma-, Anaphylaxie- und Neurodermi-
tisschulung. Unterstützt werden wir von einem Netzwerk aus Ernährungsfachkräften,
Wissenschaftlern, Hebammen sowie Initiativen vor Ort. Die Beratung im DAAB ist ge-
prägt vom jährlichen Austausch mit über 30.000 Ratsuchenden. So erfahren wir, welche
Methoden oder Produkte helfen oder aber auch nicht wirken. Diese Erfahrungen setzt der
DAAB um im Dialog mit Verbraucherschutz, Handel, Unternehmen, bei Krankenkassen
und in der Politik. Wir setzen uns dort ein, wo Menschen mit Allergien, Atemwegs- und
Hauterkrankungen eine Stimme brauchen (www.daab.de/aktionsprogramm/).
Wir helfen durch Recherchen und Bezugsquellen – etwa bei der Suche nach Produkten,
die „Ihre“ Allergieauslöser nicht enthalten. Dazu bieten wir zahlreiche Ratgeber und
Hilfsmittel wie Allergiepass, Ernährungstagebuch, Anaphylaxie-Notfallpläne und vieles
mehr. Unser Magazin „Allergie konkret“ bietet immer neue Informationen zu Allergien,
Ernährung und Co. sowie Marktchecks, News aus der Forschung und Tipps für den Alltag.
Unterstützen Sie unsere Arbeit
werden Sie Teil unseres Teams.
www.daab.de
DAAB-Spendenkonto:
Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN: DE82 3105 0000 0000 1759 50
BIC: MGLSDE33
4
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist eine Allergie?
1.1. Wichtig: Frühzeitige Allergietherapie
1.2. Allergieauslöser im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon
2. Pollen: Mit ihnen sichern Pflanzen ihre Vermehrung
2.1. Pollenverbreitung: windblütig oder insektenblütig?
2.2. Baumpollen als Allergieauslöser und Kreuzreaktionen
2.3. Auch an Koniferen denken …
2.4. Pollenallergien auf krautige Pflanzen
2.5. Allergieauslöser Gräserpollen
2.6. Am liebsten Rasen?
3. Pollenallergien und Klimawandel
3.1. Die Pflanzenvegetation verändert sich
3.2. Invasive Pflanzen
3.3. Invasiv und stark allergen: Ambrosia artemisiifolia
3.3.1. Ambrosia erkennen, Verwechslungen vermeiden
3.3.2. Ambrosia: Empfehlungen zur Bekämpfung
3.4. Das Mittelmeer im Garten: Olive und Co.
3.5. Neues Pflanzenangebot in Gartencentern
4. Schimmelpilze im Garten
5. Kontaktallergien durch Pflanzen
6. Gartengestaltung für Menschen mit Allergien - Geht das?
6.1. Tipps für die Gartenplanung und -gestaltung
6.2. Bodenbeschaffenheit: Der Knet-Test
6.3. Bepflanzung planen
6.4. Allergien im Blick
6.5. Windblütige Pflanzen
6.6. Insektenblütige Pflanzen
6.7. Grüne Pollenfilter
7. Beispiele vorwiegend allergiefreundlicher Pflanzen bei Pollenallergie
8. Hilfreiche Adressen, weiterführende Informationen
5
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.1. Was ist eine Allergie?
Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immun-
systems auf eigentlich harmlose Stoffe wie Pollen,
Lebensmittel oder Hausstaubmilben. Allergische
Reaktionen sind in Ausprägung und Intensität sehr
unterschiedlich. Sie reichen von laufender, ver-
stopfter Nase und tränenden Augen – den klassi-
schen Beschwerden des „Heuschnupfens“ – über
Juckreiz, Hautausschlag, Ekzemen bis hin zu
Magen-Darm- sowie Atembeschwerden. Die
stärkste Reaktionsform ist der Allergische Schock
(Anaphylaxie), bei dem es bis zum Kreislauf-
zusammenbruch und Herzstillstand kommen kann.
Bei Atemwegsallergien kann es zum sogenann-
ten Etagenwechsel kommen. Aus einem Heu-
schnupfen kann dann ein allergisches Asthma
bronchiale entstehen. Die richtige Therapie
lindert die Allergiebeschwerden und reduziert das Risiko für die Entstehung eines Asthma
bronchiale. In Deutschland sind nach Studien bis zu 30 Millionen Menschen von Allergien
betroffen.
1.1 Wichtig: Frühzeitige Allergietherapie
Besteht ein Allergieverdacht, ist auf jeden Fall eine umfassende Allergiediagnostik
durch allergologisch erfahrene Ärzte notwendig. Erste Hilfe zur Linderung, bei-
spielsweise bei akuten Heuschnupfen-Beschwerden, ermöglichen sogenannte Anti-
histaminika, antiallergische Wirkstoffe, die in Tabletten-, Spray- oder Tropfenform meist
rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind. Die Einnahme dieser Medikamente sollte aber
nicht dauerhaft ohne ärztliche Begleitung erfolgen. Bei stärkeren Reaktionen wie einer
entzündeten Nasenschleimhaut oder einer Beteiligung der unteren Atemwege (Allergi-
sches Asthma bronchiale) können antientzündliche Medikamente, mit gering dosierten
Cortison-Wirkstoffen (Nasenspray, Asthma-Spray oder Pulverinhalator), erforderlich sein.
Bei gängigen Allergieauslösern kann
langfristig die Spezifische Immun- Wie sieht die richtige Diagnostik aus?
therapie (Hyposensibilisierung) eine Was bedeutet mein Allergietestergebnis?
gute und anhaltende Linderung Welche Therapie hilft jetzt? Antworten
erreichen. erhalten Sie als Mitglied beim DAAB
(info@daab.de oder 0 21 66 / 64 78 8-20)
6
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
1.2 Allergieauslöser im Garten,
auf Terrasse und Balkon
Theoretisch kann jede Pflanze Auslöser einer Allergie oder
Überempfindlichkeitsreaktion sein. Atemwegsallergien durch
Pollen stehen hierbei meist im Vordergrund. Durch Haut-
kontakt mit Pflanzenteilen können aber auch Kontakt-
allergien oder Reizreaktionen an der Haut ausgelöst werden.
Daher sollte untersucht werden, wie und auf welche Allergen-
gruppen man reagiert, da es spezifische Allergene gibt und
solche, deren Allergenstruktur auch bei anderen Pflanzen vor- Hasel: Kätzchenblüten
kommt (Kreuzallergien). mit Pollen
Auch Schimmelpilzsporen können als Allergieauslöser eine Rolle
spielen, besonders im Hochsommer und im Herbst. Menschen mit einer Allergie gegen Insek-
tengift (z.B. Biene, Wespe) müssen bei der Arbeit im Garten besonders vorsichtig sein.
2. Pollen: Mit ihnen sichern Pflanzen
ihre Vermehrung
Pflanzen produzieren Pollen (männlicher Blütenstaub), um sich zu vermehren. Aus den
bestäubten weiblichen Blüten entwickeln sich die Früchte mit den Samen. Das jeweilige
Pollenvorkommen ist jahreszeitlich bedingt und wird durch Temperatur, Witterung und
Windverhältnisse beeinflusst. Dabei ist die Stärke der Beschwerden sowohl von der Pollen-
konzentration und dem Allergengehalt der Pollen als auch von der individuellen Aller-
giebereitschaft abhängig. In Deutschland werden die meisten
Pollenallergien bislang durch Frühblüher (Hasel, Erle, Birke),
Gräser (auch Roggen) und Kräuter wie Beifuß ausgelöst.
Menschen mit Pollenallergien müssen nicht alle Pflanzen
meiden. Es muss diagnostiziert werden, auf welche pflanzlichen
Auslöser Allergien bestehen. Sind diese bekannt, sollte man
sich über die Blütezeit, die Pflanzenfamilie mit ihren typischen
Vertretern und eventuelle Kreuzreaktionen informieren.
Weitere Informationen über die Auslöser von Heuschnupfen
lesen Sie im DAAB-Ratgeber Pollen- und Kreuzallergien.
Sie können ihn kostenfrei bestellen unter info@daab.de
Beifuß (Artemisia oder telefonisch: 0 21 66 / 64 78 8-20.
vulgaris)
7
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.2.1 Pollenverbreitung:
wind- oder insektenblütig?
Die Verbreitung der Pollen erfolgt entweder durch
den Wind, dabei werden die Pollen aus der Blüte
ausgeschüttet und vom Wind auf andere Blüten
übertragen (Windblütler) oder die Pollen haften
sich an Insekten an, die die Blüte besuchen, und
werden von diesen Insekten zu den weiblichen
Blüten gebracht (Insektenblütler).
Biene an Krokusblüte
Einige Pflanzen nutzen beide Arten der Pollenver-
breitung, sind also sowohl wind- als auch insektenblütig (z.B. die Weide). Im Unterschied
zu den insektenblütigen Pflanzen haben windblütige Pflanzen in der Regel unauffällige
Blüten und produzieren sehr große Mengen an Pollen. Dies ist wichtig, um ihre Vermehrung
zu sichern. Ihre Pollenkörner sind sehr klein und
leicht und werden kilometerweit durch den
Wind verbreitet. Zu den Windblütlern gehören
unter anderem Bäume mit Kätzchenblüten wie
Hasel, Erle oder Birke.
Auch die Pollen von Gräsern und krautigen Pflanzen
wie Beifuß oder Ambrosia (Korbblütler), Gänsefuß,
Ampfer, Wegerich, Brennnessel oder von Koniferen
wie Lebensbäumen, Fichten, Zedern, Zypressen
und Kiefern werden durch den Wind verbreitet.
Insektenblütige Pflanzen sind nicht auf eine Ver-
breitung ihrer Pollen durch den Wind angewiesen.
Daher kommen ihre Pollen in der Regel nur in ge- Wespe
ringen Konzentrationen in der Außenluft vor.
Bei bestehender Pollenallergie auf eine insektenblütige Pflanzenart sind allergische
Reaktionen daher besonders bei direktem Kontakt bzw. in direkter Nähe zu der jeweiligen
Pflanze zu erwarten.
Insektengiftallergiker sollten Pflanzen, die Bienen und Wespen anziehen, nicht
in der Nähe von Sitzplätzen im Garten pflanzen, sondern ein bienenfreundliches
Staudenbeet oder Obstbäume und -sträucher in einem weniger genutzten Gartenteil
ansiedeln. Infos zur Insektengiftallergie unter: www.daab.de
8
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
2.2. Baumpollen als Allergieauslöser
und Kreuzreaktionen
Neben Hauptauslösern wie den Frühblühern (Hasel, Erle, Birke),
die zu den Birkengewächsen und mit den Buchen- und Wal-
nussgewächsen zu den sogenannten Buchenartigen gehören,
können auch weitere Baumpollen, wie beispielsweise die
Pollen der Buche, Eiche, Esche, Hainbuche, Platane, Pappel,
Ulme, Weide oder auch die Pollen des in Deutschland nicht
heimischen Olivenbaums zu Allergien führen. Darüber hinaus
werden vermehrt wärmeverträglichere Arten, wie die nicht
heimische Purpurerle angepflanzt, die die Pollenflugzeit für
Allergiker deutlich nach vorne verschieben können. Je nach Esche
Witterung blüht die Purpurerle oft schon einige Wochen früher
als die heimischen Erlen. Neben spezifischen Sensibilisierungen auf Baumpollen, können
auch Kreuzreaktionen auf ähnliche allergene Strukturen anderer Baumpollen vorliegen.
Beispielsweise können bei einer Birkenpollenallergie daher auch Kreuzreaktionen auf
weitere Baumarten wie Hasel, Erle, Buche, Hainbuche, Hopfenbuche, Eiche, Walnuss oder
Edelkastanie vorkommen.
Esche: Pollen aus der Familie der Ölbaumgewächse
Die unscheinbaren rötlichen Blüten der heimischen Esche erscheinen zeitlich gesehen
vor den Blättern. Die Esche ist ein windblütiger Baum, wird aber auch von Bienen be-
sucht. Ihre Blütezeit reicht von April bis Mai. Die Esche gehört zu den Ölbaumgewächsen.
Allergiker, die auf Eschenpollen reagieren, können Kreuzreaktionen auf Pollen weiterer
Ölbaumgewächse wie Flieder, Jasmin, Liguster,
Forsythie oder sogar Olivenbäume zeigen, da in
all diesen Pollen ähnliche Allergene vorliegen.
Auch Patienten, die eine Sensibilisierung gegen
Olivenpollen mit relevanter Allergie erworben
haben, können Kreuzreaktionen gegenüber anderen
Ölbaumgewächsen zeigen.
Eine Eschenpollenallergie kann mit einer
Birkenpollenallergie verwechselt werden, da
sich ihre Blütezeiten überlagern. Das ist bei
der Allergiediagnostik zu bedenken und kann
durch sie unterschieden werden.
9
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.2.3 Auch an Koniferen
denken…
Koniferen, also sämtliche Nadelgehölze wie Thuja
(Lebensbaum), Eibe, Wacholder, Zypresse, Schein-
zypresse, Zeder, Douglasie, Lärche, Kiefer, Tanne
oder Fichte, gehören zu den Windblütlern.
Immergrüne Nadelgehölze sind beliebte Pflanzen
in Gärten und Vorgärten. Inzwischen werden viele
Arten auch als zwergwüchsige Sorten angeboten.
In Deutschland gehören Koniferen bisher nicht zu
den häufigen Allergieauslösern. Ob in Zukunft eine
Eibe mit Pollenwolke zunehmende Pollenbelastung durch die verstärkte
Verwendung dieser Pflanzengruppe in Gärten und
öffentlichen Grünflächen besteht, sollte wissenschaftlich be-
obachtet werden. Beispielsweise gibt es bei der Eibe weibliche
und männliche Pflanzen, die männlichen Pflanzen setzen im
April regelrechte „Pollenwolken“ frei.
Tabelle 1: Blütezeiten verschiedener Koniferen
Koniferen Hauptblütezeit
(Witterungsbedingt evt. früherer Start
und/oder späteres Ende möglich)
Zypresse Ende März-Mai, (Südeuropa: Ende Jan-März)
Eibe März – April
Thuja
Lärche März – Mai
Douglasie April – Mai
Pollenflugzeiten
Scheinzypresse April – Mai der Hauptaus-
Thuja April – Mai, witterungsbedingt auch früher löser wie der Birke
(Hauptblüte Ende
Wacholder Ende April – Anfang Juni März bis Mitte Mai)
Kiefer April – Juni, Hauptblüte Mitte Mai können sich auch
mit Blütezeiten
Fichte Mai – Juni von Koniferen
Zeder September – Oktober überlagen.
10
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
2.4 Pollenallergien auf krautige Pflanzen
Beifuß- und Ambrosiaarten (Korbblütler) gehören zu den am meisten beachteten Aller-
gieauslösern unter den krautigen Pflanzen.
Es gibt viele Kräuter, die mit dem Beifuß verwandt sind und ebenfalls zur Gattung
Artemisia gehören. Dazu zählen beispielsweise Edelraute (Artemisia umbelliformis), Eber-
raute (Artemisia aboratum, Cola-Strauch), Estragon (Artemisia
dracunculus), Wermut (Artemisia absinthium) und das Ameri-
kanische Moxakraut (Artemisia douglasiana/Präriebeifuß). Sie
können bei einer Beifußallergie zu Kreuzreaktionen führen.
Andere krautige Pflanzen werden bislang seltener als Allergie-
auslöser genannt wie etwa Brennnesselgewächse (Urticaeae),
Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae), z.B. Fuchsschwanz
(Amaranth) oder Pflanzen der Unterfamilie Gänsefußgewächse
(Chenopodiaceae) wie der Weiße Gänsefuß, Melden sowie We-
gerich- (Plantaginaceae, z.B. Spitzwegerich) und Knöterichge- Spitzwegerich
wächse (Polygonaceae, z.B. Ampfer) und weitere Pflanzen aus
der Gruppe der Korbblütler (Asteraceae).
Die Hauptblütezeit der Brennnesseln liegt zwischen Mai und Okto-
ber, Spitzenwerte der Pollenbelastung misst man im Juli/August.
Je nach Witterung kann die Blüte auch darüber hinaus andauern.
Bei Brennnesseln erfolgt Windbestäubung. Brennnesseln sind
wichtige Nahrungspflanzen für viele Schmetterlingsraupen.
Tabelle 2: Blütezeiten verschiedener krautiger Pflanzen
Pollenquelle Kräuter Hauptblütezeit
Brennnessel Mai – Oktober Breitwegerich
Wegerichgewächse
(z.B. Spitzwegerich) Mai – Oktober
Knöterichgewächse z.B. Ampfer Mai – August
Fuchsschwanzgewächse
(z.B. Amaranth) Juni – Oktober
Unterfamilie Gänsefußgewächse
(Weißer Gänsefuß, Melde) Juli – September
Beifuß (und weitere Artemisia-Arten
wie Estragon, Wermut) Juli – September
Ambrosia artemisiifolia und
weitere Arten Juli/August – Oktober Brennnessel
11
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.2.5 Allergieauslöser Gräserpollen
(Süßgräser, Familie Poaceae)
Die Hauptpollensaison der Gräser verläuft von Mai bis ein-
schließlich Juli, geringere Gräserpollenbelastungen können
aber auch schon im April und bis in den November hinein be-
stehen. Bei den einzelnen Gräsern liegen ähnliche allergene
Strukturen vor, so dass Gräserpollen-Allergiker vom Frühjahr
Wiesenknäuelgras bis zum Herbst unter ihrer Allergie leiden können. Wichtige
(Dactylis glomerata) Auslöser einer Gräserpollenallergie sind in Deutschland Wiesen-
gräser wie das Wiesenlieschgras, Wiesenfuchsschwanz, das
Wiesenknäuelgras, das Wiesenrispengras, das Weidelgras
(Lolch, Lolium perenne) oder das Gewöhnliche Ruchgras. Der
Roggen gehört auch zu den Süßgräsern und sorgt von Ende Mai
bis Juni ebenfalls für allergische Reaktionen.
2.6 Am liebsten Rasen?
Rasenflächen im Garten werden meist regelmäßig vor dem Ein-
treten der Blühperiode gemäht. Der beim Mähen austretende
Pflanzensaft enthält pollenverwandte Allergene und kann Heu-
schnupfen auslösen. Außerdem können sich Pollen anderer
Pflanzen, aber auch Pilzsporen und Staub zwischen den Gras-
halmen ansammeln und beim Mähen aufgewirbelt werden.
Wiesenfuchsschwanz Graspollenallergiker sollten im Garten am besten auf Rasen und
(Alopecurus pratensis) Ziergräser verzichten oder das Rasenmähen einem beschwerde-
freien Familienmitglied übertragen.
Zu den Süßgräsern gehören auch Bambus oder Ziergräser wie
Pampasgras, Lampenputzer-, Bermuda- oder Pfeifengräser, die
als Allergieauslöser bisher eine untergeordnete Rolle spielen,
aber während ihrer Blütezeit auch allergische Reaktionen bei
Gräserpollenallergien hervorrufen können. Auch Hautreaktionen
sind möglich, dies ist z.B. für Bambus belegt. Auch Mais ist
ein Süßgras. In der Nähe zu blühendem Mais kann sich eine
Gräserpollenallergie verstärken, weil auch der Maispollen ähn-
liche allergene Strukturen aufweist.
Chinaschilf, ebenfalls ein Süßgras, sollte lieber nicht im Garten
Chinaschilf angepflanzt werden, da es sich durch Wurzelbruchstücke ver-
(Miscanthus sinensis) mehren und andere Pflanzen verdrängen kann.
12
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
3. Pollenallergien
und Klimawandel
Der Klimawandel hat gravierende Aus-
wirkungen auf die Umwelt und wirkt
sich auch auf die Pollenbelastung
aus. Bei frühblühenden Pflanzen hat
sich die Blütezeit bereits nach vor-
ne verschoben, bei später im Jahr
blühenden Pflanzen dehnt sich die
Dauer der Pollenproduktion aus.
Die Allergenität der Pollen und die Pollenmenge können sich erhöhen. Der pflanzliche
Jahreszyklus ist von Tageslänge und Temperatur abhängig. Höhere Temperaturen kön-
nen das Pflanzenwachstum und die Pollenproduktion steigern. Letztere ist auch direkt
von der Photosyntheseleistung und den dazu zur Verfügung stehenden Kohlendioxid-
(CO2) und Wassermengen abhängig. In Zukunft wird ein starker Anstieg des Klimawandel
verursachenden Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in der Luft erwartet. Treibhausgase,
Feinstaub und bodennahes Ozon entstehen zu einem großen Teil durch Energiewirtschaft,
Industrieprozesse und Straßenverkehr und zudem durch übermäßigen Einsatz von Stick-
stoffdüngern. Eine erhöhte CO2-Konzentration führt zu mehr Biomasse, dadurch kann es zu
einer stärkeren Pollenproduktion kommen. Luftschadstoffe wie Stickstoffdioxid (NO2), Fein-
staub und Ozon können zu einer morphologischen und funktionellen Veränderung der Pollen
führen und so eine erhöhte Allergenität der Pollen bewirken. In Städten sind Temperatur,
CO2- und Luftschadstoff-Konzentrationen in der Regel höher als auf dem Land. Somit
kann auch die Pollenbelastung und die Allergenität der Pollen in der Stadt erhöht sein.
3.1. Die Pflanzenvegetation verändert sich
Durch ein verändertes Klima können sich
Pflanzen, die normalerweise nicht bei uns
heimisch sind, besser ansiedeln und im Laufe
der Zeit stärker ausbreiten. Durch die globale
Temperaturerhöhung kann sich das Verbreitungs-
gebiet von Pflanzen- und Tierarten von Süden
nach Norden verschieben bzw. erweitern. Ein
Beispiel ist die Beifußblättrige Ambrosia, deren
Pollen starke allergische Reaktionen auslösen
und die in Zukunft ein wichtiger Allergieauslöser
Ambrosia werden könnte.
13
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.3.2. Invasive Pflanzen
Invasive Pflanzenarten nehmen insgesamt zu. Dies sind nicht-
heimische Arten, die mit einheimischen Pflanzen in Konkurrenz
treten und diese verdrängen können. Zudem können Pflanzen,
deren Lebensbedingungen sich durch den Klimawandel ver-
bessern, vermehrt vorkommen (Beispiele: Jacobskreuzkraut
oder Kanadisches Berufkraut). Nicht alle invasiven beziehungs-
weise sich ausbreitenden Pflanzen haben allergisches Potenzial
oder es ist bisher nicht untersucht beziehungsweise für Deutsch-
land beschrieben worden. Beispiele hierfür sind die Kanadi-
sche Goldrute (Solidago canadensis), das Schmalblättrige
Kanadisches Greiskraut (Senecio inaequidens), das Kanadische Berufkraut
Berufkraut (Conyza/Erigeron canadensis) und der Japanische Staudenknö-
terich (Fallopia japonica) sowie der Sacchalin-Staudenknöterich
(Fallopia sachalinensis). Dagegen sind beispielsweise die Bei-
fußblättrige Ambrosia oder der Olivenbaum in Gebieten, in
denen sie derzeit heimisch sind, relevante Allergieauslöser.
Beispiele für invasive Pflanzen in Deutschland und deren
allergisches oder phototoxisches Potenzial
Götterbaum (Ailanthus altissima, Bittereschengewächs)
Sommergrüner Laubbaum mit weißen Blütenrispen, Blütezeit
Juni – Juli, zweihäusig, riecht unangenehm, insektenblütig.
Vermehrt sich zunehmend in wärmeren Regionen, Städten,
auf Mittelstreifen an Autobahnen. Rinde und Blätter können
allergische Hautreizungen hervorrufen. Der Blütenstaub kann
Jacobskreuzkraut gegebenenfalls allergische Atemwegsreaktionen verursachen.
Pollen können in geringeren Mengen in der Luft
vorkommen. Baumfällen und Wurzelrodungen
nur mit Handschuhen/Schutzkleidung! Pflanzen-
teile nicht kompostieren.
Zum Thema „Invasive Pflanzen als
Allergieauslöser” finden Sie auch im
Rahmen des Projektes „Klimawandel und
neue Allergene” weitere Informationen
unter www.daab.de
Götterbaum
14
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
Essigbaum (Rhus typhina, Sumachgewächs)
Sommergrüner, zweihäusiger Laubbaum. Weibliche
Pflanzen mit roten Fruchtständen, männliche
mit weißen Blütenrispen (Blütezeit Juni – Juli,
insektenblütig). Essigbäume wurden besonders
in früheren Jahren gerne in Gärten angepflanzt.
Sie sind wärmeliebend und können sich durch
Ableger in die freie Natur ausbreiten. Alle Pflan-
zenteile, besonders der Milchsaft sind schwach
giftig. Bei Haut- oder Augenkontakt sind Ent-
zündungen möglich. Bei Entfernen der Gewächse
wird Schutzkleidung empfohlen. Pflanzenteile
nicht in den Kompost geben. Essigbaum
Riesen-Bärenklau (Herkulesstaude, Heracleum
mantegazzianum, Doldenblütler)
Der Riesenbärenklau wird bis zu 5 Meter groß und
hat kräftige, oft rot gesprenkelte, hohle Stängel. Die
Blätter sind fiederteilig mit spitzen Abschnitten.
Die Doldenblüten sind weiß (Blütezeit: Juli –
Sept., insektenblütig). Er kommt an Wald- und
Feldrändern sowie an Bächen vor. Der Pflanzensaft
enthält phototoxische Furocumarine. Gelangen sie
an die Haut, führt Sonnenstrahlung zu starker
Blasenbildung und Entzündungen. Die Pflanze
darf nicht ohne Schutz berührt werden. Ausge-
rissene Pflanzen nicht in den Kompost geben.
Verlot`scher Beifuß (Kamschatka-Beifuß, Riesen-Bärenklau
Artemisia verlotiorum, Korbblütler)
Der Kamschatka-Beifuß (auch Ligurischer Beifuß) duftet sehr aromatisch, hat kleine
kugelige, rötliche Blütenköpfe und 1– bis 2-fach fiederteilige Blätter mit zugespitzten
Abschnitten. Er blüht von September bis November und somit später als der Gewöhnliche
Beifuß. Der Kamschatka-Beifuß wird bereits vereinzelt in Süddeutschland gemeldet. Er
könnte sich in Zukunft weiter ausbreiten. Durch die späte Blüte soll die Vermehrung über
Wurzelausläufer im Vordergrund stehen. Bisher wird diese Beifußart als Allergieauslöser
nicht berücksichtigt. Sie kann aber bei einer Beifußallergie Kreuzreaktionen auslösen.
Dieser Beifuß sollte aber nicht im Garten angepflanzt werden, da er sich in die freie
Natur ausbreiten kann und die Bekämpfung der Wurzelausläufer schwierig ist. Ausge-
rissene Pflanzen nicht in den Kompost geben.
15
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.3.3. Invasiv und stark aller-
gen: Ambrosia artemisiifolia
Die Ambrosia gehört zur Familie der Korbblütler
(Asteraceae) und stammt ursprünglich aus Nord-
amerika. Sie blüht mit fingerförmigen, grün-
gelblichen Blütenständen, die sehr kleine, un-
scheinbare Blütenköpfchen tragen.
Die einjährige Pflanze erreicht Größen zwischen
30 bis 150 cm und blüht von Juli bis Oktober.
Ihre Pollen können starke Atemwegsallergien aus-
lösen. Bei Berührung der Pflanze mit der Haut
kann es zu Kontaktallergien kommen. Bisher
wurden Ambrosia-Bestände besonders in Süd-
und in Ostdeutschland entdeckt. Eine weitere
Ambrosia artemisiifolia Ausbreitung könnte in Deutschland zu einem
starken Anstieg von Ambrosia-Allergien führen.
Die Bekämpfung der Ausbreitung ist schwierig, da die Samen im Boden über Jahrzehnte
keimfähig bleiben. Die Pflanze kann sich in Privatgärten durch verunreinigtes Vogelfutter
unbemerkt ansiedeln und sich so durch „Verschleppung“ der Samen weiter auf Freiflächen
ausbreiten.
Ambrosia: männliche gelbliche Blüten mit grünen Hüllblättern (links), unscheinbare
weibliche Blüte (Mitte, Fotos: U. Starfinger, JKI), Ambrosia-Jungpflanze rechts
Ambrosiasamen in
Vogelfuttermischung
(links) und im Vergleich
mit Sonnenblumensamen
(rechts)
Fotos: U. Starfinger
16
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
3.3.1. Ambrosia erkennen,
Verwechslungen vermeiden
Die häufigste Verwechs-
lung von Ambrosia-Arten
erfolgt mit dem Gemei-
nen Beifuß (Artemisia
vulgaris, Asteraceae).
Beifußarten haben eine
helle, behaarte Blatt-
unterseite, die Blatt- Gemeiner Beifuß
unterseiten von
Ambrosiaarten sind grün und unbehaart! Die Blätter von
Blätter des Gemeinen Ambrosia- und Beifuß-Pflanzen können von unten nach oben
Beifuß unterschiedlich geformt sein.
Tabelle 3: Unterscheidungsmerkmale von Ambrosia und Gemeinem Beifuß
Beifuß-Ambrosie Gemeiner Beifuß
(Ambrosia artemisiifolia) (Artemisia vulgaris)
Wächst spät und langsamer, Ende Wächst schneller, Ende Mai
Mai /Anfang Juni, ca. 10-15 cm ca. 25-50 cm hoch
Stengel rötlich und leicht behaart Stengel rötlich und nicht behaart
(Jungpflanze grüner Stengel) (Jungpflanze grüner Stengel)
Grüngelbliche traubige Blütenstände Bräunliche Blüten
gegen Ende Juli/August ab Ende Juni
Blattunterseite hellgrün, nicht behaart Blattunterseite weißlich, behaart
Ambrosia-Pflanzen, Foto Mitte: Traubige männliche Blütenstände
17
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Ambrosia - Verwechselung im Garten mit...
Wermut (Artemisia absinthium,
Asteraceae)
Speisechrysantheme
(Glebionis coronaria, Asteraceae)
Tagetes (Studentenblume,
Asteraceae)
Mutterkraut
(Tanacetum, Asteraceae)
Färberkamille
(Anthemis spec., Asteraceae)
Korkardenblume
(Gaillardia spec., Asteraceae)
zum
Vergleich
Blattformen
Ambrosia
Moschus-Malve (Malva moschata,
Malvaceae), links verschiedene Einzel-
blätter,
rechts Pflanzenansicht mit Blüte
Gemeine Küchenschelle
(Pulsatilla vulgaris,Familie Hahnenfußge-
wächse, Ranunculaceae)
Klatschmohn (Paparaceae, zur Ordnung
der Hahnenfußartigen)
Blauer Eisenhut (Gattung Aconitum,
Hahnenfußgewächse)
Beispiel Storchschnabelgewächse
(Geraniaceae)
Ambrosia: Verwechslung mit Pflanzen am Feldrand. Beispiele unter: www.daab.de
18
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
3.3.2 Ambrosia - Empfehlung
zur Bekämpfung
• Ambrosia-kontrolliertes Vogelfutter verwenden.
• Gärten von Mai bis August regelmäßig auf
Ambrosiavorkommen kontrollieren, offene Boden-
flächen sofort wieder begrünen.
• Ausgerissene Pflanzen verpackt in Plastiktüten
in den Hausmüll und somit der Müllver-
brennung zuführen, die Pflanzen nicht kom-
postieren oder in die Grünabfuhr bzw. die
Biotonne geben. Samenproduktion verhindern:
Am sichersten ist das Ausreißen der Pflanze
(mit Handschuhen) mitsamt der Wurzel vor der
Blüte.
• Nach Beginn der Samenproduktion (etwa An- Traubiger, männlicher Blütenstand
fang September) die Pflanzen nicht mähen, Foto: U. Starfinger, JKI
dies erhöht die Samenausbreitung.
• Beim Beseitigen von Ambrosia Mundschutz tragen (am besten Feinstaubmaske
Filterklasse FFP2).
• Eine dicht sitzende Vollsichtbrille kann die Augenbindehaut schützen. (Seltenere) Kon-
taktallergien können durch langärmelige Kleidung und Arbeitshandschuhe verhindert
werden.
• Besteht beim Erkennen von Beifuß und Ambrosia-Pflanzen im Garten Unsicherheit,
sollte die Pflanze trotzdem entfernt werden, da auch Beifuß ein häufiges Allergen ist.
Umrisse von Ambrosia artemisiifolia-Blättern: Nach der Keimung, weitere Entwicklung
der doppelt gefiederten Blätter, vom Jugendstadium bis kurz vor der Blüte
Melden Sie größere Ambrosia-Bestände bei den regional zuständigen
Ämtern (Pflanzenschutzdienste/Umweltämter/Grünflächenämter) bzw. beim
Julius-Kühn-Institut : ambrosia@julius-kuehn.de
19
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.3.4. Das Mittelmeer im
Garten Olive und Co.
Es gibt Pflanzen, die aus ästhetischen Gründen
vermehrt bei uns angepflanzt werden und deren
Verbreitung auf diesem Wege bei uns zunimmt.
Einige von ihnen besitzen allergisches Poten-
zial. So findet man inzwischen auch immer mehr
Olivenbäume oder Koniferen wie Zypressen- oder
Zedernarten in Gärten vor.
In Pflanzencentern oder Gärtnereien ist das
Pflanzenangebot heutzutage sehr vielfältig.
Durch den weltweiten Handel werden auch viele
Olivenbaum neue Pflanzenarten angepriesen. Dabei kann es
sich auch um Pflanzen handeln, die in anderen
Ländern potentielle Allergieauslöser sind oder die bei uns als sogenannte invasive
Pflanzen bekämpft werden.
Der Olivenbaum (Olea europaea)
Viele Menschen wünschen sich für ihren Garten oder ihren Balkon ein mediterranes Am-
biente. Olivenbäume erfüllen diesen Zweck und werden immer mehr nachgefragt. Sie sind
inzwischen in allen Größen erhältlich. Auch an öffentlichen Plätzen, in der Gastronomie
(z.B. Biergärten) oder in Gartenbetrieben (Olivenhain) findet man zunehmend Oliven-
bäume. Die Blütezeit der Olive kann je nach Standort variieren. Im mediterranen Ver-
breitungsgebiet blüht der Baum ab April, in Deutschland eher ab Ende Mai/Anfang Juni.
Die Pflanze vermehrt sich über Windbestäubung, ist einhäusig
und gehört zu den Ölbaumgewächsen (Oleaceae). Zu dieser
Pflanzenfamilie gehören auch Pflanzen, die in unseren Regionen
wachsen, wie Esche, Flieder, Winterjasmin, Echter Jasmin,
Forsythie oder Liguster. Bei einer Eschenallergie kann es somit
beispielsweise zu Kreuzreaktionen mit der Olive kommen, genauso
können Menschen auf heimische Ölbaumgewächse reagieren,
wenn sie auf Reisen eine Olivenpollenallergie entwickelt haben.
Niemand reagiert auf alle potentiellen Allergieauslöser
und nicht jede neuartige Pflanze muss gemieden werden.
Man sollte sich aber vor dem Kauf genau über den neuen
Pflanzenzuwachs informieren.
Oliven
20
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
3.5. Neues Pflanzenangebot
in Gartencentern
Stipa tenuissima (Mexican feather grass, Nasella, Poaceae)
Mexikanisches Federgras mit flauschigen, fedrigen Blüten-
ständen. Blüht reichlich. Es ist tolerant gegen Trockenheit und
kurzlebig, versamt sich aber sehr stark. Dieses Süßgras kommt
ursprünglich aus Patagonien, Texas sowie Mexiko. In Austra-
lien, Neuseeland und Teilen Nordamerikas gilt es als invasiv. In
Bayern wurden bereits vereinzelte Vorkommen gemeldet, das Gras
versamte sich dort aus Pflanzkübeln einer Landesgartenschau. Federgras
Bisher ist es hierzulande nicht als Allergieauslöser bekannt. Es
gehört zur Familie der Süßgräser und könnte daher für Gräserallergiker problematisch sein.
Seidenbaum (Albizia julibrissin, Mimosengewächs, Fabaceae)
Ein laubabwerfender Schmetterlingsblütler mit fächerartigen Ästen. Die Blätter sind
paarig gefiedert, sie wirken farnähnlich und klappen sich am Abend ein.
Die Pflanze ist einhäusig, das bedeutet, weibliche und männliche Blüten befinden sich
auf einer Pflanze. Die Blüten stehen in dichten Köpfchen auf langen Stielen beieinander.
Die Staubblätter sind violettrot und sehr lang.
Mimosengewächse sind windblütig. Der Seiden-
baum kommt ursprünglich aus Asien, beispiels-
weise aus China. Auch im Iran kommt er vor. Er
wird gerne als Zierbaum in Parks und öffentlichen
Anlagen angepflanzt. In Nordamerika erweist er
sich in einigen Regionen als invasive Pflanze. Bis-
her ist er hierzulande nicht als Allergieauslöser
bekannt. Er wird in Amerika als milder Allergie-
auslöser eingestuft. Ob sich der Seidenbaum auch
in unseren Regionen aus Gärten heraus in die
freie Natur verbreitet (gartenflüchtig), ist bisher
nicht geklärt.
Generell sollten keine Pflanzen im Garten
verwendet werden, die gartenflüchtig sein
könnten. Hautkontakt mit den Pflanzen
vermeiden, bei der Gartenarbeit immer
Handschuhe/Schutzkleidung tragen!
Seidenbaum
21
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Toskana - Zypresse (Cupressus sempervirens, Konifere)
Säulenförmige Nadelbäume mit durchgehendem Haupttrieb.
Immergrün mit schuppenförmigen Blättern, die hier als Nadeln
bezeichnet werden. Die Pflanze gehört zu den Zypressen und ist
windblütig. Blütezeit: Feb./März. Sie kommt aus Südeuropa und
dem östlichen Mittelmeerraum. Toskana-Zypressen sind für den
Garten erhältlich. Zypressen können Pollenallergien auslösen. Sie
sind außerdem giftig. Beispielsweise gehört Cupressus semper-
virens in Chile zu den schweren Allergieauslösern, dort verläuft
ihre Pollenperiode zwischen Juli und Oktober, also im dortigen
Winter und dem frühen Frühling.
Muschelzypresse (Chamaecyparis obtusa, Konifere)
Toskana-Zypresse Die Muschelzypresse ist ein Beispiel für eine kleinwüchsige
Scheinzypresse, die sehr langsam wächst. Nach 10 Jahren
ist sie ca. 50 cm hoch und 40 cm breit. Sie
ist immergrün und hat schuppenförmige Nadel-
blätter.
Blütezeit: März/April. Die Muschelzypresse oder
Hinoki-Scheinpresse stammt ursprünglich aus
Japan. Sie wird, wie auch die Japanische
Zeder (Sicheltanne, Cryptomeria japonica), bei uns
in kleiner Wuchsform angeboten. In Japan wird
die Wildform 35 Meter hoch und ist dort neben Muschelzypresse
der Japanischen Zeder (Zypresse) und der Sichel-
tanne (Cryptomeria) ein wichtiger Pollenallergieauslöser für Heuschnupfen und Asthma.
Scheinzypressen sind giftig.
Koniferen wie Zypressen oder Lebensbäume sind
einhäusig und besitzen in der Regel getrenntge-
schlechtliche Blüten auf einem Pflanzenexemplar
einer Art.
Immer aktuelle Informationen zur Pollen-
allergie finden Sie auf den Internetseiten
des Deutschen Allergie- und Asthmabundes
unter www.daab.de sowie im Magazin
„Allergie konkret“, das Sie als Mitglied
viermal jährlich erhalten.
Japanische Zeder (Sicheltanne)
22
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
Thuja (Abendländischer
Lebensbaum, Thuja occidentalis,
Morgenländischer Lebensbaum,
Thuja orientalis, Koniferen)
Immergrüne Pflanze mit aufrechtem
Wuchs und schuppenförmigen Nadel-
blättern. In Gärten werden meist
zwergwüchsige Formen verwendet.
Blütezeit: April – Mai. Vorkommen ur-
sprünglich im Osten Kanadas und im „Teddy-Thuja“
Nordosten der USA, in Europa häufig
als „grüner Gartenzaun“ oder auf Friedhöfen und in Parks. Lebensbäume gibt es inzwischen
in vielen Varianten zu kaufen. Sie sind giftig. Neuerdings wird eine „Teddy-Thuja“ ange-
boten, die zum Streicheln anregen soll. Aber Vorsicht ist hier geboten, Thuja kann nicht
nur Pollenallergieauslöser sein, sondern auch bei Berührung zu Hautreaktionen führen.
Chinesische Hanfpalme (Chamaerops excelsa syn. Trachycarpus fortunei, Familie der
Palmengewächse (Arecaceae)
Fächerpalme mit einer Wuchshöhe von 12- 15 Metern. Stamm mit braunen Fasern bedeckt. Die
Krone hat 50 oder mehr Blattfächer. Ab einer Höhe von 1 Meter erscheinen im Frühjahr
entweder männliche oder weibliche
Blüten (zweihäusig). Männliche Blü-
tenstände haben auffällige gelbe
Blüten, weibliche Blütenstände sind
hellgrün und mit weniger Blüten be-
setzt. Heimisch ist die Palme im Hima-
laya, in Nord-Indien und Thailand so-
wie in China. Sie wird in Europa häufig
in Parks und inzwischen auch in priva-
ten Gärten angepflanzt, weil sie rela-
tiv kälteresistent ist. In der Schweiz
Chinesische Hanfpalme wird bereits vor ihrer steigenden In-
vasivität durch den Klimawandel ge-
warnt. Durch Vögel kann sie über ihre
Bei einhäusigen Pflanzen befinden sich
weibliche und männliche Blüten auf einem Samen aus den Gärten verwildern.
Exemplar einer Pflanzenart. Bei zweihäusigen Möglicherweise besteht auch Aller-
Pflanzen kommen weibliche und männliche genität. Dies wurde bereits für die
Blüten auf verschiedenen Exemplaren einer Kokospalme (Cocos nucifera, einhäu-
Pflanzenart vor. sig) oder die Dattelpalme (Phoenix
dactilifera, zweihäusig) gezeigt.
23
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Korbblütler (Asteraceae)
Die Korbblütengewächse sind die
größte Familie in der Ordnung der
Asternartigen. Typisch sind körbchen-
förmige Blütenstände. Die Körbchen-
blüten wirken wie Einzelblüten, sind
aber zusammengesetzte Blüten. Sie
sind entweder zwittrig oder einge-
Einjähriges Berufkraut schlechtlich. Viele Arten besitzen
ätherische Öle. Sie sind außer in der
Antarktis weltweit in allen Klimazonen vertreten. Es gibt etwa 24.000 Arten. Die Gruppe der
Korbblütler soll die meisten invasiven Pflanzen stellen. Neben der eigenen Ausbreitung der
Pflanzen z.B. über Flughäfen, Straßen und Erdbewegungen (z.B. Ambrosia) soll auch die
Einfuhr vieler Zier- und Nutzpflanzen ein Grund dafür sein. Korbblütler wie der Beifuß oder
die Beifußblättrige Ambrosia, die als Allergieauslöser bekannt sind, können auch aus Gärten
in die freie Natur gelangen. Invasive Berufkräuter wie das Spanische Gänseblümchen
(Erigeron karvinskianus) oder das Einjährige Berufkraut (Erigeron annua) sowie neue Würz-
kräuter wie die Beifußarten Artemisia tridentata oder Artemisia ludoviciana werden als
Gartenpflanzen verkauft oder in Gartenzeitschriften vorgestellt. Diese Beifußarten sind in
Amerika als „Sagebrush“ (Wüstenbeifuß) bekannt und dort starke Allergieauslöser.
4. Schimmelpilze im Garten
Schimmelpilze kommen überall ganz natürlich in unserer Umwelt vor. Draußen findet man
Schimmelpilze in der Gartenerde, unter Laub, im Kompost oder der Biotonne. In der Außen-
luft finden sich hohe Sporenkonzentrationen vor allem zwischen Juli und Oktober. Im
Innenraum wachsen Schimmelpilze, wenn Feuchte-
schäden entstehen. Bei zu hoher Luftfeuchtig-
keit (ideal 40-60%), setzt sich die überschüssige
Feuchtigkeit bei zu geringer Lufttemperatur an
kalten Oberflächen ab. Dies ist häufig in Gewächs-
und Gartenhäusern oder bei Gartenmöbeln, die
durch Planen geschützt werden, der Fall. Eine
gute Belüftung und rechtzeitige Behebung von
Feuchteschäden sind hier wichtig.
Informationen zur Schimmelpilzallergie
erhalten Sie beim DAAB unter: info@daab.de
oder telefonisch: 0 21 66 / 64 78 8-20
24
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
5. Kontaktallergien durch Pflanzen
Die Berührung von Pflanzenteilen kann zu Kontakt-
allergien oder Hautirritationen führen. Eine Kontakt-
allergie ist eine verzögerte allergische Reaktion,
die sich auf die Hautareale beschränkt, die einen
direkten Kontakt mit dem Allergieauslöser hatten.
Kontaktallergien sind nicht heilbar, die wichtigste
Wolfsmilchgewächs
Maßnahme ist das Vermeiden des Kontaktes. Es
gibt hierbei unterschiedliche Hautreaktionen:
1. Mechanisch: Pflanzenteile wie Stacheln oder Dornen verletzen die Haut mechanisch,
hier können auch Entzündungen durch das Eindringen von Bakterien entstehen.
2. Mechanisch und chemisch: die Haut wird zunächst verletzt und so können Reizstoffe
in die Wunde eindringen. Hier ist etwa die Brennnessel zu nennen, deren Brennhaare bei
Berührung brechen. Dadurch entsteht die Form einer „Einstechkanüle“, die in die Haut
eindringt und Natriumformiat, Acetylcholin und Histamin injiziert. So kommt es zu einer
Entzündung im Umkreis der Wunde mit brennendem Schmerz.
3. Chemisch/hautreizend: diese Wirkung kann durch Pflanzen hervorgerufen werden, die
in Milchsaftschläuchen, Zellsäften oder Drüsenhaaren hautschädigende Pflanzeninhaltsstoffe
enthalten. Milchröhren findet man zum Beispiel bei der Familie der Wolfsmilchgewächse, aus
deren Milchsäften Histamin und Acetylcholin austreten können. Der Milchsaft sollte auch
nicht in die Augen gelangen, da sie durch diesen (stark) geschädigt werden können.
4. Phototoxisch: hierbei kommt es nach dem Kontakt mit phototoxischen Substanzen zu
Entzündungen der Haut. Diese Reaktion wird durch die Einwirkung von UVA-Licht oder sicht-
baren Wellenlängen ausgelöst. Eine besonders starke Reaktion lösen die Furocumarine der
Herkulesstaude aus.
5. Photoallergisch: es liegt die gleiche Reaktion zugrunde wie bei der phototoxischen
Wirkung, allerdings besteht bei dem Betreffenden eine Sensibilisierung gegenüber dem
pflanzlichen Inhaltstoff. Dabei wird eine Allergie vom Spättyp hervorgerufen.
6. Hautreizung durch Kontaktallergene: Pflanzeninhaltsstoffe können nach Hautkon-
takt mit körpereigenen Proteinen reagieren und als Allergen wirken. Ein bekanntes Bei-
spiel ist die Becherprimel. Hautreizungen durch Kontaktallergene können sich durch
a) Reaktionen vom Soforttyp (allergische Kontakt-
urtikaria) und
b) Reaktionen vom Spättyp (allergisches Kontakt-
ekzem) äußern.
Informationen zu Kontaktallergien hält der
DAAB für Sie bereit unter: info@daab.de oder
telefonisch: 0 21 66 / 64 78 8-20 Primel
25
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Gartenpflanzen als Kontaktallergene
Pflanze (Familie) Art der Allergie
Hundskamille Kontaktallergie
Anthemis cotula L., Asteraceae
Arnika Arnica montana Kontaktallergie
L. Asteraceae
Chrysantheme Dendranthema Kontaktallergie
indicum = Chrysanthemum
indicum L.= Chrys. Japonicum
Thunb. Asteraceae
Gewöhnlicher Efeu Kontaktallergie, hautreizende
Hedera helix L.: Araliaceae Eigenschaften, giftig
Margerite Leucanthemum Kontaktallergie, irritative
vulgare Lam. = Chrysanthemum Reaktionen möglich
leucanthemum L. Asteraceae
Büschelschön Kontaktallergie,
Phacealia tanacetifolia hautreizende Wirkung
Hydrophyllaceae
Kirschlorbeer Kontaktallergie, hautreizend
Prunus laurocerasus
Primel, Becher-Primel Kontaktallergie,
Primula obconica Hance irritative Reaktionen
Primulaceae
Mutterkraut Tanacetum Kontaktallergie
parthenium L. = Chrysanthemum
parthenium L. Asteraceae =
Compositae
Thuja (Lebensbaum) Kontaktallergie, Urtikaria
Thuja spec. Zypressengewächs,
Cupressaceae
Tulpe Tulipa spec. Kontakturtikaria
Liliaceae (Berufsallergen, Zwiebel-
staub ruft Rhinitis hervor)
Fotos von oben nach unten: Hundskamille, Efeu, Margarite,
Kirschlorbeer, Mutterkraut, Thuja, Tulpe
26
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
Tabelle: Pflanzen mit hoher Sensibilisierungspotenz und erhöhter Häufigkeit für
Hautreaktionen:
Anmerkungen
Sensibilisierungspotenz stark, Häufigkeit: gelegentlich,
Kreuzreaktionen zu anderen Korbblütlern
Sensibilisierungspotenz stark, relativ häufig, Kreuzreaktionen mit Rainfarn,
Gewöhnlicher Schafgarbe, Chrysanthemen, Mutterkraut, Sonnenblumen
Sensibilisierungspotenz stark, häufig,
Kreuzreaktionen auf Astern, Gewöhnliche Schafgarbe, Rainfarn, Mutterkraut, Arnika,
Sonnenblumen
Sensibilisierungspotenz mittelstark, Häufigkeit: gelegentlich,
alle Pflanzenteile sind giftig
Sensibilisierungspotenz stark, Häufigkeit: gelegentlich,
Kreuzreaktionen zu Chrysanthemen (Astern, Rainfarn, Mutterkraut)
Sensibilisierungspotenz stark bis sehr stark, Häufigkeit: selten, aber häufig in den
USA und Mexiko
Kontaktallergien durch Pflanzensaft möglich, schleimhautreizend, alle Pflanzenteile,
besonders die Blätter und Früchte sind giftig
Sensibilisierungspotenz sehr stark, Häufigkeit: gelegentlich.
Allergen: in den Härchen an der Unterseite der Primelblätter und an den Stängeln.
Sensibilisierungspotenz stark,
Häufigkeit: gelegentlich,
Kreuzreaktionen auf Chrysanthemen, Rainfarn, Margerite, Schafgarbe, Sonnenblume,
Lorbeer
Nach Hautkontakt Rötung, Juckreiz,
Berufsallergen.
Giftig: Holz, Zapfen, Zweigspitzen
Sensibilisierungspotenz stark, häufig (u.a. Berufskrankheit auf Tulpenzwiebeln), alle
Pflanzenteile sind giftig. Informationen zu giftigen Pflanzen unter: www.gizbonn.de
Weitere mögliche Auslöser von Kontaktaller-
gien oder Hautirritationen sind Irisgewächse
(1), Korbblütler (2), Lilien, Oleander, Rizinus,
Seifenkraut, Wolfsmilchgewächse. 1 2
27
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.6. Gartengestaltung für
Menschen mit Allergien –
Geht das?
Viele Allergiker suchen für ihren Garten oder ihre
Terrasse nach Möglichkeiten, diese/n ohne aller-
gieauslösende Pflanzen zu gestalten.
Eins vorweg: Den allergenfreien Garten kann es
nicht geben. Pollen windblütiger Pflanzen können
kilometerweit durch den Wind verbreitet werden,
außerdem kann theoretisch jede Pflanze eine
Allergie oder Überempfindlichkeit auslösen, ob durch Pollen, Hautkontakt, Pflanzenduft
oder indirekt durch Insekten. Auch Schimmelpilzsporen sind immer anzutreffen, beson-
ders im Sommer und im Herbst.
6.1. Tipps für die Gartenplanung und -gestaltung
Wie ein Garten aussehen soll, hängt von den individuellen Vor-
lieben und auch Familienverhältnissen ab. Kinder wünschen
sich eher einen Spielgarten mit Sandkasten, Rasen, Schaukeln
oder einem Baumhaus.
Ein Garten kann aber auch Ort für Entspannung und Begegnung
sein mit Sitzgelegenheiten, schönen Ausblicken auf Blumen-
rabatten, Sträucher und Bäume. Ein Nutzgarten liefert frisches
Obst, Gemüse und Kräuter.
Der Garten ist mehr als die Umrandung des Hauses, er ist für
viele ein wichtiger Ausgleich zum Beruf und ein entspannendes
Hobby. Die Planung für neue Gärten orientiert sich an den ge-
wünschten Funktionen. Für einen schönen Garten ist ein Kon-
zept wichtig: Eine Skizze der Gesamtfläche, Entwürfe für die
Gestaltung, individuelle Wünsche wie Farbpräferenzen.
• Blütenformen: Je größer und auffälliger die Blüten, umso
wahrscheinlicher handelt es sich um insektenbestäubte
Pflanzen, die meist weniger Pollen produzieren.
• Hecken/Sträucher/Bäume: können als Windfang und grüne
Pollenfilter wirken, nach länger anhaltendem Regen beschnei-
den oder vorher mit Wasser besprengen, um Aufwirbelung von
Pollen/Sporen zu vermeiden.
28
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Allergien im Garten
• Komposthaufen und Biotonnen:
in der Nähe von Fenstern /Sitz-
plätzen können für Schimmel-
pilzallergiker problematisch sein.
Immer geschlossene Komposter
verwenden, Bio- und Mülltonnen
regelmäßig (mit Mundschutz) reini-
gen. Diese Aufgabe sollte nicht
von Schimmelpilzallergikern oder
immungeschwächten Menschen
ausgeführt werden. Bio- und Hausmülltonnen sollten dicht abschließen und in der
warmen Jahreszeit im Schatten platziert werden. Feuchte, faulende Abfälle können in
Papier (Tageszeitungen, kein Hochglanzpapier) verpackt werden.
• Rasen: nicht zu hoch werden lassen, wenig düngen, beim Mähen werden allergene
Pflanzensäfte freigesetzt, Pollen/Sporen können aufgewirbelt werden, Filtermaske
nutzen – oder Rasenverzicht.
• Terrassen/Sitzplätze: mit Windfang abschirmen, Pollenschutzgitter an Terrassen-
/Balkontüren.
• Gartentagebuch: darin kann man wichtige Informationen zu Blühzeiten der individu-
ellen Allergieauslöser, Beschwerden in der Pollenflugzeit, Wetterlagen, Hautreak-
tionen oder zu unerwünschten Pflanzen sammeln.
• Augen auf beim Pflanzenkauf: Angebote und Empfehlungen in Gärtnereien, Garten-
centern oder -zeitschriften sollten unter dem Aspekt der potentiellen Allergenität bzw.
auch der möglichen Verbreitung aus dem eigenen Garten heraus (invasive Pflanze)
hinterfragt werden. Beispielsweise wird das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus) als
invasiv eingestuft, aber auch als Zierpflanze empfohlen.
• Wetter beachten: Gartenarbeit kann nach langen Regenschauern angenehmer sein, da
die Pollen aus der Luft gewaschen werden. Bei kurzen Schauern oder leichtem Nieselregen
können Pollen Wasser binden, werden schwerer und sinken vermehrt herab. Womöglich
haben Patienten daher bei leicht regnerischem Wetter immer noch oder gerade kurz nach
einem Regenschauer vermehrt Pro-
bleme. Bei stürmischen Wetterlagen,
wie bei einem schnellen Abfall der
Lufttemperatur bei starken Gewittern,
werden besonders Gräserpollen aus
höheren Luftschichten zu Boden ge-
drückt, die Allergene können regel-
recht aus den Pollen herausgeschlagen
werden. Die Allergenbelastung kann
dann besonders hoch sein.
29
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.Sie können auch lesen