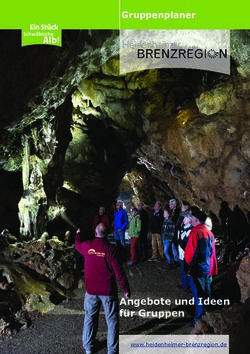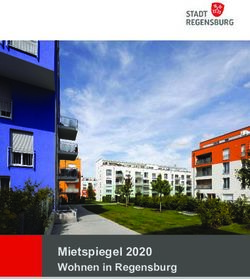Ansätze für die Reform der Altersvorsorge - Finanzierungsansätze und Lebensarbeitszeitmodell in der Wahrnehmung der Stimmbevölkerung - Centre Patronal
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ansätze für die Reform der
Altersvorsorge
Finanzierungsansätze und Lebensarbeitszeitmodell
in der Wahrnehmung der StimmbevölkerungAuftraggeberin Centre Patronal Kapellenstrasse 14 3001 Bern Auftragnehmerin Forschungsstelle sotomo Dolderstrasse 24 8032 Zurich Autor/innen (alphabetisch) Michael Hermann David Krähenbühl Gordon Bühler Zürich, April 2020
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis
1 Zu dieser Studie 4
1.1 Ziele und Inhalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Ergebnisse in Kürze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Pessimistische Rentenerwartung 6
3 Finanzierung der AHV 8
3.1 Mehrwertsteuererhöhung statt Lohnprozente . . . . . . . . . . 8
3.2 Akzeptanz einer Mehrwertsteuererhöhung . . . . . . . . . . . . 10
4 Finanzierung des BVG 13
4.1 Zustimmung für frühere Beitragszahlungen . . . . . . . . . . . 13
4.2 Mehrheit für Verzicht auf Koordinationsabzug . . . . . . . . . . 14
5 Lebensarbeitszeitmodell 17
5.1 Positive Grundstimmung zum Lebensarbeitsmodell . . . . . . . 17
5.2 Lebensarbeitszeit im Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3 Potenzieller Stimmentscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6 Datenerhebung und Methode 25
31 ZU DIESER STUDIE 1 Zu dieser Studie 1.1 Ziele und Inhalte Obwohl in der Schweizer Bevölkerung das Bewusstsein für den Reformbedarf bei der Altersvorsorge weit verbreitet ist, zeigt die Erfahrungen, dass es ausgesprochen schwierig ist, politische Mehrheiten für entsprechende Vorlagen zu erzielen. Aus Sicht der Arbeitgeberorganisation Centre Patronal (cP) braucht es deshalb neue und ungewohnte Ansätze. Mit neuen Perspektiven und Ansätzen sollen Wege gefunden werden, den aktuellen Knoten bei der Reform Altersvorsorge zu lösen. Im Zentrum dieser Vorschläge steht der Wechsel von einem fixen Rentenalter zu einem System, das auf der Zahl der Beitragsjahre basiert. Das Centre Patronal setzt auf eine koordinierte Reform der ersten und der zweiten Säule. Bei der zweiten Säule wird neben den bestehenden bundesrätlichen Vorschlägen vor allem auf einen früheren Eintritt ins BVG-System gesetzt. Für die vorliegende Studie im Auftrag des Centre Patronal hat sotomo 1221 Personen befragt. Die Befragung wurde im Frühjahr 2020 durchgeführt. Ihre Ergebnisse sind repräsentativ für die stimmberechtigte Bevölkerung in der Schweiz. Im Rahmen dieser Studie wurden, die Ansätze des Centre Patronal auf ihre Akzeptanz in der Bevölkerung geprüft. 1.2 Ergebnisse in Kürze Die stimmberechtigte Bevölkerung geht aufgrund des demographischen Wandels von tendenziell sinkenden Renten aus. Diese Einschätzung bezieht sich auf die erste Säule (AHV) und mehr noch auf die zweite Säule (BVG) des obligato- rischen Vorsorgesystems. Zugleich ist die Senkung der Renten als Ansatz zur Schliessung der Finanzierungslücke im Rentensystem unpopulär. Die vorliegende Befragung zeigt, dass es Mehrheiten für Massnahmen auf der Einnahmenseite gibt (Mehrwertsteuererhöhung, früherer BVG-Einstieg) und zugleich bestehen auch Mehrheiten für eine punktuelle Erweiterung der Lebensarbeitszeit durch den Übergang von einem fixen Rentenalter zu einem System, das auf der tatsächlichen Dauer der Erwerbstätigkeit beruht. Mehreinnahmen zur Schliessung der Finanzierungslücke Geht es um die Schliessung der Finanzierungslücke bei der AHV, so priorisieren die Stimmberechtigten ganz klar eine Erhöhung der Mehrwertsteuer im Vergleich zur Erhöhung der Abgaben auf den Löhnen und zwar im Verhältnis von 52 zu 16 Prozent. Eine überwiegende Mehrheit von 75 Prozent unterstützt dabei konkret eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozent, wie sie vom Bundesrat vorgeschlagen wird (Anteil «ja» und «eher ja» zusammengezählt). Immerhin 58 Prozent der Befragten sprechen sich für eine noch weitergehende Erhöhung der 4
1 ZU DIESER STUDIE Mehrwertsteuer zugunsten der AHV aus. Es fällt auf, dass in der Deutschschweiz die Unterstützung für eine Erhöhung im Sinn des Bundesrats mehr Zustimmung erfährt als in der Romandie. In der Romandie ist jedoch die Zustimmung für eine weitergehende Erhöhung grösser als in der Deutschschweiz. Die Haltung in der französischsprachigen Schweiz ist eher eine grundsätzliche, während in der deutschsprachigen Schweiz vermehrt auf den Betrag geachtet wird. Geht es um die Sanierung der zweite Säule, so besteht bei den Stimmberechtigten eine grosse Mehrheit (84 %), die sich für einen früheren Beginn des obligato- rischen Alterssparens im Rahmen des BVG aussprechen. Bevorzugt wird dabei ein Beginn zwischen 18 und 20 Jahren statt wie heute erst mit dem 25. Lebens- jahr. Immerhin 77 Prozent der Befragten sprechen sich für die Abschaffung des Koordinationsabzugs aus. Lebensarbeitszeitmodell 61 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich heute für den Wechsel von einem System mit einem festen Rentenalter zu einem Lebensarbeitszeitmodell auf Basis der Zahl der Beitragsjahre aus. Ein Lebensarbeitszeitmodell wird dabei von der Stimmbevölkerung klar einer generellen Erhöhung des Rentenalters vorgezogen. Aus Sicht einer grossen Mehrheit der Befragten kann es Personen mit einer langen Ausbildungszeit zugemutet werden, bis zu ihrer Pensionierung länger zu arbeiten als heute (76 %). Zugleich sind die meisten der Ansicht, dass Personen mit einer harten körperlichen Betätigung, früher in Rente gehen sollten (82 %). Die Skepsis gegen das Lebensarbeitszeitmodell ist bei den jüngeren Befragten grösser als bei den älteren. Ausserdem hängt die Haltung zum Lebensarbeitszeit- modell relativ stark vom Bildungsabschluss ab. Personen, die spätestens nach der Berufslehre ins Arbeitsleben eingestiegen sind, bewerten das Modell besonders positiv, während Personen mit einem Hochschulabschluss besonders skeptisch sind. Dies erstaunt nicht, da ein Lebensarbeitszeitmodell insbesondere Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss betreffen würde. Weil es sich dabei nur um eine Minderheit der Stimmberechtigten handelt, könnte genau hier die Basis für die Mehrheitsfähigkeit des Lebensarbeitsmodell liegen. Die wichtigsten Argumente für das Lebensarbeitszeitmodell sind der Beitrag zur Schliessung der Finanzierungslücken und die Tatsache, dass dieses den Unterschieden zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gerecht wird. Das wichtigste Argument dagegen ist, dass dieses ausgetrickst werden könne. Häufig genannt wird ausserdem, dass dieses zu kompliziert sei. Diese Argumente sind klare Hinweise für einen möglichen Abstimmungskampf: Ein Modellwechsel hat nur dann eine Chance, wenn das vorgeschlagene Lebensarbeitszeitmodell einfach und klar ist und nicht mit taktischem Verhalten ausgespielt werden kann. 5
2 PESSIMISTISCHE RENTENERWARTUNG
2 Pessimistische Rentenerwartung
Ein grosser Teil der Bevölkerung geht heute von einer negativen Entwicklung
der AHV-Rentenentwicklung aus (61 %). Die Einschätzung unterscheidet sich
zwischen den soziodemographischen Gruppen: Frauen gehen häufiger von sin-
kenden AHV-Renten aus als Männer und Jüngere mehr als Ältere. Auffällig ist
ein verstärkter Pessimismus bei Personen mit tiefen Einkommen, deren Renten
besonders stark von der ersten Säule abhängt.
Abbildung 1: Einschätzung zukünftige Entwicklung AHV-Renten - Soziodemografie
Gesamt
17 44 31 6
Nach Geschlecht
Frau 22 44 29 5
Mann 12 45 34 8
Nach Altersgruppen
18-25 35 37 15 12
26-45 24 54 17 4
46-65 10 44 39 6
> 65 31 59 6
Nach Einkommenskategorien
Unter 4000 30 36 27 6
4000 bis 6000 18 47 27 6
6000 bis 10000 14 41 38 6
Über 10 000 12 48 32 7
0% 25% 50% 75% 100%
Deutlich sinken
Eher sinken
Stabil bleiben
Eher steigen
Deutlich steigen
«Was ist Ihre Einschätzung: Wie wird sich das Niveau der AHV-Renten künftig entwickeln?»
Noch pessimistischer als bei der ersten ist die Einschätzung in Bezug auf die
zweite Säule. Insgesamt gehen fast drei Viertel (74 %) von sinkenden BVG-
Renten aus. Auffällig ist hier allerdings, dass sich die Einschätzungen nur wenig
zwischen den demographischen Gruppen unterscheiden. In Bezug auf die BVG-
Renten teilen Personen im Rentenalter den Pessimismus der nachfolgenden
Generationen auch zeigen sich kaum Einschätzungsunterschiede zwischen den
62 PESSIMISTISCHE RENTENERWARTUNG
Geschlechtern. Während die Einschätzung der Zukunft der AHV-Renten innerhalb
der Gesellschaft variiert, ist der Pessimismus in Bezug auf die Pensionskasse breit
und gleichförmig vorhanden.
Abbildung 2: Einschätzung zukünftige Entwicklung BVG-Renten - Soziodemografie
Gesamt
15 59 21 4
Nach Geschlecht
Frau 16 58 21 5
Mann 15 59 22 4
Nach Altersgruppen
18-25 20 34 32 13
26-45 17 62 18
46-65 16 63 17 3
> 65 7 62 27 3
Nach Einkommenskategorien
Unter 4000 24 46 23 7
4000 bis 6000 12 62 22 3
6000 bis 10000 14 63 20 3
Über 10 000 16 58 21 4
0% 25% 50% 75% 100%
Deutlich sinken
Eher sinken
Stabil bleiben
Eher steigen
Deutlich steigen
«Was ist Ihre Einschätzung: Wie wird sich das Niveau der Pensionskassen-Renten (BVG) künftig entwickeln?»
73 FINANZIERUNG DER AHV
3 Finanzierung der AHV
Die Schweizer Bevölkerung altert, einerseits weil die Menschen im Schnitt immer
älter werden und andererseits, weil im Vergleich zu früheren Generationen Frauen
weniger Kinder haben. Durch Zuwanderung wird ein Teil der demographischen Al-
terung verzögert. Dennoch verschiebt sich das Verhältnis von Erwerbsbevölkerung
und Pensionierten zu Ungunsten ersterem. Die Lage verschärft sich zusätzlich
dadurch, dass die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten «Babyboomer»-
Generation zunehmend das Rentenalter erreichen. Sollen ein wachsender Schul-
denberg und/oder radikale Rentenkürzungen verhindert werden, müssen die
finanziellen Zuflüsse ins Rentensystem erhöht werden. Der folgende Teil dieser
Studie untersucht die Haltung der Bevölkerung zu verschiedenen Optionen bei der
Generierung von Mehreinnahmen für das schweizerische Rentensystem. Die be-
schriebene demografische Entwicklung bringt insbesondere die umlagefinanzierte
erste Säule des Schweizer Altersvorsorgesystem in eine finanzielle Schieflage.
3.1 Mehrwertsteuererhöhung statt Lohnprozente
Abbildung 3: Präferenz Mehrwertsteuer vs. Lohnprozente bei der AHV-Finanzierung
Gesamt
4 12 32 34 18
Nach Geschlecht
Frau 9 37 36 15
Mann 5 16 28 32 20
Nach Altersgruppen
18-25 13 32 38 13
26-45 3 13 33 33 18
46-65 4 11 30 36 20
> 65 6 13 36 30 15
0% 25% 50% 75% 100%
Klar «Erhöhung Lohnabgaben»
Eher «Erhöhung Lohnabgaben»
Beide gleich
Eher «Erhöhung Mehrwertsteuer»
Klar «Erhöhung Mehrwertsteuer»
«Wenn es um zusätzliche Finanzierungsquellen für die AHV geht, stehen aktuell vor allem höhere
Mehrwertsteuerbeiträge sowie höhere Abgaben auf den Löhnen zur Debatte. Wenn Sie wählen müssen, welchen
Ansatz bevorzugen Sie?» - Soziodemografie
83 FINANZIERUNG DER AHV Es bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Gewinnung von Mehreinnahmen für die AHV. Zur Diskussion stehen vor allem zwei Ansätze. Zum einen die Erhöhung der Abgaben auf dem versicherungspflichtigen Lohn zum anderen die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes. Die Befragung der stimmberechtigten Bevölkerung zeigt dabei eine klare Präferenz. Werden die beiden Ansätze gegenübergestellt bevorzugen 52 Prozent eine Erhöhung der Mehrwertsteuer (Abb. 3) und nur 16 Prozent höhere Lohnabgaben. Weitere 32 Prozent möchten die Finanzierungs- lücke mit Mehreinnahmen aus beiden Quellen gleichermassen schliessen. Dies zeigt, dass aus Sicht der Bevölkerungsmehrheit eine finanzielle Sanierung der AHV nicht zu einer Verteuerung des Produktionsfaktors Arbeit führen soll. Statt nur die Lohn Empfängerinnen und -empfänger bzw. die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen die finanziellen Lasten auf alle, die Konsumausgaben haben, verteilt werden. Diese Haltung zeigt sich dabei über alle soziodemografischen Gruppen hinweg (Abb. 3). Interessant ist, dass zwischen den Altersgruppen nur geringe Unterschiede bestehen. Zwar ziehen bei den über 65-Jährigen nur 45 Prozent eine hauptsächliche Finanzierung durch die Mehrwertsteuer vor. Für eine hauptsächliche Finanzierung durch Lohnabgaben sprechen sich auch in dieser Altersgruppe nur 19 Prozent aus, obwohl die meisten über 65-Jährigen selber keine Lohnabgaben mehr zahlen. Am grössten ist die Skepsis gegenüber der Erhöhung der Lohnabgaben bei den 46- bis 65-Jährigen. Es ist die Altersgruppe, die bereits überdurchschnittlich hohe Beiträge auf dem Erwerbseinkommen zahlen muss. Ein vergleichsweiser deutlicher Unterschied zeigt sich nach Sprachregion: 42 Pro- zent der französischsprachigen Bevölkerung sprechen sich für die Doppelstrategie zur Finanzierung der AHV aus jedoch nur 29 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung. Demgegenüber hängt die Einstellung zu den beiden Finanzierungs- arten erstaunlich wenig von der politischen Orientierung ab. Etwas stärker als der Durchschnitt tendiert die Wählerbasis von CVP und FDP zu einer primären Mehrwertsteuerfinanzierung (Abb. 4). 9
3 FINANZIERUNG DER AHV
Abbildung 4: Vorliebe zusätzliche Finanzierungsquelle AHV – nach politischen Variablen
Gesamt
4 12 32 34 18
Nach Parteiwählerschaft
Grüne 11 39 31 17
SP 6 11 29 32 22
GLP 4 8 35 37 15
CVP 13 21 41 24
FDP 10 30 37 22
SVP 6 16 25 37 16
Nach Sprachregion
Deutschschweiz 4 13 29 35 19
Französische Schweiz 3 11 42 30 14
0% 25% 50% 75% 100%
Klar «Erhöhung Lohnabgaben»
Eher «Erhöhung Lohnabgaben»
Beide gleich
Eher «Erhöhung Mehrwertsteuer»
Klar «Erhöhung Mehrwertsteuer»
«Wenn es um zusätzliche Finanzierungsquellen für die AHV geht, stehen aktuell vor allem höhere
Mehrwertsteuerbeiträge sowie höhere Abgaben auf den Löhnen zur Debatte. Wenn Sie wählen müssen, welchen
Ansatz bevorzugen Sie?» - Parteiwählerschaft
3.2 Akzeptanz einer Mehrwertsteuererhöhung
Wie gezeigt, zieht die Bevölkerung die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes einer
Erhöhung der Lohnabgaben klar vor. Geht es um die Haltung zu einer konkre-
ten Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Deckung der Finanzierungslücke in der
AHV zeigt sich eine differenzierte Sicht. Eine sehr grosse Akzeptanz findet eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte, wie dies vom Bundesrat
vorgeschlagen wird. 75 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich dafür aus.
Umstrittener ist dagegen eine weitergehende Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes
über die 0,7 Prozent hinaus. Doch auch hier sprechen sich immerhin 58 Prozent
dafür aus. Dies zeigt, dass via Mehrwertsteuer gerade im Vergleich zur Erhöhung
der Lohnprozente, durchaus ein Potenzial für eine mehrheitsfähige Generierung
von Mehreinnahmen besteht. Insgesamt ist die Bereitschaft für Mehrwertsteuer-
erhöhungen zugunsten der AHV bei den Frauen etwas grösser als bei Männern.
Die Skepsis ist bei den 26- bis 45-Jährigen am grössten. Dies gilt insbesondere
für eine weitergehende Erhöhung des Satzes (Abb. 6).
103 FINANZIERUNG DER AHV
Abbildung 5: Unterstützung einer Mehrwertsteuererhöhung um 0,7 Prozentpunkte oder mehr
– nach Geschlecht und Alter
Erhöhung Mehrwertsteuer um 0,7 Pkte. Weitere Erhöhung Mehrwertsteuer
Total
12 13 44 31 14 28 40 18
Nach Geschlecht
Frau 8 11 52 29 10 29 44 16
Mann 15 15 38 33 19 26 36 19
Nach Alterskategorien
18-25 12 11 59 18 10 27 47 16
26-45 12 16 47 24 15 34 33 17
46-65 11 11 44 34 16 24 44 16
> 65 11 12 32 46 13 22 42 23
Nein Eher Nein Eher Ja Ja
«Unterstützen Sie die vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung der Mehrwertsteuer (heute 7.7 Prozent)
zugunsten der AHV um 0.7 Prozentpunkte?» / «Erachten Sie in Zukunft eine weitere Erhöhung der
Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV-Renten für angebracht?»
Interessant sind die Unterschiede zwischen den beiden grossen Sprachregionen.
So ist die Zustimmung für eine Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte in der Deutsch-
schweiz grösser als in der Romandie. Geht es jedoch um eine weitergehende
Erhöhung sinkt die Zustimmung in der Deutschschweiz viel stärker. Und zwar
so stark, dass für eine weiterführende Erhöhung in der Romandie mehr Rück-
halt besteht. Dies zeigt, dass die Haltung zu einer Mehrwertsteuererhöhung
in der Deutschschweiz besonders elastisch reagiert. Eine durch den Bundesrat
abgestützte Erhöhung in kleinen Schritten findet hier besonders viel, eine weiter-
gehende jedoch relativ wenig Unterstützung. In der Romandie scheint es dagegen
eher um einen Grundsatzentscheid zu geben, der nur wenig von der konkreten
Ausgestaltung abhängt.
Die Unterstützung der einer Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV hängt
durchaus von der parteipolitischen Orientierung ab, die politische Polarisierung
ist jedoch eher schwach ausgeprägt. Eine mehrheitliche Opposition besteht nur
bei der SVP-Basis und auch dort nur für eine weitergehende Erhöhung der
Mehrwersteuer.
113 FINANZIERUNG DER AHV
Abbildung 6: Unterstützung einer Mehrwertsteuererhöhung um 0,7 Prozentpunkte oder mehr
– nach Politik und Sprachregion
Erhöhung Mehrwertsteuer um 0,7 Pkte. Weitere Erhöhung Mehrwertsteuer
Total
12 13 44 31 14 28 40 18
Nach Parteiwählerschaft
Grüne 12 7 55 26 13 23 47 16
SP 8 11 35 46 11 22 39 28
GLP 5 8 55 32 7 17 58 18
CVP 4 8 50 38 5 31 47 17
FDP 10 15 42 33 11 33 40 15
SVP 19 20 38 23 23 36 24 17
Nach Sprachregion
Deutschschweiz 11 12 43 33 14 31 38 17
Französische Schweiz 13 15 48 24 16 18 46 20
Nein Eher Nein Eher Ja Ja
«Unterstützen Sie die vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung der Mehrwertsteuer (heute 7.7 Prozent)
zugunsten der AHV um 0.7 Prozentpunkte?» / «Erachten Sie in Zukunft eine weitere Erhöhung der
Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV-Renten für angebracht?»
124 FINANZIERUNG DES BVG
4 Finanzierung des BVG
Mit der höheren Lebenserwartung steigt die Rentenbezugsdauer. Das wirkt sich
nicht nur auf die umlagefinanzierte erste Säule, sondern auch auf die zweite Säule
aus, die auf dem Kapitaldeckungsverfahren beruht. Das in der zweiten Säule
angesparte Alterskapital muss auf mehr Jahre verteilt werden. Soll es nicht zu
einer markanten Senkung der BVG-Renten führen, müssen auch für die zweite
Säule zusätzliche Einnahmequellen erschlossen werden.
4.1 Zustimmung für frühere Beitragszahlungen
Gegenwärtig beginnt die Beitragspflicht in die zweite Säule erst ab dem 25.
Lebensjahr eines Versicherungsnehmers an. Durch einen früheren Beginn der
Beitragszahlung liesse sich bis zum Eintritt in den Ruhestand mehr Kapital
ansparen. Allgemein stösst eine Senkung des Mindestalters in der Bevölkerung
auf eine sehr grosse Akzeptanz. 84 Prozent befürworten einen früheren Beginn
des Alterssparprozesses als dies gegenwärtig Artikel 7 des BVG vorsieht. Die
unter 45-Jährigen sind dabei etwas skeptischer als die älteren Stimmberechtigten.
Dennoch besteht auch bei den Jüngeren eine klare Zustimmung. Praktisch
keinen Zusammenhang besteht mit der parteipolitischen Orientierung und der
sprachregionalen Herkunft.
Abbildung 7: BVG: früherer Eintritt?
Gesamt
5 11 36 48
Nach Geschlecht
Frau 4 16 39 41
Mann 6 7 32 55
Nach Altersgruppen
18-25 7 14 47 32
26-45 7 15 37 40
46-65 7 33 58
> 65 9 31 57
0% 25% 50% 75% 100%
Nein
Eher Nein
Eher Ja
Ja
«Heute beginnt das Alterssparen im BVG erst im Alter von 25 Jahren. Unterstützen Sie einen früheren Beginn
des Alterssparens, damit insgesamt ein höheres Sparkapital erzielt werden kann?» - Soziodemografie
134 FINANZIERUNG DES BVG
Eine überwiegende Mehrheit spricht sich für eine Senkung des Beginns der BVG-
Beitragszahlungen aus. Aus Sicht einer deutlichen Mehrheit sollen es dabei eine
Senkung um mindestens fünf Jahre vom 25. auf das 20. Lebensjahr sein. Nur eine
Minderheit wünscht sich jedoch eine Senkung auf das 17. Lebensjahr, welches
dem Start der Beitragspflicht für die AHV entspricht. Die direktbetroffenen 18-
bis 25-Jährigen sind etwas zurückhaltender als die älteren Altersgruppen. Doch
auch hier spricht sich rund die Hälfte derer, die eine Senkung des Beitragsbeginn
grundsätzlich gutheissen, für eine Senkung bis zumindest zum 20. Lebensjahr aus
(Abb. 8).
Abbildung 8: Früherer Eintritt in BVG: ab welchem Alter?
Gesamt
22 47 31
Nach Geschlecht
Frau 17 48 34
Mann 26 46 27
Nach Altersgruppen
18-25 18 34 48
26-45 21 47 29
46-65 24 52 24
> 65 21 45 34
0% 25% 50% 75% 100%
Mit 17 Jahren (dem AHV-Eintrittsalter)
Zwischen 18-20 Jahren
Zwischen 21-23 Jahren
Keine Meinung
«Wann soll der frühere Beginn des Alterssparens im BVG angesetzt werden?» - Nur Befragte, die für einen
früheren Eintritt sind, nach Soziodemografie
4.2 Mehrheit für Verzicht auf Koordinationsabzug
Aus der Grundidee heraus, dass die zweite Säule der Altersvorsorge die erste
bloss ergänzen soll, wird der Teil des Lohnes, der durch die AHV abgedeckt ist
nicht durch das BVG versichert. Gegenwärtig (2020) werden CHF 24 885 des
AHV-pflichtigen Jahreslohns nicht durch das BVG abgedeckt. Dieser Teil wird
als Koordinationsabzug bezeichnet. Der Koordinationsabzug hat zur Folge, dass
Personen, die Teilzeit arbeiten und Personen mit tiefen Einkommen in der zweiten
Säule unterversichert sind. Betroffen davon sind insbesondere Frauen.
Mehr als drei Viertel der Stimmbevölkerungbevölkerung befürwortet einen Verzicht
auf den Koordinationsabzug (77 %, Abb. 9). Die Zustimmung bei den Männern
144 FINANZIERUNG DES BVG
ist dabei interessanterweise noch etwas grösser als bei den Frauen, ob wohl die
heutige Unterversicherung vor allem Frauen betrifft. Etwas grösser ist die Skepsis
bei den jüngeren Befragten, die sich ebenfalls etwas weniger stark für ein tieferes
BVG-Eintrittsalter aussprichen. Dies zeigt, dass für die Jüngeren die Last der
Beiträge tendenziell etwas mehr ins Gewicht fällt als für die Älteren, für welche
die erwarteten Renten stärker in den Fokus rücken.
Abbildung 9: BVG: Verzicht auf Koordinationsabzug?
Gesamt
8 14 33 44
Nach Geschlecht
Frau 8 16 38 38
Mann 9 12 29 50
Nach Altersgruppen
18-25 6 22 42 30
26-45 11 20 32 37
46-65 7 8 36 50
> 65 6 10 28 56
0% 25% 50% 75% 100%
Nein
Eher Nein
Eher Ja
Ja
«Der sogenannte Koordinationsabzug hat zur Folge, dass heute Löhne unter rund 25 000 Franken nicht
BVG-versichert sind. Unterstützen Sie den Verzicht auf den Koordinationsabzug und damit die Möglichkeit,
dass auch kleinere Löhne versichert werden?» - Soziodemografie
Solide Mehrheiten für die Abschaffung des Koordinationsabzugs finden sich glei-
chermassen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Die Haltung
zum Koordinationsabzug unterscheidet sich zwar teilweise deutlich zwischen den
Anhängerschaften der Parteien. Bei allen gibt es jedoch eine Mehrheit für die Ab-
schaffung. Interessant ist jedoch, dass sich kein eigentliches Links-rechts-Muster
ausmachen lässt. Die Skepsis gegen die Abschaffung des Koordinationsabzug
ist bei der Anhängerschaft der SVP und der Grünen am grössten. Am meisten
Unterstützung findet diese bei der Basis von SP, CVP und FDP (Abb. 10).
154 FINANZIERUNG DES BVG
Abbildung 10: BVG: Verzicht auf Koordinationsabzug?
Gesamt
8 14 33 44
Nach Parteiwählerschaft
Grüne 13 9 40 38
SP 10 26 62
GLP 9 19 25 47
CVP 5 46 47
FDP 5 18 24 53
SVP 8 22 38 32
Nach Sprachregion
Deutschschweiz 9 14 33 45
Französische Schweiz 6 15 36 43
0% 25% 50% 75% 100%
Nein
Eher Nein
Eher Ja
Ja
«Der sogenannte Koordinationsabzug hat zur Folge, dass heute Löhne unter rund 25 000 Franken nicht
BVG-versichert sind. Unterstützen Sie den Verzicht auf den Koordinationsabzug und damit die Möglichkeit,
dass auch kleinere Löhne versichert werden?» - Parteiwählerschaft
165 LEBENSARBEITSZEITMODELL
5 Lebensarbeitszeitmodell
Ein zentraler Baustein des Reformvorschlags des Centre Patronals ist der Wechsel
von einem fixen Rentenalter zu einem System, das auf der Zahl der Beitragsjahre
basiert. In den folgenden Abschnitten geht es um die Akzeptanz dieses alter-
nativen Modells zur Festlegung des Zeitpunkts des ordentlichen Übergangs ins
Rentenalter.
5.1 Positive Grundstimmung zum Lebensarbeitsmodell
Wenn aufgrund der Finanzierungslücke in der Altersvorsorge bis zur Pensionierung
tendenziell länger gearbeitet werden soll, dann kann dies aus Sicht der Befragten
einzelnen Personengruppen vermehrt zugemutet werden. Im Vordergrund stehen
dabei insbesondere Personen, die eine lange Ausbildungsdauer hatten und ent-
sprechend spät ins Erwerbsleben eingestiegen sind. 76 Prozent der Befragten sind
der Ansicht, dass es Personen mit langen Ausbildungszeiten zugemutet werden
kann, später in Pension zu gehen als heute.
Abbildung 11: Länger arbeiten als bis zum heutigen Rentenalter bzw. früher in Pension –
Personengruppen
Spätere Pensionierung zumutbar
Personen mit Bürojobs 14 22 46 18
Personen mit langer Ausbildungszeit 12 12 42 34
Sollten früher in Pension gehen dürfen
Personen mit körperlich belastenden Jobs 6 12 43 39
Personen mit frühem Einstieg ins Erwerbsleben 23 29 29 18
0% 25% 50% 75% 100%
Nein Eher Nein Eher Ja Ja
«Welchen Personengruppen kann am ehesten zugemutet werden, länger als bis zum heutigen Rentenalter zu
arbeiten?» / «Ganz grundsätzlich: welche Faktoren sollten Ihrer Meinung nach einen Einfluss darauf haben, in
welchem Alter jemand pensioniert wird bzw. in Rente gehen kann?»
Ebenfalls eine Mehrheit, wenn auch eine relativ kleine (54 %), ist der Ansicht, dass
es Personen in Bürojobs ohne spezielle körperliche Belastung zugemutet werden
kann, länger zu arbeiten als heute. Hier erfolgt die Differenzierung vermehrt nach
unten statt nach oben. So ist eine klare Mehrheit der Ansicht, dass Personen, die
harte körperliche Arbeit leisten, früher in Rente gehen können sollen als Personen
mit einem Bürojob (82 %). Für eine frühzeitige Verrentung von Personen, die
nach einer Lehre ins Erwerbsleben eingestiegen sind, sprechen sich dagegen nur
47 Prozent aus. Aus Sicht der Bevölkerung sollen somit Personen, die harte
175 LEBENSARBEITSZEITMODELL
körperliche Arbeit leisten, frühzeitig in Rente gehen können. Gleichzeitig sollen
aus Sicht der Stimmberechtigten jedoch vor allem Personen mit einer langen
Ausbildung zur Schliessung der Finanzierungslücke in der Altersvorsorge bis zu
ihrer Pensionierung länger arbeiten.
Entsprechend dieser Grundeinstellungen in der Bevölkerung wird ein Wechsel von
einem fixen Rentenalter zu einem Lebensarbeitszeitmodell, welches die Zahl der
Beitragsjahre berücksichtigt, positiv beurteilt. 17 Prozent haben eine sehr positive
Einstellung dazu. Weitere 55 Prozent eine eher positive. Die Unterstützung für
das Modell ist dabei bei den Männern etwas grösser als bei den Frauen, ausserdem
wird das Modell von älteren Stimmberechtigten positiver eingeschätzt als von
jüngeren.
Abbildung 12: Beurteilung Lebensarbeitszeitmodell – nach Geschlecht und Alter
Gesamt
5 23 55 17
Nach Geschlecht
Frau 5 27 57 11
Mann 5 18 54 23
Nach Altersgruppen
18-25 9 27 42 21
26-45 5 27 54 13
46-65 4 19 61 15
> 65 17 57 24
0% 25% 50% 75% 100%
Sehr negativ
Eher negativ
Eher positiv
Sehr positiv
«Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Stossrichtung eines Wechsels zum Lebensarbeitszeitmodell?»
Es fällt auf, dass Personen mit einer tertiären Ausbildung und dabei insbesondere
mit einem Hochschulabschluss skeptischer sind als Personen mit maximal einer
Berufslehre. Es sind typischerweise Personen mit einer langen Ausbildung und
einem entsprechend späten Berufseinstieg, die durch ein Lebensarbeitszeitmodell
später in Rente gehen könnten. Skeptisch sind ausserdem Personen mit sehr
tiefem Haushaltseinkommen (unter CHF 4000 netto pro Monat). Es handelt sich
dabei vor allem um Personen, die Teilzeit arbeiten.
185 LEBENSARBEITSZEITMODELL
Abbildung 13: Beurteilung Lebensarbeitszeitmodell – nach Ausbildung und Einkommen
Gesamt
5 23 55 17
Nach Bildungsgruppen
Oblig. Schule/Berufslehre 3 17 61 18
Matura/Höhere Berufsbild. 3 30 50 17
Universität/Fachhochschule 14 33 41 12
Nach Einkommenskategorien
Weniger als 4'000 8 35 50 8
4'001 bis 6'000 4 16 60 20
6'001 bis 10'000 5 21 54 20
10'001 bis 16'000 5 27 52 17
Über 16'000 4 22 51 23
0% 25% 50% 75% 100%
Sehr negativ
Eher negativ
Eher positiv
Sehr positiv
«Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Stossrichtung eines Wechsels zum Lebensarbeitszeitmodell?»
5.2 Lebensarbeitszeit im Vergleich
Das Lebensarbeitszeitmodell ist für eine Mehrheit eine bevorzugte Alternative zu
einer generellen Erhöhung des Rentenalters. 53 Prozent ziehen dieses Modell vor,
während nur 26 Prozent einer generellen Rentenaltererhöhung den Vorzug geben.
Der Rest kann sich nicht entscheiden. Unter den wichtigsten demographischen
Gruppen bevorzugen einzig die 18- bis 25-Jährigen eine generelle Erhöhung.
Dasselbe gilt für Personen mit Hochschulbildung.
195 LEBENSARBEITSZEITMODELL
Abbildung 14: Lebensarbeitszeit vs. generelle Erhöhung Rentenalter
Gesamt
26 20 53
Nach Geschlecht
Frau 24 28 48
Mann 28 13 59
Nach Altersgruppen
18-25 48 20 32
26-45 24 25 50
46-65 18 19 62
> 65 26 12 62
0% 25% 50% 75% 100%
Generelle Erhöhung besser
Weiss nicht
Lebensarbeitszeitmodell besser
«Wie beurteilen Sie das Lebensarbeitszeitmodell im Vergleich zu einer generellen Erhöhung des Rentenalters?»
Nicht nur im Vergleich zu einer generellen Erhöhung des Rentenalters wird
die Einführung eines Lebensarbeitszeitmodells bevorzugt. Der Ansatz erhält
auch im Vergleich zu anderen Massnahmen zur Reform der Altersvorsorge viel
Unterstützung. Dies zeigt die Gewichtung verschiedener Reformansätze durch die
Befragten. Diese wurden gebeten, fünf Punkte auf fünf verschiedene Ansätze zur
Schliessung der Finanzierungslücke bei der obligatorischen Altersvorsorge (AHV
und BVG) zu verteilen. Dabei erhält die Einführung eines Lebensarbeitszeitmodells
neben der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes am meisten Punkte – nämlich je
1,4 von insgesamt 5. Weniger populär ist dagegen die Erhöhung der Abgaben
auf den Löhnen, die generelle Erhöhung des Rentenalters sowie die Senkung
der Ausgaben (bzw. der Renten). Diese erhalten zwischen 0,7 und 0,8 Punkte.
Frauen setzen dabei etwas mehr auf eine Mehrwertsteuererhöhung, während
Männer dem Lebensarbeitszeitmodell, aber auch der generellen Erhöhung des
Rentenalters mehr Gewicht geben.
205 LEBENSARBEITSZEITMODELL
Abbildung 15: Relative Gewichtung von Reformansätzen – nach Geschlecht
0.6
Senkung der Ausgaben
0.7
1.4
Lebensarbeitszeitmodell
1.3
0.8
Höheres Rentenalter
0.7
1.3
Höhere MWST
1.5
0.9
Höhere Abgaben auf Löhnen
0.8
0.0 0.5 1.0 1.5
Mann Frau
«Wie gezeigt, bestehen verschiedene Ansätze zur Schliessung der Finanzierunglücke bei der obligatorischen
Altersvorsorge (AHV und BVG). Geben Sie zum Schluss nochmals Ihre Prioritäten an. Verteilen Sie hierzu 5
Punkte auf die folgenden Ansätze. (Sie können alle Punkte auf einen Ansatz setzen oder sie beliebig verteilen).»
Besonders stark auf die Gewichtung der Reform- bzw. Finanzierungsansätze wirkt
sich der Bildungsabschluss der Befragten aus. Je länger die Ausbildung desto
stärker verliert das Lebensarbeitszeitmodell im Vergleich zu einer generellen Er-
höhung des Rentenalters an Bedeutung. Dies zeigt, dass die eigene Betroffenheit
ein wichtiger Faktor in der Beurteilung ist. Auffällig ist zudem, dass Personen mit
einer tertiären Ausbildung der Einnahmesteigerung über Mehrwertsteuerprozente
etwas weniger und den Lohnabzügen etwas mehr Gewicht geben als Personen
mit maximal einem Berufsschulabschluss.
Abbildung 16: Relative Gewichtung von Reformansätzen – nach Bildungsabschluss
Lebensarbeitszeit- Höhere Abgaben auf Senkung der
Höhere MWST Höheres Rentenalter
modell Löhnen Ausgaben
2.0
1.5 1.5
1.4 1.4 1.4
1.2
1.1
1.0 1 0.9
1
0.8
0.7 0.7 0.7 0.7
0.5 0.5
0.0
ef
el
h
ef
el
h
ef
el
h
ef
el
h
ef
el
h
oc
oc
oc
oc
oc
itt
itt
itt
itt
itt
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
M
M
M
M
M
H
H
H
H
H
«Wie gezeigt, bestehen verschiedene Ansätze zur Schliessung der Finanzierunglücke bei der obligatorischen
Altersvorsorge (AHV und BVG). Geben Sie zum Schluss nochmals Ihre Prioritäten an. Verteilen Sie hierzu 5
Punkte auf die folgenden Ansätze. (Sie können alle Punkte auf einen Ansatz setzen oder sie beliebig verteilen).»
215 LEBENSARBEITSZEITMODELL
Das Alter der Befragten wirkt sich insbesondere auf den Aspekt der Ausga-
bensenkung aus. Je älter die Befragten, desto geringer ist das Gewicht, das
auf die Begrenzung der Ausgaben im Rentensystem gesetzt wird. Das Lebens-
arbeitszeitmodell ist bei den 46- bis 65-Jährigen besonders populär, während
die generelle Erhöhung des Rentenalters in dieser Altersgruppe am wenigsten
Rückhalt findet. Dies alles zeigt, dass die persönliche Betroffenheit eine wichtige
Rolle in der Einschätzung verschiedener Reformansätze für die Schliessung der
Finanzierungslücke in der obligatorischen Altersvorsorge spielt.
Abbildung 17: Relative Gewichtung von Reformansätzen – nach Alter
Lebensarbeitszeit- Senkung der Höhere Abgaben auf
Höhere MWST Höheres Rentenalter
modell Ausgaben Löhnen
2.0
1.5 1.4
1.5
1.4
1.4 1.4 1.3 1.4
1.1
1.0 1
0.9
0.9 0.8
0.8 0.8 0.8 0.8
0.7
0.6 0.6
0.5 0.4
0.0
26 5
46 5
5
65
26 5
46 5
5
65
26 5
46 5
5
65
26 5
46 5
5
65
26 5
46 5
5
65
-2
-4
-6
-2
-4
-6
-2
-4
-6
-2
-4
-6
-2
-4
-6
>
>
>
>
>
18
18
18
18
18
«Wie gezeigt, bestehen verschiedene Ansätze zur Schliessung der Finanzierunglücke bei der obligatorischen
Altersvorsorge (AHV und BVG). Geben Sie zum Schluss nochmals Ihre Prioritäten an. Verteilen Sie hierzu 5
Punkte auf die folgenden Ansätze. (Sie können alle Punkte auf einen Ansatz setzen oder sie beliebig verteilen).»
5.3 Potenzieller Stimmentscheid
Die positive Grundhaltung der Stimmberechtigten in der Schweiz wirkt sich auf
die Einschätzung des eigenen Stimmentscheids bei einer potenziellen Abstimmung
zur Einführung eines Lebensarbeitszeitmodells aus. Insgesamt geben 61 Prozent
der Befragten an, Ja oder eher Ja stimmen zu würden. Der weitaus grössere
Teil (43 %) sagt dabei allerdings bloss «eher Ja». Dies macht deutlich, dass
die Zustimmungsbereitschaft keine bedingungslose ist. Wie gezeigt, spielt die
persönliche Betroffenheit eine wichtige Rolle für die Haltung zu Reformansätzen
in der Altersvorsorge. Das Ausmass der Betroffenheit hängt dabei stärk von
der konkreten Ausgestaltung eines Lebensarbeitszeitmodells ab. Grundsätzlich
lässt sich jedoch feststellen, dass ein Lebensarbeitszeitmodell, das vor allem für
Personen mit einer langen tertiären Ausbildung zu einem späteren, regulären
Eintritt ins Rentenalter führt, gerade deshalb Erfolgschancen hat. Anders als eine
generelle Erhöhung des Rentenalters zielt es bloss auf Minderheit der Stimmbe-
völkerung. Der grössere Teil der Stimmberechtigten, weiss mit Sicherheit, davon
nicht betroffen zu sein.
225 LEBENSARBEITSZEITMODELL
In der potenziellen Zustimmungsbereitschaft für ein Lebensarbeitszeitmodell zeigt
sich ein Links-rechts-Gegensatz. Die Wählerbasis der SVP spricht sich am ehesten
und Basis der Grünen am wenigsten dafür aus. Die Zustimmung in den beiden
grossen Sprachregionen ist aktuell ähnlich gross, wobei es in der Deutschschweiz
eine etwas grössere Opposition dagegen gibt.
Abbildung 18: Fiktiver Stimmentscheid
Gesamt
8 16 15 43 18
Nach Parteiwählerschaft
Grüne 11 24 16 34 15
SP 8 21 13 44 14
GLP 6 20 16 42 16
CVP 5 19 18 46 12
FDP 6 14 15 48 18
SVP 8 9 8 46 29
Nach Sprachregion
Deutschschweiz 9 16 14 43 18
Französische Schweiz 5 17 17 42 18
0% 25% 50% 75% 100%
Nein
Eher Nein
Weiss nicht
Eher Ja
Ja
«Was denken Sie: Wie würden Sie stimmen, wenn es zu einer Volksabstimmung über die Einführung eines
entsprechenden Lebensarbeitsmodell kommt?» - Parteiwählerschaft
Die Chancen eines Lebensarbeitszeitmodells an der Urne hängen nicht nur von der
konkreten Ausgestaltung des Modells, sondern auch von den Argumenten und der
Dynamik im Abstimmungskampf ab. Hinweise über die Konfliktlinien in einen po-
tenziellen Abstimmungskampf liefern bereits heute die Urteile über die Argumente
für und gegen dieses Modell. Am meisten für das Lebensarbeitszeitmodell spricht
aus Sicht der Befragten, dass dieses den Unterschieden zwischen verschiedenen
Personengruppen gerecht wird (40 %) und, dass es dazu beiträgt, die Finanzie-
rungslücke in der Altersvorsorge zu schliessen (38 %). Das Gegenargument, das
am meisten Zustimmung findet, ist die Befürchtung, dass das System ausgetrickst
werden könnte (39 %). Dies zeigt deutlich, dass ein Lebensarbeitszeitmodell, das
an der Urne Erfolg haben soll, so ausgestaltet werden muss, dass es keine Anreize
zu taktischem Verhalten setzt. Etwa indem Personen eine Arbeitstätigkeit zum
235 LEBENSARBEITSZEITMODELL
Schein aufnehmen, damit ihr Rentenanspruch früher erfüllt ist. Am zweithäu-
figsten gewählt wird das Gegenargument, das Modell sei zu kompliziert (31 %).
Ähnlich wie das erste Argument weist dies darauf hin, dass die potenzielle Kritik
weniger auf die Grundidee zielt als auf die konkrete Umsetzung, die klar, einfach
und stabil sein muss, um in einem potenziellen Abstimmungskampf bestehen
zu können. Immerhin geben fast gleich viel Befragte (30 %) an, das Modell
sei einfach und klar. Das zeigt, dass bei geeigneter Ausgestaltung auch, dieses
positive Argument bei der Stimmbevölkerung ziehen kann. Ähnlich offen ist die
Frage, ob das Lebensarbeitszeitmodell als fair wahrgenommen wird. Gegenwärtig
wird dies nur ein wenig häufiger (31 %) als Argument dafür denn als Argument
dagegen (28 %) angesehen.
Abbildung 19: Argumente, die für Lebensarbeitszeit sprechen
Wird den Unterschieden zwischen 40
Personengruppen gerecht
Hilft, die Finanzierungslücke zu schliessen 39
Ist fair 31
Ist einfach und klar 30
Es spricht nichts dafür 16
0% 10% 20% 30% 40% 50%
«Welche Faktoren sprechen aus Ihrer Sicht für die Einführung des genannten Lebensarbeitszeitmodell? (Mehrere
Antworten möglich)»
Abbildung 20: Argumente, die gegen Lebensarbeitszeit sprechen
Kann ausgetrickst werden 39
Ist kompliziert 31
Ist unfair 28
Bringt nichts 11
Es spricht nichts dagegen 25
0% 10% 20% 30% 40% 50%
«Welche Faktoren sprechen aus Ihrer Sicht gegen die Einführung des genannten Lebensarbeitszeitmodell?
(Mehrere Antworten möglich)»
246 DATENERHEBUNG UND METHODE 6 Datenerhebung und Methode Datenerhebung und Stichprobe Die Datenerhebung zur vorliegenden Befragung fand vom 19. Februar bis am 12. März 2020 statt. Die Befragung erfolgte online. Die Rekrutierung der Befragten fand einerseits über das Online-Panel von sotomo, andererseits via Online-Panel von Intervista statt. Das Sample beinhaltet 1 221 Personen, von denen 918 in der Deutschschweiz und 303 in der Romandie wohnhaft sind. Repräsentative Gewichtung Da sich die Teilnehmenden der Umfrage selber rekrutieren (opt-in), ist die Zu- sammensetzung der Stichprobe nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit. So nehmen typischerweise mehr Männer als Frauen an politischen Umfragen teil. Den Verzerrungen in der Stichprobe wird mittels statistischer Gewichtungsverfahren entgegengewirkt. Die Gewichtung erfolgt dabei mittels IPF-Verfahren (Iterative Proportional Fitting). Neben räumlichen (Wohnort) und soziodemographischen (Alter, Geschlecht, Bildung) Gewichtungskriterien werden dabei auch politische Gewichtungskriterien beigezogen (Stimm- und Wahlverhalten, regionale Parteien- struktur usw.). Durch die Gewichtung wird eine hohe Repräsentativität für die aktive Stimmbevölkerung erzielt. 25
Sie können auch lesen