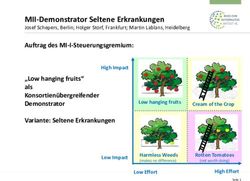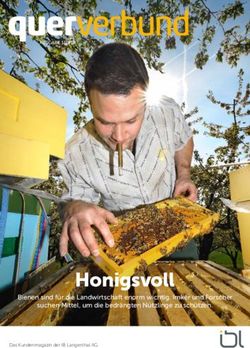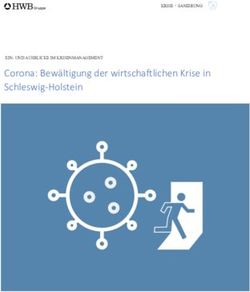Arbeitsmarktliche Trendentwicklungen im OECD-Raum - Begriffe, Definitionen Entwicklung der Arbeitslosigkeit Weitere Trendentwicklungen Fazit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1. Arbeitsmarktliche Trendentwicklungen im
OECD-Raum
Begriffe, Definitionen
Entwicklung der Arbeitslosigkeit
Weitere Trendentwicklungen
Fazit
11.1. Begriffe, Definitionen
• Erwerbspotential (B)
Wohnbevölkerung im Alter von 15-64 bzw. Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter
• Erwerbspersonen (P)
Erwerbstätige (E) und Arbeitslose (U) bzw. die Er-
werbsbevölkerung
• Erwerbsquote (P/B)
• Arbeitslosenquote (U/P):
Definitorische Zusammenhänge
P = B · (P/B) = E + U
U/P = U/(E+U)
2Erwerbsquoten nach Alter und Geschlecht, SchweizerInnen, 1970-2000
100%
90%
80%
70%
Erwerbsquote
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Alter in Jahren
Frauen, 1970 Frauen, 2000 Männer, 1970 Männer, 2000
3Sockel- bzw. Gleichgewichtsarbeitslosigkeit
4Problem hoher Gleichgewichtsarbeitslosigkeit
• Hohe Gleichgewichtsarbeitslosigkeit impliziert ein ho-
hes Mass an wirtschaftlicher Ineffizienz: Ressourcen
bleiben ungenützt und Outputpotentiale werden nicht
ausgeschöpft.
• Sie belastet die öffentlichen Finanzen: Einnahmen sin-
ken, während Ausgaben steigen.
• Die direkt Betroffenen erleiden Verluste, deren Aus-
mass von der Durchlässigkeit der Arbeitslosigkeit ab-
hängt.
56
1.2. Entwicklung der Arbeitslosigkeit
• Obwohl die Arbeitslosigkeit in allen Ländern mit etwa
der gleichen Rate entsteht, baut sie sich je nach Land
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit wieder ab.
• Dies ist zum einen an der Entwicklung der Arbeitslo-
senquote im Zeitablauf zu erkennen: In Ländern, in de-
nen es zu einem schnellen Abbau kommt, bewegt sich
die Arbeitslosigkeit wellenartig um ein konstantes Ni-
veau, während sie sich in den anderen Ländern trep-
penartig nach oben entwickelt.
• Die unterschiedliche Geschwindigkeit des Abbaus ist
zum anderen am positiven Zusammenhang zwischen
der Höhe der Arbeitslosigkeit und dem Ausmass der
Langzeitarbeitslosigkeit zu sehen, was wiederum ein
Beleg dafür ist, dass nicht die Inzidenz, sondern die
Dauer der Arbeitslosigkeit für das unterschiedliche Ni-
veau der Arbeitslosigkeit im OECD-Raum massgebend
ist.
7Arbeitslosigkeit in OECD-Ländern, 1970-06
14
12
EG
Arbeitslosenquote in Prozent
10
8
Nordamerika
EFTA
6
4
Japan
2
0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Quelle: Employment Outlook, OECD, verschiedene Jahrgänge
8Arbeitslosenquote (%)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
Arbeitslosenquote der Schweiz, 1970-2008
1988
1990
Jahresanfang
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
9ARBEITSLOSENQUOTE UND LANGZEITANTEIL 1989
90
80
BEL
70 ITA
IRE
60
GRE SPN
50 POR NLD
GER
FRA
40 UKD
30
DEN
AUS
20 JAP
NZL
NOR
10
SWE FIN USA CAN
SWZ
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Arbeitslosenquote (in %)
10ARBEITSLOSENQUOTE UND LANGZEITANTEIL 2000
70
Anteil an Langzeitarbeitslosen (in %)
60 ITA
IRE GRE
GER
50
POR
SPN
FRA
40
NLD
30 UKD
AUS FIN
JAP SWE
20 SWZ DEN NZL
CAN
10 USA
NOR
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Arbeitslosenquote (in %)
111.3. Weitere Trendentwicklungen
Der strukturelle Wandel auf den Arbeitsmärkten der hoch
entwickelten Industrieländer zeichnet sich durch drei
Trends aus:
- eine wachsende Internationalisierung der Arbeitstei-
lung (Globalisierung), die dafür sorgt, dass immer
mehr einfache, repetitive Tätigkeiten ins Ausland ab-
wandern und einen wachsenden Anteil an anspruchs-
volleren Beschäftigungen zurücklassen, die höhere
Qualifikationen erfordern;
- einen bildungsintensiven („skill-biased“) technischen
Fortschritt, der eine steigende Nachfrage nach Höher-
qualifizierten zu Lasten von Un- und Angelernten aus-
löst, und
- eine Tertiarisierung der Arbeitswelt bzw. eine kontinu-
ierliche Verlagerung der Beschäftigung von den ge-
werblich-industriellen Tätigkeiten hin zu den Dienst-
leistungsberufen, was die Nachfrage nach schulischen
Berufsausbildungen ansteigen lässt.
12Tertiarisierung:Sektorale Beschäftigungstrends, jährliche Wachstumsraten in Prozent, 1979-
90
2.0
Jährliche relative Veränderung (in %)
1.5
1.0
0.5 Ozeanien Nordamerika Japan
EG EFTA
0.0
Ozeanien Nordamerika Japan
-0.5
EG EFTA
-1.0
-1.5
-2.0
Verarbeitung private
Dienstleistungen
13Der Abbau in der verarbeitenden Industrie bezieht
sich auf die Beschäftigung, nicht auf die Produktion.
14Abbau industrieller Arbeitsplätze für Ungelernte eine
besondere Gefahr
• Die betroffenen Produktionsarbeiter sind vielfach ohne
Berufsausbildung, verdienen aber aufgrund des hohen
Mechanisierungsgrades ihrer Stellen einen im Ver-
gleich zur Qualifikation hohen Lohn.
• Die Löhne im Dienstleistungssektor für Ungelernte
sind vergleichsweise niedrig, da die Produktivität eines
Einzelnen dort vielmehr von seiner Qualifikation als
von seiner Arbeitsstelle abhängt.
• Aufgrund des drohenden Einkommensverlustes gestal-
tet sich die Reintegration von Ungelernten besonders
schwierig.
15Der technische Fortschritt ist bildungsintensiv (hu-
mankapitalnutzend).
D.h., die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften er-
höht sich zu Lasten der Ungelernten.
Erläuterung:
Technischer Fortschritt ist x-faktornutzend, wenn bei
konstanten Faktoreinsatzverhältnissen die Grenzproduk-
tivität des Faktors x stärker steigt als jene der anderen
Produktionsfaktoren. Bei Faktorentlohnung gemäss der
Grenzproduktivität führt dies zu einem verstärkten Ein-
satz des Faktors x auf Kosten der anderen Faktoren.
Fazit:
Angesichts des Tertiarisierung der Berufswelt und des
Vordringens bildungsintensiver Technologien bleibt we-
nig qualifizierten Arbeitskräften die Wahl zwischen
Lohnverzicht oder Arbeitslosigkeit.
16Verhältnis der Arbeitslosenquoten von Niedrig- und Hochqualifizierten anfangs der 80er
bzw. 90er Jahre
6
5
4
3
2
1
0
USA Kanada Australien Frankreich Grossbritannien Italien Deutschland
80er Jahre 90er Jahre
Quelle: OECD (1994).
17Relative jährliche Veränderung der Reallöhne von Arbeitskräften niedrigen Erwerbsein-
kommens
3
2
1
0
-1
-2
USA Kanada Australien Frankreich Grossbritannien Italien Deutschland
Quelle: OECD (1994).
18Arbeitslosenquote nach dem höchsten Bildungsabschluss der Betroffenen, 1970–2000
9%
8%
7%
6%
5%
Prozent
4%
3%
2%
1%
0%
kein Abschluss Sekundarabschluss Tertiärabschluss
1970 1980 1990 2000
19Entwicklung von Lohn- und Arbeitslosigkeit nach Bildungsstand in der Schweiz, 1991-07
20Technischer Fortschritt dennoch kein Job-Killer
Rationalisierungen führen langfristig nicht zu weniger,
sondern zu mehr Beschäftigung. Das zeigt z.B. der Fall
Schweiz: Im Zeitraum 1870-1994 ist die Arbeitsproduk-
tivität in der Schweiz um 630 Prozent gestiegen, und
trotzdem hat die Beschäftigung um 192 Prozent zuge-
nommen. Von anhaltender Massenarbeitslosigkeit war
weit und breit keine Spur.
Berechnungshintergrund
Definitionsgleichungen:
−1 −1
⎛Q⎞ ⎛H⎞
Q ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ ⎜ ⎟ = E
⎝H⎠ ⎝E⎠
( Q H )t ( H E )t
−1 −1
Qt Et
⋅ ⋅ =
( Q H )0 ( H E )0
−1 −1
Q0 E0
wobei Q = Wertschöpfung
Q
= Arbeitszeitproduktivität
H
H
= Arbeitsstunden pro Erwerbstätigen
E
E = Erwerbstätige
12,36 · (7,30)-1 · (0,58)-1 = 2,92
21Wie ist dieses, der Intuition scheinbar widersprechen-
de Ergebnis zu erklären?
• Ein Grund liegt darin, dass der technische Wandel, der
hinter dem Produktivitätsfortschritt steht, nicht etwa
wie Mana vom Himmel fällt, sondern erst durch den
Einsatz neuer Maschinen und Geräte zustande kommt,
und deren Entwicklung und Herstellung erfordert Ar-
beitskraft.
• Hinzu kommt, dass höhere Produktivität gleichzeitig
höhere Gewinne und/oder Löhne bedeutet, woraus zu-
sätzliche Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen
entsteht.
• Ferner zeigen empirische Untersuchungen, dass jene
Länder, die in einer Branche hinsichtlich Produktivität
weltweit führend sind, dies auch in bezug auf die Be-
schäftigung sind, und zwar aus dem einfachen Grund,
dass hohe Produktivität internationale Konkurrenzfä-
higkeit und damit Absatzmöglichkeiten sichert.
Kurzum: Eine Ausweitung der Produktionsmöglichkeiten
einer Gesellschaft, worum es sich bei einer Produktivi-
tätssteigerung ja handelt, hat stets zu mehr (CH 1870-
1994: 1136%) und nicht weniger Produktion geführt, und
zwar aus dem einfachen Grund, dass das Streben der
Menschen nach einem materiell besseren Leben bislang
keinen Abbruch erfuhr.
221.4. Fazit
• Da die langfristigen Trends auf dem Arbeitsmarkt alle
OECD-Länder gleichermassen treffen, kann nicht die
Entstehung von Arbeitslosigkeit bzw. die unterschied-
liche Fähigkeit der Länder, bestehende Arbeitsplätze zu
erhalten, die unterschiedlichen Beschäftigungserfolge
der Länder erklären.
• Vielmehr müssen folgende Faktoren die Unterschiede
erklären:
- unterschiedliche Erfolge in der Schaffung neuer Ar-
beitsplätze und/oder
- eine unterschiedliche Fähigkeit bzw. Bereitschaft der
Arbeitslosen zur Stellenannahme.
• Konjunkturelle Faktoren kommen nicht in Betracht, da
es hier um die Erklärung längerfristiger Unterschiede
geht.
23Sie können auch lesen