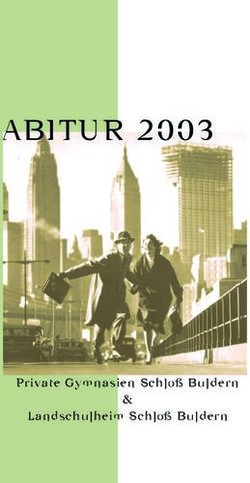Auflage - Leitfaden zum Umgang mit heterogenen Lernständen infolge der Corona-Pandemie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Leitfaden
zum Umgang mit heterogenen Lernständen
infolge der Corona-Pandemie
Stand: 24. März 2022
2. AuflageImpressum:
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.):
Leitfaden zum Umgang mit heterogenen Lernständen infolge der Corona-Pandemie,
2. aktualisierte Auflage,
Erfurt 2022
Herausgeberin:
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt
Telefon: 0361 57-100
Telefax: 0361 3794690
poststelle@tmbjs.thueringen.de
Titelgrafik: Bildagentur PantherMedia | VLADGRIN
-1-Inhalt
1 Einleitung.....................................................................................................................3
2 Hinweise zum Umgang mit heterogenen Lernständen .............................................4
2.1 Ermittlung individueller Lernstände und Ableitung von Maßnahmen 4
2.2 Nutzung der Kompetenztests im Schuljahr 2021/2022 7
2.3 Schulinterne Lehr- und Lernplanung 8
2.4 Gestaltung von Übergängen 9
2.5 Stärkung der Sprachbildung als Voraussetzung für den Schulerfolg 9
3 Hinweise zu ausgewählten Schülergruppen ...........................................................11
3.1 Lernende in der Schuleingangsphase 11
3.2 Lernende mit Lernschwierigkeiten 11
3.3 Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf 12
3.4 Lernende mit Förderbedarf in Deutsch als Zweitsprache 12
4 Hinweise zur Unterrichtsgestaltung.........................................................................15
5 Weitere unterstützende Maßnahmen .......................................................................17
5.1 Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote des Schulpsychologischen
Dienstes (für Schulen, Eltern und Lernende) 17
5.2 Landesaktionsprogramm "Stärken - Unterstützen - Abholen" für Kinder und
Jugendliche nach Corona 17
5.3 Fortbildungs- und Beratungsangebote für Pädagoginnen und Pädagogen 18
5.4 Maßnahmen zur Unterstützung von Schülergruppen und einzelnen
Lernenden 19
6 Weiterführende Links ................................................................................................21
7 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des ThILLM ....................................25
8 Fortbildungsangebote des ThILLM ..........................................................................27
9 Literatur- und Quellenverzeichnis ............................................................................29
-2-1 Einleitung
Das schulische Leben und Lernen hat ab dem zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 vielfältige
Veränderungen und Herausforderungen erfahren. Präsenzunterricht musste durch Distan-
zunterricht in verschiedenen Formen ersetzt, ergänzt und beides miteinander verbunden
werden. Lernumgebungen und die Bildung von Lerngruppen mussten flexibel und pädago-
gisch sinnvoll angepasst werden. Daraus resultieren neue Erfahrungen z. B. hinsichtlich der
Gestaltung von Beziehungen und Kommunikationsstrukturen, der Auswahl und didaktischen
Aufbereitung von Lerngegenständen, des Medieneinsatzes und somit des Unterrichts und
der Schulorganisation. Ein weiteres wichtiges Feld des Erfahrungsgewinns ist die Zusam-
menarbeit mit Erziehungspartnerinnen und -partnern, allen voran mit den Eltern.
Diese Veränderungen haben in vielfältiger Hinsicht Auswirkungen auf Schülerinnen und
Schüler, vor allem in den Bereichen Bildung, soziale Interaktion, sozialemotionale Entwick-
lung, körperliche Aktivität sowie psychisches Wohlbefinden. Sie wirken teilweise als Verstär-
ker bereits zuvor bestehender Ungleichheiten und Entwicklungsrisiken 1.
Andererseits werden aus der Praxis auch Lernzuwächse in verschiedenen Kompetenzberei-
chen gespiegelt. Die unterschiedlichen Folgen für die Lernenden müssen in den Schulen
wahrgenommen, zielgerichtet erfasst und berücksichtigt werden.
Dabei geht es nicht ausschließlich darum pandemiebedingte Defizite auszugleichen.
Besonders positive Erfahrungen, erfolgreiche Entwicklungen und Beteiligungsmöglichkeiten
von Kindern und Jugendlichen sollten in den Schulen aufgegriffen und verstärkt werden.
Unbestritten wird einmal mehr die zentrale Rolle der individuellen Förderung als durchgängi-
ges Prinzip des Lehrens und Lernens 2 deutlich. Individuelle Förderung ist eine wichtige Be-
dingung, um für alle Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen
und Bedarfen Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten.
Daraus ergibt sich insbesondere die Notwendigkeit, die Kompetenzentwicklung der Lernen-
den kontinuierlich festzustellen, um darauf basierend passgerechte Lernangebote zu unter-
breiten, Unterricht zu entwickeln und weitere unterstützende Maßnahmen zu ergreifen.
Verschiedene Formen der Erhebung von Lern- und Entwicklungsständen müssen im Rah-
men der schulinternen Lehr- und Lernplanung zielgerichtet festgelegt und verankert werden.
Die Bewertung von Leistungen, Prüfungsmodalitäten, Versetzungs- und Übertrittsregelungen
sind ggf. anzupassen.
Der weiterentwickelte Leitfaden soll allgemein bildende Schulen dabei unterstützen, Lern-
und Entwicklungsstände systematisch zu erfassen und zielgerichtete Maßnahmen zur Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler zu ergreifen. Das geht einher mit angepassten rechtli-
chen Regelungen und umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen, auch im Rahmen des
Thüringer Landesaktionsprogramms "Stärken - Unterstützen – Abholen“ 3 für Kinder und Ju-
gendliche nach Corona.
1 Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften (2021): 8. Ad-hoc-Stellungnahme – 21. Juni 2021:
Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie: psychosoziale und edukative Herausforderungen und
Chancen.
2 vgl. § 2 Abs.2 ThürSchulG.
3 https://bildung.thueringen.de/schule/staerken-unterstuetzen-abholen
-3-2 Hinweise zum Umgang mit heterogenen Lernständen
Die Lern- und Entwicklungsstände der Schülerinnen und Schüler werden sowohl anhand der
individuellen als auch der kriterialen Bezugsnorm festgestellt. Wichtige Grundlagen sind die
Thüringer Lehrpläne und die Bildungsstandards. Es ist zu beachten, dass die Ziele der Kom-
petenzentwicklung in den Thüringer Lehrplänen in der Regel in Doppeljahrgangsstufen dar-
gestellt sind. Das eröffnet Spielräume für die schulinterne Lehr- und Lernplanung und Ent-
wicklungsräume für die Lernenden.
Im Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre (TBP-18) werden entwicklungsorientierte Anregun-
gen für die pädagogische Arbeit bis hin zu individuellen Lernangeboten und Lernarrange-
ments sowie zur Kooperation mit Bildungspartnern gegeben.
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können z. B. durch krankheitsbedingte Aus-
fälle oder längere Zeiten des Distanzlernens Lernrückstände entstehen. Das kann sich auf
Klassen oder Lerngruppen in bestimmten Fächern und/oder Kompetenzbereiche beziehen,
weil die schulinterne Lehr- und Lernplanung nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Es
können ebenfalls einzelne Schülerinnen und Schüler von individuellen Lernrückständen be-
troffen sein.
Auf diese Situationen muss mit der Überarbeitung der schulinternen Lehr- und Lernplanung,
Maßnahmen zur individuellen Förderung, Entwicklungsvorhaben der Schule sowie der An-
passung von Reglungen z. B. hinsichtlich von Prüfungen oder Versetzungen reagiert wer-
den. Wichtige Handlungsgrundlagen und -ansätze werden nachfolgend exemplarisch darge-
stellt.
2.1 Ermittlung individueller Lernstände und Ableitung von Maßnahmen
In der Schule müssen für die Ermittlung der Lern- und Entwicklungsstände mehrere Perspek-
tiven zusammengeführt werden:
■ die Perspektive der Lernenden auf ihre eigenen Lernprozesse, Lernergebnisse, Er-
folge und Probleme beim Lernen in Distanz und in Präsenz,
■ die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer zu den einzelnen Lernenden im Distanz-
und Präsenzunterricht,
■ die Rückmeldungen der Eltern insbesondere zum Distanzunterricht.
Rückmeldungen von Eltern sollten zielgerichtet eingeholt werden.
Diese mehrperspektivische Sicht auf die Lernprozesse und die Lernentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler ist eine wichtige Grundlage der weiteren Unterrichtsgestaltung und der
individuellen Förderung.
Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler kann unter anderem mit folgenden Vorge-
hensweisen ermittelt werden:
• von der Lehrkraft moderierte Gespräche in der Lerngruppe, z. B. unter Verwendung von
Leitfragen,
• informelle und strukturierte Einzelgespräche mit Lernenden,
• unterschiedliche Feedbackmethoden, z. B. Zielscheibe, Skalierungen, Aufstellungen,
• schriftliche Befragungen der Lernenden, z. B. unter Verwendung von Fragebögen zur
Einschätzung der Kompetenzentwicklung.
-4-Rückmeldungen können von den Klassenleitungen, aber auch von Fachlehrerinnen und
Fachlehrern und Förderlehrkräften eingeholt werden. Schülerinnen und Schüler können z. B.
mit konkretem Bezug auf ein Fach einschätzen, welche Lernschwerpunkte sie im Distanzun-
terricht gut verstehen und bearbeiten konnten und wo sie Probleme hatten. Für andere Ler-
nende sind Einzelgespräche mit Bezug zur Förderplanung zielführend. Wer Rückmeldungen
von wem, in welcher Form und wozu einholt, muss im Pädagogenteam abgestimmt und fest-
gelegt werden.
Zur Zusammenführung der Perspektiven der Lehrkräfte wird die Durchführung einer Klas-
senkonferenz empfohlen. Das ist mit folgenden Schritten verbunden:
■ Feststellung von Lernrückständen bei einem Schüler bzw. einer Schülerin durch die
zuständige Fachlehrerin bzw. den zuständigen Fachlehrer,
■ Information der Klassenleitung durch die zuständige Lehrerin bzw. den zuständigen
Lehrer,
■ zielgerichteter Einsatz von Methoden und Verfahren der pädagogischen Diagnostik,
■ Festlegung von Maßnahmen unter Einbezug der Klassenkonferenz.
Selbsteinschätzung Einschätzung der Rückmeldungen der
der Lernenden Lehrerinnen u. Lehrer Eltern
Klassenkonferenz
führt die Wahrnehmungen zusammen und beschließt
Pädagogische Maßnahmen für die Maßnahmen zur indivi-
Diagnostik Unterrichtsgestaltung duellen Förderung
Die in der Klassenkonferenz festgelegten Maßnahmen 4 müssen hinsichtlich ihrer Umsetzung
und Wirksamkeit regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden.
Den Lehrerinnen und Lehrern steht für Feststellungen zur Lernen- und Kompetenzentwick-
lung ein breites Instrumentarium zur Verfügung. Wesentliche Methoden der pädagogischen
Diagnostik sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Beobachtungen ■ beiläufig mit Notizen
■ zielgerichtet auf Beobachtungsschwerpunkte bezogen
■ systematisch nach bestimmten Verfahren und mit kollegialem
Austausch verbunden
■ kriteriengeleitet unter Verwendung von Rastern und Beobach-
tungsbögen
4 vgl. § 39 ThürSchulO.
-5-Gespräche und ■ Interviews zur Fremd- und Selbsteinschätzung
Befragungen ■ Verwendung von Leitfragen
■ Fragebögen
■ Checklisten
Analyse von Lern- ■ Lerntagebuch
und Arbeitsergeb- ■ Portfolio
nissen ■ bearbeitete Aufgaben
■ Lernstandsfeststellungen
Verfahren der pä- ■ standardisiert
dagogischen Diag- ■ informell
nostik
An den Schulen kommen vielfältige Instrumente und Verfahren zur Feststellung von Lern-
und Entwicklungsständen zum Einsatz, die sich bewährt haben und weiter genutzt werden
sollen. Auf zwei zentrale Angebote wird im Folgenden hingewiesen.
Individuelle Lernstandsanalyse online (ILeA plus)
Seit dem Schuljahr 2021/2022 wird in Kooperation des Thüringer Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Branden-
burg ILeA plus für die Thüringer Schulen zur Nutzung bereitgestellt.
ILeA plus ist ein wissenschaftlich fundiertes und erprobtes Instrument zur individuellen Lern-
standsanalyse in den Fächern Deutsch und Mathematik bis zur Klassenstufe 6. Die Nutzung
in den Klassenstufen 7 und 8 ist möglich. Mit ILeA plus werden Kompetenzstände diagnosti-
ziert. Auf dieser Grundlage können individuelle Lern- und Unterstützungsangebote erstellt
werden.
Zu den Nutzungsbedingungen und zu Unterstützungsangeboten des ThILLM für die Arbeit
mit ILeA plus stehen Informationen auf dem Thüringer Schulportal für alle interessierten Thü-
ringer Schulen zur Verfügung. Diese sind über folgende Links zu finden.
https://www.schulportal-thueringen.de/ileaplus?csthl=ilea%20plus
https://www.schulportal-thueringen.de/ileaplus/unterstuetzungsmaterial
2P I Potenzial und Perspektive
2P I Potenzial & Perspektive ist ein onlinebasiertes, standardisiertes Verfahren zur Erfas-
sung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen (neu) zugewanderter Schülerinnen und
Schüler und kann ggf. auch für weitere Schülergruppen angewendet werden. Der Einsatz ist
ab Klassenstufe 5 sowie im berufsbildenden Bereich möglich.
Das Diagnoseverfahren umfasst verschiedene Bereiche (Deutsch, Englisch, Mathematik,
kognitive Basiskompetenz, methodische Kompetenz, berufliche Kompetenz, Bildungsbiogra-
fie). Die Feststellung bestehender Kompetenzen und Entwicklungspotenziale erfolgt mithilfe
erprobter und standardisierter Tests, um im Anschluss Informationen zu individuellen Förder-
bedarfen ableiten zu können
-6-Den Zugang zur Plattform https://plattform.2pthueringen.de/ erhalten weiterführende all-
gemein bildende und berufsbildende Schulen in Thüringen nach einer Interessenbekundung
im zuständigen Staatlichen Schulamt. Das Formular für die Interessenbekundung wird unter
https://bildung.thueringen.de/2p bereitgestellt.
Weitere Informationen zu „2P I Potenzial und Perspektive“ sind unter dem folgenden Link zu
finden. https://bildung.thueringen.de/schule/migration/schulbesuch#c43437
Zusammenfassend wird festgestellt, dass Schulen verschiedene Verfahren zur pädagogi-
schen Diagnostik nutzen können. Über die konkrete Auswahl der Verfahren entscheidet die
Schule eigenverantwortlich.
Allen Thüringer Schulen stehen die Verfahren ILeA plus, 2P | Potenzial & Perspektive sowie
die Thüringer Kompetenztests zur Verfügung. Deren Einsatzmöglichkeiten und weitere Infor-
mationen im Überblick sind unter folgendem Linkt zusammengestellt.
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/bildung/lernrueckstaende/2022-02_Verfah-
ren_zur_paedagogischen_Diagnostik.pdf
Aus den erfassten Lern- und Entwicklungsständen sind Maßnahmen zur individuellen Förde-
rung abzuleiten. Dazu gehören zum Beispiel
■ die Anpassung von bereits bestehenden Fördermaßnahmen bzw. sonderpädagogi-
schen Förderplänen,
■ die Festlegung von Fördermaßnahmen im Rahmen einer pädagogischen Förderpla-
nung,
■ die zielgerichtete Differenzierung von Aufgabenstellungen, integrative und/oder addi-
tive Fördermaßnahmen im unterrichtlichen und im außerunterrichtlichen Bereich,
■ Teilnahme an Intensiv- oder Intervallkursen, ggf. Anpassung der Verweildauer im In-
tensivsprachkurs,
■ Priorisierung von Schwerpunkten der individuellen Kompetenzentwicklung,
■ Nachteilsausgleich und/oder Verzicht auf Noten,
■ Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenwirken mit Eltern und mit anderen Bil-
dungs- und Erziehungspartnern.
Pädagogische Diagnostik zielt auf die Ableitung von pädagogischen Maßnahmen zur indivi-
duellen Förderung und Anpassungsleistungen, welche die Schule erbringen kann.
Sie ist Grundlage für konstruktives Feedback und Handeln.
2.2 Nutzung der Kompetenztests im Schuljahr 2021/2022
Die Thüringer Kompetenztests als landesweite Lernstandserhebungen, die in den Klassen-
stufen 3, 6 und 8 in den Fächern Deutsch und Mathematik und in den Klassenstufen 6 und 8
im Fach Englisch/Französisch (erste Fremdsprache) durchgeführt werden, lassen Rück-
schlüsse auf den Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu. Damit sind sie für die Lehrerin-
nen und Lehrer auch in der Corona-Pandemie ein mögliches diagnostisches Instrument.
Die verpflichtende Durchführung der Kompetenztests in den Klassenstufen 3, 6 und 8 wird
im Schuljahr 2021/2022 ausgesetzt. Alle Schulen erhalten die Testmaterialien entsprechend
der Anmeldung und können diese auch als Unterstützung bei der Feststellung der Lernaus-
gangslage einsetzen. Die Ergebniseingabe kann bis zum letzten Unterrichtstag des zweiten
-7-Schulhalbjahres durchgeführt werden. Die nach dieser Eingabe sofort abrufbaren Rückmel-
dungen werden durch Vergleichswerte und graphische Darstellungen aufgewertet und kön-
nen somit besser zur Ermittlung der Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler
genutzt werden. Deshalb wird den Schulen ausdrücklich empfohlen, die Testmaterialien und
die detaillierten Rückmeldungen zu nutzen. Für die individuelle Förderung der Schülerinnen
und Schüler auf der Grundlage der Testergebnisse sind die zu den Tests gehörenden didak-
tischen Materialien eine wichtige Hilfestellung.
Zusätzlich zu den Kompetenztests des Schuljahres 2021/2022 stehen den Schulen die Mate-
rialien der Kompetenztests der vergangenen Jahre für Lernstandserhebungen zur Verfü-
gung. Umfangreiche Informationen und Beispielaufgaben für die in den Klassenstufen 3 und
8 getesteten Fächer können auf der Internetseite des Instituts zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen Berlin (IQB) (https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben) abgerufen wer-
den. Materialien der Kompetenztests Mathematik vergangener Jahre stehen in der Medio-
thek des Thüringer Schulportals zur Verfügung.
2.3 Schulinterne Lehr- und Lernplanung
Die schulinterne Lehr- und Lernplanung muss in der aktuellen Situation ggf. Festlegungen
zum Umgang mit nicht bearbeiteten Lerninhalten und nicht im vollen Umfang entwickelten
Kompetenzen sowie zu ihrer Priorisierung beinhalten. Zu klären sind - zunächst auf Ebene
der Fachkonferenzen - u. a. folgende Fragen:
■ Welche allgemeinen Lernrückstände gibt es aktuell (im Fach, in der Klassenstufe, in
der Klasse)?
■ Was muss bei der weiteren Lehr- und Lernplanung an anderer Stelle berücksichtigt
werden?
■ Welche Kenntnisse und Kompetenzen können fortlaufend ausgebaut werden (Spiral-
curriculum)?
■ Welche fächerübergreifenden Synergien können genutzt werden?
■ Was muss priorisiert werden?
■ Wie wird die individuelle Förderung umgesetzt?
Die Ergebnisse der Fach- und Klassenkonferenzen müssen in der schulinternen Lehr- und
Lernplanung zusammengeführt werden. Die Lehrerkonferenz ist entsprechend ihrer Aufga-
ben einzubeziehen.
Es gilt der Grundsatz, dass die Stundentafeln gültig sind, alle Fächer berücksichtigt werden
und eine umfassende Bildung angestrebt wird.
Wenn Priorisierungen erforderlich sind, erfolgen diese insbesondere unter Beachtung von:
■ Kernfächern und Kernkompetenzen,
■ prüfungsrelevanten Fächern,
■ schullaufbahnrelevanten Fächern.
Weitere Anregungen für die schulinterne Lehr- und Lernplanung sind unter anderem im Heft
49 der ThILLM-Reihe „Impulse“ zu finden.
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=101
-8-2.4 Gestaltung von Übergängen
Übergänge stellen eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten dar. Pandemiebedingt
kann die Heterogenität der Voraussetzungen der Lernenden noch einmal verstärkt worden
sein.
Beim Eintritt in die Schule und beim Übertritt in die weiterführenden Schulen kommen Schü-
lerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen für das Lernen in neuen
Lerngruppen zusammen. Die Lehrkräfte verfügen in der Regel über eher allgemeine Informa-
tionen und müssen sich rasch ein Bild von den einzelnen Lernenden machen, um zielgerich-
tet an deren Lernvoraussetzungen anzuknüpfen, individuelle Förderung und erfolgreiches
Lernen von Anfang an zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit, der Informationsaustausch und
die Kommunikation zwischen den abgebenden und aufnehmenden Institutionen sowie mit
den Eltern sind von hoher Bedeutung 5.
In vielen Grundschulen und auch in weiterführenden Schulen werden zu Beginn des Schul-
jahres Verfahren der pädagogischen Diagnostik zur Ermittlung der Lernvoraussetzungen
bzw. der Lernstände der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bzw. 5 durchgeführt.
Es wird ausdrücklich empfohlen, Lern- und Entwicklungsstände zielgerichtet zu ermitteln.
Das betrifft insbesondere
■ Lernvoraussetzungen im basalen Bereich, zu Vorläuferkompetenzen im sprachlichen
und mathematischen Bereich sowie bezüglich der phonologischen Bewusstheit in
Klassenstufe 1,
■ Lernstandserhebungen in Deutsch und Mathematik in Klassenstufe 5.
Festlegungen zur pädagogischen Diagnostik beim Eintritt in die Schule bzw. beim Übertritt in
die weiterführende Schule sowie daraus resultierende Maßnahmen müssen in der schulinter-
nen Lehr- und Lernplanung verankert sein. Die Feststellungen im Rahmen der pädagogi-
schen Diagnostik dienen der individuellen Förderung und der Unterrichtsgestaltung, nicht der
Leistungsbewertung.
2.5 Stärkung der Sprachbildung als Voraussetzung für den Schulerfolg
Bildungssprachliche Kompetenzen sind Grundvoraussetzung erfolgreichen schulischen Ler-
nens in allen Fächern. Es ist eine Querschnittsaufgabe von Schule, diese Kompetenzen sys-
tematisch zu entwickeln und fachspezifisch auszuprägen.
Bildungs- und fachsprachliche Defizite beeinträchtigen bei mangelnder Intervention Lerner-
folg und Lernmotivation in allen Fächern der Stundentafel. Perspektivisch hat dies Auswir-
kungen auf die gesellschaftliche Teilhabe. Schule muss dem durch ein Bündel von Maßnah-
men zur gezielten Stärkung der bildungssprachlichen Kompetenzen über alle Bildungsetap-
pen hinweg entgegenwirken. 6
1. Sprachliche Bildung muss durchgängiges Unterrichtsprinzip in allen Fächern sein.
Sprachsensibles Unterrichten heißt z. B.
■ Analyse bildungs- und fachsprachlicher Anforderungen, Identifikation sprachli-
cher Hürden und Berücksichtigung bei der Unterrichtsplanung und -durchführung
5 vgl. §2 ThürSchulG
6 Empfehlung „Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache stärken“, Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 5.12.2019
-9-■ Unterstützung beim Erwerb bildungs- und fachsprachlicher Strukturen, z. B. über
sprachliche Gerüste (Scaffolding)
■ Beförderung des sprachlichen Handelns der Schülerinnen und Schüler durch In-
tegration von Schreib- und Sprechanlässen und Leseaktivitäten in allen Fächern
■ bewusste Ausgestaltung der sprachlichen Vorbildfunktion der Lehrerin/des Leh-
rers
2. Die (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung eines Sprachbildungskonzepts ist Bestand-
teil der Schulentwicklung, das heißt z. B.
■ Vereinbarung und Einhaltung fächerübergreifender Festlegungen zur Beförde-
rung fachspezifischer Sprachhandlungen
■ Etablierung von Routinen für die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams
gemeinsam mit Förderpädagoginnen und -pädagogen und den Lehrerinnen und
Lehrern für Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
■ Verankerung unterrichtsintegrierter und flankierender Sprachbildungs- bzw.
Sprachfördermaßnahmen
■ Abstimmung in Hinblick auf die Verwendung der Operatoren
3. Diagnoseverfahren werden als Grundlage einer passgenauen Sprachbildung und
-förderung eingesetzt, das heißt z. B.
■ Durchführung einer lernprozessbegleitenden Diagnostik
■ Ableitung konkreter Maßnahmen aus den Ergebnissen der Diagnostik
Das ThILLM unterstützt Schulen fortlaufend bei der Stärkung der Sprachbildung und der Im-
plementierung eines sprachsensiblen Fachunterrichts. Thüringer Schulen können u. a. auf
Angebote zurückgreifen, die aus der Bund-Länder-Initiative „Bildung durch Sprache und
Schrift (BiSS)“ hervorgegangen sind. Darunter fallen z. B. Fortbildungen/Fortbildungsreihen
■ mit Blended-Learning-Bausteinen, die im Rahmen von BiSS entwickelt wurden,
■ zum Einsatz von Tools zur Diagnostik, Förderung und Professionalisierung,
■ zu Methoden und Strategien für einen sprachsensiblen Fachunterricht und einen
fachsensiblen Sprachunterricht.
- 10 -3 Hinweise zu ausgewählten Schülergruppen
Die pädagogische Diagnostik ist immanenter Bestandteil der Planung, Durchführung und Re-
flexion von Unterricht in allen Fächern. Lernentwicklung und Lernstände müssen besonders
aufmerksam beobachtet werden bei Schülerinnen und Schülern
■ in der Schuleingangsphase,
■ mit Lernschwierigkeiten,
■ mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
■ mit Förderbedarf in Deutsch als Zweitsprache (DaZ),
■ für die Schullaufbahnentscheidungen und Abschlüsse anstehen,
■ welche zeitweise unter eingeschränkten häuslichen Bedingungen lernen (räumliche,
technische und materielle Ausstattung, Unterstützungsmöglichkeiten).
Unterschiedliche Ausgangslagen bedürfen unterschiedlicher Maßnahmen. Hier kommt der
Einbeziehung der Förderschullehrkräfte, der DaZ-Lehrerinnen und Lehrer, der Beratungsleh-
rerinnen und -lehrer, der Schulsozialarbeit, des weiteren unterstützenden Personals sowie
ggf. der Schulpsychologie und Einrichtungen der Jugendhilfe besondere Bedeutung zu.
Im Folgenden werden Hinweise zu einigen Schülergruppen gegeben.
3.1 Lernende in der Schuleingangsphase
Schülerinnen und Schüler, die unter den Bedingungen der Corona-Pandemie eingeschult
werden, erleben den schulischen Lernanfang in besonderer Weise. Der Prozess der Integra-
tion in die schulische Lerngemeinschaft und in schulische Lernprozesse erfolgt unter Um-
ständen über einen begrenzten Zeitraum in einer Präsenzsituation. Der Beziehungsaufbau
zu Lehrerinnen und Lehrern sowie zu Mitschülerinnen und Mitschülern wird dadurch verän-
dert. Engmaschige Beobachtungen und Feststellungen zu Lernvoraussetzungen und Lern-
ständen sowie individuelle Förderung sind im Anfangsunterricht und in dieser Situation be-
sonders wichtig. Das umfasst auch eine enge Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Des-
halb sollten ihre Rückmeldungen in die Beobachtung der (Lern-)Entwicklung zielgerichtet
einbezogen werden.
Damit Schülerinnen und Schüler in der Schuleingangsphase Lerninhalte verstehen, wie zum
Beispiel Schriftsprache oder mathematische Operationen, braucht es eine professionelle di-
daktisch-methodische Aufbereitung komplexer Sachverhalte. Besonders in Phasen des Dis-
tanzlernens ist es möglich, dass der Schwerpunkt eher auf formalen Übungsangeboten liegt
und komplexe Lerninhalte zu wenig verstanden werden. Deshalb muss die Beobachtung der
Lernenden und die Gestaltung der Lernangebote besonders im Hinblick auf Verstehenspro-
zesse erfolgen. Es ist dabei besonders wichtig, dass verschiedene Lernkanäle genutzt und
Lerngegenstände auf allen drei Darstellungsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) erfasst
werden.
3.2 Lernende mit Lernschwierigkeiten
Für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten bzw. besonderen Lernschwierigkeiten
wird im Rahmen der individuellen Förderung von den zuständigen Lehrkräften unter Einbe-
zug des Pädagogenteams die pädagogische Förderung geplant.
- 11 -Auf der Grundlage des erfassten aktuellen Lern- und Entwicklungsstandes erfolgt die Ablei-
tung von Förderzielen und Fördermaßnahmen. Die Zusammenarbeit mit weiteren Bildungs-
und Erziehungspartnern, insbesondere mit den Eltern, sollte dabei gewährleistet werden.
Schritte zur pädagogischen Förderplanung
■ Lernvoraussetzungen feststellen, weitere Informationen sammeln
■ Teamberatung, Klassenkonferenz,
■ Förderplanung vornehmen,
■ Lernfortschritte dokumentieren,
■ Evaluation der Fördermaßnahmen, Fortschreibung der pädagogischen Förderpla-
nung
Die Planung der pädagogischen Förderung erfolgt im professionellen Austausch. Geeignet
sind zum Beispiel Förderkonferenzen als bedarfsgerecht stattfindende Beratungen, in welche
neben den Lehrkräften auch die Schulsozialarbeit einbezogen wird. Der Austausch in multi-
professionellen Teams ermöglicht allen Beteiligten ein hohes Maß an Transparenz.
Bei schwierigen Entwicklungen und Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen bietet
sich weiterhin die kollegiale Fallberatung als professionelle Beratungsmöglichkeit an.
3.3 Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Die spezifischen Umstände der Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter-
scheiden sich je nach Förderschwerpunkt sowie nach ihrer individuellen Lebenssituation er-
heblich. Aufgrund der divergenten Ausgangslagen erfolgt die Unterstützung dieser Schülerin-
nen und Schüler im gemeinsamen Unterricht bzw. in der Förderschule generell unter Berück-
sichtigung der jeweils individuellen Erfordernisse. Grundlage für die Förderung sind das son-
derpädagogische Gutachten, seine aktuelle Fortschreibung und der aktuelle sonderpädago-
gische Förderplan, welcher von der zuständigen Förderschullehrkraft für jede Schülerin bzw.
jeden Schüler individuell erarbeitet wird.
Im Unterricht werden die im sonderpädagogischen Förderplan festgeschriebenen Förder-
maßnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen umgesetzt. Dabei
ist sicherzustellen, dass die Lernenden individualisierten Zugang zu Lerninhalten bekommen
und barrierefreie Angebote (z. B. einfache Sprache, Deutsche Gebärdensprache, Hilfsmittel
für Lernende mit Sinnesbeeinträchtigungen etc.) zur Verfügung stehen.
Die Förderschullehrkräfte im gemeinsamen Unterricht unterstützen hierbei die allgemeinen
Schulen. Fördermaßnahmen und Förderunterricht werden entsprechend der Festlegung der
jeweiligen Schule durchgeführt.
3.4 Lernende mit Förderbedarf in Deutsch als Zweitsprache
Der Erwerb fachlichen Wissens sowie fachlicher und fächerübergreifender Kompetenzen
sind Prozesse, die sprachlich gesteuert werden. Daraus resultiert für Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund und Förderbedarf in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im
Regelunterricht eine doppelte Herausforderung: Sie müssen sich fachliche Inhalte aneignen,
während der Zweitspracherwerbsprozess noch nicht abgeschlossen ist und sie damit auf ein
begrenztes sprachliches Repertoire zurückgreifen können.
Es ist Aufgabe von Schule, den ungesteuerten Zweitspracherwerb im sogenannten „Sprach-
bad“ der deutschsprachigen Umgebung (Alltag, Medien, Kontakt mit Gleichaltrigen, …) durch
eine gezielte DaZ-Förderung zu unterstützen und zu ergänzen.
- 12 -Bei Schülerinnen und Schülern, die sich noch nicht lange in Deutschland aufhalten, steht da-
bei zunächst der Erwerb basaler Kompetenzen in der deutschen Sprache im Vordergrund.
Mit zunehmender alltagssprachlicher Kompetenz der Schülerinnen und Schüler verschiebt
sich der Fokus auf den Erwerb und Ausbau bildungs- und fachsprachlicher Kompetenzen.
Wechsel- und Distanzunterricht im Zuge der Corona-Pandemie haben individuelle Lernrück-
stände bei DaZ-Lernenden verstärkt. Einerseits entfielen die im Präsenzunterricht verfügba-
ren Unterstützungsstrukturen bei der Bewältigung von Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträ-
gen, andererseits konnten bestimmte sprachliche Kompetenzen (z. B. Sprechen und Hörver-
stehen) im Rahmen des DaZ-Unterrichts nicht in dem Umfang ausgeprägt werden, wie dies
in Präsenz möglich ist. Hinzu kam, dass Zeiten des Distanz- und Wechselunterrichts für
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und DaZ-Förderbedarf eine verstärkte
Immersion in der Familiensprache und ein fehlendes deutsches Sprachbad bedeuteten.
Für eine Bewältigung entstandener individueller Lernrückstände ist erforderlich
■ eine lernprozessbegleitende Diagnostik, mittels derer Lernstände erhoben, ge-
zielte Fördermaßnahmen zum Ausgleichen individueller Lernrückstände abgeleitet
und ggf. die Zuordnung zu DaZ-Lerngruppen (Vorkurs, Grundkurs, Aufbaukurs) ange-
passt werden,
■ die interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer
sowie weiterer pädagogischer Professionen, die im fächerübergreifenden Einsatz von
Lernstrategien sowie Lern- und Arbeitstechniken resultieren und das Ineinandergrei-
fen von DaZ-Förderung und Fachunterricht ermöglichen,
■ ein regelmäßiges Feedback, das die konkreten Bedarfe der Schülerinnen und Schü-
ler erhebt sowie Motivation und effektive Förderansätze stärkt,
■ ein sprachsensibler Unterricht (vgl. Punkt 3.5), der Bildungs- und Fachsprache
nicht nur als Medium des Fachunterrichts nutzt, sondern sie auch zum Lerninhalt
macht.
Im Anfangsunterricht DaZ für Schülerinnen und Schülern mit noch sehr geringen Kennt-
nissen der deutschen Sprache ist das Vorhandensein basaler sprachlicher Fähigkeiten ab-
zusichern. Dazu gehören:
Kompetenzbereich Basale sprachliche Fähigkeiten
Hör-/Hör-Sehverstehen ■ Identifizieren/Wahrnehmen von Lauten, Wortbaustei-
nen, Wörtern
■ Verstehen von Sätzen und Texten
Sprechen ■ korrekte Aussprache von Lauten, Wörtern, Sätzen
■ monologisches Sprechen
■ dialogisches Sprechen
Leseverstehen ■ Erlesen und Verstehen von Lauten, Silben, Wörtern,
Sätzen, Texten
■ Verstehen von Aufgabenstellungen
■ Anwenden von Lesestrategien
■ lautes Lesen von Texten
- 13 -Kompetenzbereich Basale sprachliche Fähigkeiten
Schreiben ■ Graphem-/Phonem-Zuordnungen
■ Entwicklung eines leserlichen Schriftbilds
■ flüssiges Schreiben
■ Verfassen kurzer Texte
■ Anwenden von Schreibstrategien
■ Einsatz von Rechtschreibstrategien
Über Sprache, Sprachenler- ■ Strategien zur Erweiterung und Festigung des Wort-
nen und Sprachverwendung schatzes
reflektieren ■ Reflexion eigener Sprachlernstrategien und des eige-
nen Lernprozesses
Bei fortgeschrittenen DaZ-Lernenden müssen fachspezifisch und fächerübergreifend er-
forderliche Sprachhandlungen und Lernstrategien im Vordergrund stehen. Im Unterricht spie-
len Diskursfunktionen wie zum Beispiel das Aushandeln von Bedeutungen und Prozessen,
das Benennen, Beschreiben und Darstellen von Sachverhalten, das Berichten, Erläutern, Ar-
gumentieren und Bewerten eine zentrale Rolle. Fortgeschrittene DaZ-Lernende benötigen
systematische Unterstützung bei der Aneignung dieser Diskursfunktionen, die den Erwerb
und Ausbau fachlicher Kompetenzen ermöglichen. Darüber hinaus ist ggf. Unterstützung
beim Erwerb fachlicher und überfachlicher Strategien und Methoden angezeigt.
Sofern Förderangebote außerhalb des Regelunterrichts unterbreitet werden, ist es wichtig,
dass diese Angebote in engem Bezug zueinander stehen.
- 14 -4 Hinweise zur Unterrichtsgestaltung
Die Pandemie und die daraus resultierende Notwendigkeit, Lernen auch außerhalb des ge-
wohnten Lernorts „Schule“ zu organisieren, haben das Verständnis von „Unterricht“ verän-
dert: Lehren und Lernen finden häufiger orts- und zeitunabhängig statt, die Arbeit mit digita-
len Medien und Lernplattformen gehört zum Schulalltag.
Individuelle Voraussetzungen der Lernenden, sprachliche und mathematische Kompetenzen
und das selbstorganisierte Lernen rücken stärker in den Fokus der Lehr- und Lernplanung.
Nach den Erfahrungen des Lernens in Distanz müssen im Unterricht in besonderem Maß
Beziehungen gestärkt und für die Lernenden Partizipation bei der Gestaltung ihrer Lernpro-
zesse ermöglicht werden.
Für die Entwicklung aller fachlichen und überfachlichen Kompetenzbereiche nehmen schü-
lerorientierte und lebensnahe Bildungsangebote eine Schlüsselfunktion ein. Dabei verdienen
in einer von Digitalität geprägten Gesellschaft vor allem folgende Kernkompetenzen beson-
dere Beachtung, die Lernende im 21. Jahrhundert brauchen:
■ gelingend kommunizieren können,
■ kreative Lösungen finden können,
■ kompetent handeln können,
■ kritisch denken können sowie
■ zusammenarbeiten können 7.
Die folgenden Hinweise für die Gestaltung des Lehrens und Lernens nach der Pandemie
greifen auf bewährte Merkmale guten, lernförderlichen Unterrichts zurück, die besonders auf
den Umgang mit unterschiedlichen Lernständen und den Erwerb von Kompetenzen gerichtet
sind. Dabei kommen der Diagnostik und der individuellen Förderung zentrale Bedeutung zu.
Unterricht, der heterogene Lernstände angemessen berücksichtigt, muss deshalb vor allem:
■ auf die Gestaltung einer lernförderlichen Lehrer-Schüler-Beziehung ausgerichtet sein,
■ sinnstiftende, von Wertschätzung und Ermutigung geprägte Kommunikation anregen,
■ entdeckendes und selbstorganisiertes Lernen initiieren,
■ Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen,
■ Anleitung und Übung durch didaktisch angemessen aufbereitete Lernschritte anbie-
ten,
■ kognitiv herausfordernde Aufgaben zur Verfügung stellen, die nachhaltige Verste-
hensprozesse ermöglichen,
■ Qualitätsstandards hinsichtlich der Aufgabenstellungen gerecht werden,
■ individuelles und gemeinsames Lernen durch den Einsatz verschiedener Sozial- und
Arbeitsformen und digitaler Medien ermöglichen,
■ verschiedene Formen didaktischer und organisatorischer Differenzierung anbieten,
■ unterschiedliche Lernkanäle und Darstellungsebenen nutzen,
■ Beobachtungen und Feststellungen zur Kompetenzentwicklung und zu individuellen
Lernständen ermöglichen,
■ Raum für individuelle, diagnostisch-kommunikative Rückmeldungen und die Weiter-
entwicklung einer wechselseitigen Feedbackkultur bieten,
7 Kultusministerkonferenz: Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Ergänzung zur Strategie der Kultusmi-
nisterkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“, Berlin, 2021, S. 8, [online]; https://www.kmk.org/filead-
min/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf [Zugriff am
21.01.2022 um 06:50 Uhr]
- 15 -■ unterschiedliche Formen von Leistungsnachweisen und der Kompetenzfeststellung
ermöglichen,
■ die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien systematisch weiterentwickeln so-
wie
■ die bildungs- und fachsprachliche Entwicklung in allen Fächern fördern.
In den Zeiten des Distanzunterrichts wurden an jeder Schule neue Formen des Lehrens und
Lernens erprobt. Diese Erfahrungen sollten im Kollegium reflektiert werden, um Prozesse der
Unterrichtsentwicklung in professionellen Lerngemeinschaften anzustoßen und dabei in der
Schulgemeinschaft zusammenzuwirken.
Lernförderlicher Unterricht kann auch nach den Erfahrungen der Pandemie nur auf der
Grundlage einer demokratischen Schulkultur gelingen, in der Partizipation gelebt wird und
Regeln sowie Rituale für Orientierung, Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheit sorgen. Jede
Schule verfügt dazu über Routinen und Konzepte, welche an die geänderten Bedingungen
angepasst und weiterentwickelt werden müssen.
Die folgende Literatur- und Linksammlung führt zu praxiserprobten Materialien des ThILLM
für die Gestaltung eines lernförderlichen Unterrichts, der besonders auf den Umgang mit He-
terogenität gerichtet ist.
■ Fächerübergreifende Hinweise, um Aufgaben (mit Hilfe digitaler Medien) im Niveau
zu differenzieren:
https://bit.ly/3ypZfpS
■ Tipps zur professionellen Beziehungsgestaltung im Kontext von Distanz und Digitali-
sierung
https://bit.ly/3F4w9i5
■ Tipps zur Unterrichtsgestaltung im Kontext von Distanz, Digitalisierung und Heteroge-
nität:
https://bit.ly/3F6Y2q3
■ „Lass es mich selbst tun“ – Materialien zur Entwicklung von Lernkompetenz (Opera-
toren, Methoden, Kooperative Lernformen, Kompetenzraster):
https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=1011
■ „Gehirngerechtes Klassenzimmer“ – Materialien für die Unterrichtsplanung, die For-
mulierung von differenzierenden Aufgabenstellungen, die Reflexion und die Leis-
tungseinschätzung:
https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=2035
■ „Unterricht entwickeln: Effektives Lernen – Kooperatives Lernen – Aktives Lernen“ mit
Hilfestellungen für die Differenzierung:
https://bit.ly/3IU86Vo
■ Das ThILLM stellt weiterhin Informationen und Materialien zur Unterrichtsentwicklung
durch Beziehungsgestaltung und ein Konzept zur Unterstützung bei der Entwicklung
und dem fortwährenden Ausbau eines lernförderlichen Unterrichts für Schulen aller
Schularten bereit.
https://www.schulportal-thueringen.de/home/unterrichtsentwicklung
- 16 -5 Weitere unterstützende Maßnahmen
5.1 Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote des Schulpsychologischen Diens-
tes (für Schulen, Eltern und Lernende)
Der Schulpsychologische Dienst steht für alle Ratsuchenden im Schulbereich beratend und
unterstützend zur Verfügung. Gerade auch bei Fragen und Problemen aufgrund der beson-
deren Herausforderungen bei heterogenen Lernständen (z. B. infolge von längeren Phasen
des Distanzunterrichts), können sich Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler so-
wie Eltern an die Referentinnen und Referenten für Schulpsychologie in den jeweiligen
Staatlichen Schulämtern wenden. Die aktuellen Kontaktdaten sind unter www.schulpsycho-
logie.schulaemter.de für das jeweilige Schulamt bzw. die jeweilige Gebietskörperschaft
hinterlegt.
Es können beispielsweise Fragen zu Themen wie Lernmotivation, Lernstruktur, Umgang mit
den Lern- und Leistungsanforderungen, Vermeidung von und Umgang mit Konflikten rund
um Schule sowie Ängste und psychische Probleme bearbeitet werden. Auch zum professio-
nellen pädagogisch-psychologischen Umgang mit den besonderen Belastungen bei hetero-
genen Lernständen kann der Schulpsychologische Dienst beratend einbezogen werden.
Der Schulpsychologische Dienst arbeitet systemisch, klientenzentriert und lösungsorientiert
an individuellen Lösungswegen. Darüber hinaus sind die Beratungslehrkräfte gut geschult,
um bereits vor Ort in den Schulen Beratungsgespräche zu führen. Bei Bedarf kann auch an
die Jugendhilfe bzw. das Gesundheitssystem vermittelt und/oder die Schulsozialarbeit einge-
bunden werden.
Angebote und Unterstützungsleistungen des Schulpsychologischen Dienstes sind auch in
das Landesaktionsprogramm „Stärken-Unterstützen-Aufholen“ eingebettet.
Schulpsychologischer Dienst | Stärken - Unterstützen - Abholen (thueringen.de)
5.2 Landesaktionsprogramm "Stärken - Unterstützen - Abholen" für Kinder und Ju-
gendliche nach Corona
Bund und Länder haben das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Ju-
gendliche“ beschlossen, um Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bildungsbiografie
von Schülerinnen und Schülern aufzufangen, heterogene Lern- und Entwicklungsstände an-
bzw. auszugleichen und damit einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu leisten.
Die Umsetzung des Bund-Länder-Programms erfolgt in Thüringen unter dem Titel
Landesaktionsprogramm "Stärken - Unterstützen - Abholen" für Kinder und Jugendli-
che nach Corona.
Der Freistaat Thüringen geht dafür unter anderem Kooperationen mit verschiedenen Bil-
dungspartnern ein, die mit ihren Angeboten den Aus- und Aufbau von Kompetenzen in den
Bereichen sozio-emotionale, körperlich-motorische und kognitive Entwicklung unterstützen.
Im Folgenden werden mögliche Maßnahmen in den genannten Bereichen aufgezeigt.
- 17 -Sozio-emotionale Entwicklung
■ Angebot von Ergänzungsstunden bzw. flexiblen Stunden bevorzugt mit der Klassen-
leiterin/dem Klassenleiter, bis vier Stunden pro Klasse und Monat für alle Klassenstu-
fen
■ Unterstützungsangebote u. a. von den an den staatlichen Schulämtern verorteten
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für alle Klassenstufen
■ Aufenthalte in Thüringer Schullandheimen, Thüringer Jugendbildungseinrichtungen
bzw. Thüringer Jugendwaldheimen für ausgewählte Schulen, Klassenstufen und
Klassen mit besonders langem Ausschluss vom Präsenzunterricht
Körperlich-motorische Entwicklung
■ bewegungsförderliche Angebote für alle Klassenstufen
■ schulische bzw. außerschulische Nachholangebote für das Schwimmen
■ Angebote zum Nachholen der Fahrradausbildung in den Klassenstufen 5 und 6
Kognitive Entwicklung
■ gezielt von der Schule koordinierte Unterstützungsangebote zur Stärkung der Kern-
kompetenzen, insbesondere im sprachlichen Bereich, auf der Grundlage der Ergeb-
nisse von Lernstandsanalysen
Informationen zu Maßnahmen in den aufgeführten Bereichen werden durch das TMBJS für
die Schulen bereitgestellt.
https://bildung.thueringen.de/schule/staerken-unterstuetzen-abholen
Verteilung, Verwendung und Berichtspflicht der im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufho-
len nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für Thüringen zur Verfügung stehenden finanzi-
ellen Mittel sind in der Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Aktionsprogramms des
Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022 ge-
regelt.
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/aufholen/VV_Aufho-
len_nach_Corona.pdf
5.3 Fortbildungs- und Beratungsangebote für Pädagoginnen und Pädagogen
Für die Fortbildung und Beratung der Pädagoginnen und Pädagogen stehen u. a. folgende
Angebote zur Verfügung:
■ zentrale Angebote des ThILLM,
■ Telefon- und Videosprechstunden des ThILLM,
■ Angebote der Fachberaterinnen und Fachberater,
■ Begleitung durch die Schulentwicklungsberaterinnen bzw. -berater,
■ Beratung durch die Schulpsychologinnen und -psychologen der Staatlichen Schuläm-
ter,
■ weitere Unterstützungsangebote der Staatlichen Schulämter,
■ Bereitstellung von Instrumenten und Materialien für die pädagogische Diagnostik und
individuelle Förderung sowie für die Unterrichtsentwicklung.
Die Fortbildungs- und Beratungsangebote des ThILLM sind in den Übersichten unter den
Punkten 8 und 9 zusammengestellt.
- 18 -5.4 Maßnahmen zur Unterstützung von Schülergruppen und einzelnen Lernenden
Schülergruppen und einzelne Lernende können durch angepasste Rahmenbedingungen und
zusätzliche Angebote unterstützt werden. Auf der Grundlage der jeweils gültigen rechtlichen
Vorgaben und Regelungen bestehen grundsätzlich z. B. folgende Möglichkeiten:
■ Bereitstellung von Medien, Materialien und Technik für den Distanzunterricht durch
die Schule, ggf. im Zusammenwirken mit dem Schulträger,
■ Einbeziehung der Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, der Schulsozialarbeit,
der Jugendhilfe und des Schulpsychologischen Dienstes zur Unterstützung von Ler-
nenden und Familien in schwieriger Lage,
■ Einbeziehung der Erzieherinnen und Erzieher des Schulhortes,
■ Zusammenwirken der Schule mit regionalen außerschulischen Partnern bei der Be-
reitstellung von Lernräumen und Fördermöglichkeiten,
■ Zusammenarbeit mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungspartnern im Rah-
men des Ganztags,
■ Einbezug von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
tern in schulische Unterstützungsangebote,
■ besondere Präsenzmöglichkeiten für ausgewählte Schülergruppen,
■ bildungsunterstützende Angebote während der Ferien.
Bildungsunterstützende Ferienkurse sind Angebote, die Schulen eigenverantwortlich in den
Schulferien für Schülerinnen und Schüler anbieten. Eine Beschränkung auf bestimmte Feri-
enzeiten besteht dafür nicht.
Die Ferienkurse sind unabhängig von Fächern und Klassenstufen möglichst projektorientiert
auf die Bedarfe und Interessen der Schülerinnen und Schüler bezogen ausgestaltet. Grund-
lage für die Angebote ist der TBP-18. Die Ferienangebote sollen sich inhaltlich an den dort
beschriebenen Bildungsbereichen orientieren.
Die Schulen entscheiden entsprechend des Bedarfs über den Umfang, die inhaltliche Ausge-
staltung und den zeitlichen Rahmen der Ferienkurse. Sie richten sich an alle Schülerinnen
und Schüler der jeweiligen Schule, wobei gezielt Schülerinnen und Schüler mit besonderem
Unterstützungsbedarf angesprochen werden sollen. Die Teilnahme ist freiwillig.
Die Ferienkurse werden von den Pädagoginnen und Pädagogen der Schule, in Partnerschaft
mit weiteren Personengruppen, z. B. Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern, Lehramtsstu-
dierenden, oder bewährten Kooperationspartnern der Schule durchgeführt.
Um entsprechende Kontakte zwischen Schule und Anbietern vermitteln zu können, wird auf
der Internetseite des für Bildung zuständigen Ministeriums eine Plattform geschaltet, auf der
Schulen ihre Bedarfe beschreiben und Kursleiterinnen und -leiter Angebote veröffentlichen
können.
Für anfallende Honorare steht den Schulen das Schulbudget zur Verfügung.
Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landesaktionsprogramms „Stärken – Unter-
stützen – Abholen“ für Kinder und Jugendliche nach Corona (s. Abschn. 6.1) können eben-
falls als Ferienkurse angeboten werden.
Zum Umgang mit der pandemiebedingten Situation und zur Abmilderung der Folgen der
Corona-Pandemie ergreift das zuständige Ministerium weitere Maßnahmen und trifft Reglun-
gen, die fortlaufend geprüft und aktualisiert werden. Das betrifft z. B.
■ die Organisation des Unterrichts und der Notbetreuung,
- 19 -■ die aktuelle Planung der Abschlussprüfungen im Schuljahr 2021/2022 sowie
■ weitere, pandemiebedingt vorgesehen Erleichterungen.
Die Schulen erhalten die aktuellen Informationen in der Regel über das Mitteilungsmodul und
die Internetseiten des TMBJS.
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus
- 20 -6 Weiterführende Links
Die aufgeführten Verlinkungen und Materialien stellen eine exemplarische Auswahl dar und
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Rechtsgrundlagen, Empfehlungen und Handreichungen in Thüringen
Veröffentlichungen des TMBJS zur Corona-Pandemie
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus
Distanzunterricht
https://bildung.thueringen.de/bildung/haeusliches-lernen
https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer_schulcloud/online_ler-
nen/materialien_haeusliches_lernen
16 Tipps zur professionellen Beziehungsgestaltung
https://www.schulportal-thueringen.de/get-data/1dd9b5b6-14d8-44a0-ab77-
084ff3133262/16_Tipps_zum_Distanzunterricht_2021_01_31.pdf
Vortrag „Gestaltung von Beziehungen beim Lernen auf Distanz“ (Dr. A. Jantowski)
https://www.schulportal-thueringen.de/tip/resources/medien/50689?datei-
name=Gestalten+von+Beziehungen+beim+Lernen+auf+Distanz+-+Dr+Jan-
towski.mp4
Förderschwerpunkt Lernen
Handreichung zur Binnendifferenzierung unter besonderer Berücksichtigung des För-
derschwerpunkts Lernen
https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=6837
Individuelle Lernstandsanalyse
digitales Diagnosetool ILeA plus als Instrument der individuellen Lernstandsanalyse
für die Primarstufe und die Klassenstufen 6 und 7 für die Fächer Deutsch und Mathe-
matik.
https://www.schulportal-thueringen.de/ileaplus/unterstuetzungsmaterial
Kompetenztests
Informationen zu den Kompetenztests in Thüringen
https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer-kompetenztests
Informationen zu den Vergleichsarbeiten VERA-3 und VERA-8
https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/
Testhefte Kompetenztests Mathematik der letzten Jahre
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=930
- 21 -Landesaktionsprogramm „Stärken-Unterstützen-Abholen“ für Kinder und Jugendliche
nach Corona
Landesaktionsprogramm "Stärken - Unterstützen - Abholen"
https://staerken-unterstuetzen-abholen.thueringen.de/
Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung Aktionsprogramm des Bundes "Auf-
holen nach Corona"
https://staerken-unterstuetzen-abholen.thueringen.de/fileadmin/schule/aufho-
len/VV_Aufholen_nach_Corona.pdf
Mathematik
Schülerselbsteinschätzung Mathematik
www.foerdern-individuell.de/index.php?Seite=7503&PHP-
SESSID=a87gi7hpetk3cp17jdofa7afm3
Material zur Diagnose und Förderung im Mathematikunterricht
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/faecher/mathematik-na-
turwissenschaften/mathematik/unterrichtsmaterialien-und-fachthemen/1-mate-
rialien-zu-den-themen-des-rlp-1-10/sekundarstufe-i/materialien-zur-diagnose-
und-foerderung-im-mathematikunterricht
Material zum Problemlösen und zur Diagnose im Primarbereich
https://kira.dzlm.de/
Diagnose- und Fördermaterial für die Primarstufe Mathematik (frei zugänglich)
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/node/479
https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/material/inhalte-der-diagnose-und-
f%C3%B6rderbausteine
DZLM-Handreichung Rechenschwierigkeiten vermeiden/ Sprachbildung im Mathema-
tikunterricht (frei zugänglich)
https://pikas.dzlm.de/
Diagnose und Förderung: Leitfaden für die 1. und die 2. Klasse
www.matheinklusiv.de/diagnose-und-f%C3%B6rderung-1/
Adaptives Lernsystem für den Mathematikunterricht in den Klassenstufen 4 bis 11 mit
Übungen und Tests (kostenpflichtig)
https://de.bettermarks.com/
Migration und Integration
Hinweise zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
in häuslichem Lernen und Präsenzunterricht
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/migration/2020-04-30_Hin-
weise_Schueler_Migrationshintergrund_haeusliches_Lernen_Praesenzunter-
richt.pdf
2P | Potenzial & Perspektive - Analyseverfahren für neu Zugewanderte
https://plattform.2pthueringen.de/site/login
- 22 -Sie können auch lesen