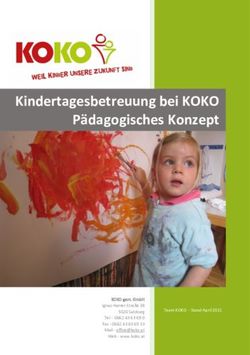Ausgewählte Ergebnisse aus dem Forschungsprogramm für Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer - Institut für Erziehungswissenschaft
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Highlights Ausgewählte Ergebnisse aus dem Forschungsprogramm für Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer 05/2017 Max-Plack-Institut für Bildungsforschung Berlin Universität Freiburg Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Universität Potsdam
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege
Vor fast 10 Jahren haben Sie an der COACTIV- Prof. Dr. Uta Klusmann
Referendariatsstudie (COACTIV-R) teilgenom- Leibniz-Institut für die Pädagogik der
Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel
men.
Olshausenstraße 62,
Wir Wissenschaftler(innen) sind Ihnen außer- 24118 Kiel
Telefon: 0431 – 880 3090
ordentlich dankbar, dass dank Ihrer Unterstüt- Mail: klusmann@ipn.uni-kiel.de
zung diese einmalige Studie entstanden ist,
und wir eine große Anzahl von Lehramtskandi- Prof. Dr. Mareike Kunter
dat(inn)en so umfassend untersuchen durften. Goethe Universität Frankfurt am Main
Die Ergebnisse der Studie sind nicht nur wis- Theodor-W.-Adorno-Platz 6
60629 Frankfurt am Main
senschaftlich hoch bedeutsam und im Fachkol- Telefon: 069 – 798 35369
legium auf großes Interesse gestoßen, sondern Mail: kunter@paed.psych.uni-frankfurt.de
haben auch in den Debatten der Bildungsad-
ministration und Bildungspolitik maßgebliche Prof. Dr. Dirk Richter
Impulse gesetzt. Universität Potsdam
Karl-Liebknecht-Straße 24–25
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen ei- 14476 Potsdam
Telefon: 0331 – 977 2133
nen Überblick geben, was seit den Erhebungen
Mail: dirk.richter@uni-potsdam.de
passiert ist und Ihnen zentrale Forschungser-
gebnisse vorstellen. Prof. Dr. Thamar Voss
Universität Freiburg
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Rempartstraße 11
Lektüre der Broschüre! 79098 Freiburg
Telefon: 0761 – 203 96886
Die Abteilung am Berliner Max-Planck-Institut für Bil- Mail: thamar.voss@ezw.uni-freiburg.de
dungsforschung, die das COACTIV-Forschungsprogramm
geleitet hat, besteht in dieser Form seit der Emeritierung
von Herrn Prof. Baumert nicht mehr.
Die beteiligten Personen sind mittlerweile an ganz unter-
schiedlichen Standorten und haben ein COACTIV-Netz-
werk empirischer Forscher(innen) gebildet, das immer
noch aktiv ist und den Datensatz nach wie vor aktiv ver-
wendet und pflegt.
2Inhalt
Das COACTIV-Forschungsprogramm 4
Wie ist es aufgebaut und was ist seine Bedeutung? 4
Professionelle Kompetenz 5
Die gute Lehrkraft – Was bedeutet professionelle Kompetenz? 5
Zentrale Wissenschaftliche Befunde 7
Welche Rolle spielt die professionelle Kompetenz
für den Unterricht? 7
Der Kern professioneller Kompetenz: Wissen und Können 7
Begeistert und distanzierungsfähig: Auf die richtige Balance kommt es an 9
Wie entwickelt sich professionelle Kompetenz? 10
Entwicklung professionellen Wissens 10
Entwicklung anderer Aspekte professioneller Kompetenz 11
Der berufliche Alltag im Vorbereitungsdienst:
Welche Tätigkeiten werden besonders häufig als stressrelevant erlebt? 12
Wie geht es weiter? 14
Die nächsten Schritte 14
3Das COACTIV-Forschungsprogramm
Wie ist es aufgebaut
und was ist seine Bedeutung?
Über kaum einen Berufsstand wird öffentlich so viel Erste Hauptstudie
diskutiert wie über den Lehrerberuf. Beinahe täglich Die erste Hauptstudie des Programms war ein-
tauchen in den Medien neue Meldungen zur Kom- gebettet in die nationale Erweiterungsstudie zu
petenz und psychischen Verfassung von Lehrkräf- PISA 2003. In dieser Studie wurden bei einer
ten auf. So ist zu lesen, sie seien nicht ausreichend Stichprobe von über 300 Mathematiklehrkräften
vorbereitet, seien schon im Lehramtsstudium und fachliche sowie motivational-emotionale Aspekte
Vorbereitungsdienst überfordert, litten – einmal in professioneller Kompetenz erstmals direkt mittels
den Beruf eingemündet – frühzeitig an Burnout. Es Test-und Fragebogenverfahren gemessen. Auf-
existieren viele Meinungen und Mythen rund um grund der Ankopplung an die PISA-Studie konn-
den Lehrerberuf, die eine wissenschaftliche Syste- ten Angaben der Lehrkräfte, Schulleiter(innen),
matisierung der Frage nach der Bedeutung der pro- Eltern und Schüler(innen) genutzt werden, um
fessionellen Kompetenz von Lehrkräften und den den Zusammenhang zwischen der professionellen
personenseitigen sowie systembedingten Voraus- Kompetenz der Lehrkräfte, der Unterrichtsquali-
setzungen zu deren Erwerb unerlässlich machen. tät und der Leistung und Motivation der Schü-
ler(innen) zu untersuchen.
Im Rahmen des Forschungsprogramms COACTIV
(Cognitive activation in the mathematics class-
w
room and professional competence of teachers)
wurde am Beispiel des Fachs Mathematik die pro-
fessionelle Kompetenz von Lehrkräften untersucht. Zweite Hauptstudie
Dieses Forschungsprogramm hat die Forschung
zur professionellen Kompetenz von Lehrkräften In der COACTIV-Referendariatsstudie (COACTIV-R)
und die Lehrerbildungsforschung (insbesondere im wurde die professionelle Entwicklung von Lehr-
deutschsprachigen Raum) maßgeblich geprägt. Es amtskandidat(inn)en während des Vorbereitungs-
gibt kaum einen aktuellen Artikel oder Konferenz- dienstes untersucht und der Frage nachgegangen,
beitrag zur professionellen Kompetenz von Lehr- welche individuellen und institutionellen Fakto-
kräften im wissenschaftlichen Kontext, der sich ren diese Entwicklung beeinflussen.
nicht auf das COACTIV-Programm beruft. Auch in
bildungspolitischen Debatten werden immer wie- Diese zweite Hauptstudie haben Sie
der Befunde aus dem Projekt zitiert. Impulse zu durch Ihre Teilnahme unterstützt
Veränderungen der Lehreraus- und -weiterbildung
berücksichtigen ebenfalls sehr häufig Befunde aus und so dazu beigetragen, dass der Blick von der Be-
diesem Projekt, und Jürgen Baumert oder Marei- deutung professioneller Kompetenz auf die wich-
ke Kunter, die „Köpfe“ des Forschungsprogramms, tige Frage nach der Entwicklung und Förderung
sind unverzichtbare Mitglieder in Expertenkommis- derselben erweitert werden konnte. Untersucht
sionen in diesem Bereich. wurden rund 800 Lehramtskandidat(inn)en der
Mathematik zweimal im Verlaufe des Vorberei-
tungsdienstes. Durch die Anlage als Zwei-Kohor-
Das COACTIV-Forschungsprogramm ten Messwiederholungsstudie (siehe Abbildung)
gilt daher als Paradebeispiel für konnte der gesamte (in den meisten Bundeslän-
gelungene nutzenorientierte dern noch zweijährige) Vorbereitungsdienst ab-
Grundlagenforschung: gedeckt werden. Eine Teilstichprobe nahm 2010
zusätzlich an einer Follow-up Erhebung teil. Er-
Auf höchstem wissenschaftlichen Niveau wurden gänzend gab es Zusatzstudien zu ausgewählten
nicht nur Forschungserkenntnisse gewonnen, son- Fragestellungen (z.B. eine Tagebuchstudie, eine
dern ebenso relevante Erkenntnisse für die Praxis Studie zu Entwicklungsverläufen mit zusätzlichen
generiert. Das Forschungsprogramm umfasste zwei Messzeitpunkten während des Vorbereitungs-
Hauptstudien mit zahlreichen Zusatzstudien. dienstes, eine Studie zur Unterrichtseinschätzung
oder eine Studie zur Ausbildungslehrkraft).
4Das COACTIV-Buch
Im Jahr 2011 wurden zentrale Ergebnisse des
COACTIV-Forschungsprogramms national und in-
ternational in einem Herausgeberwerk publiziert.
Mareike Kunter, Jürgen Baumert, Werner Blum, Uta Klusmann,
Stefan Krauss, Michael Neubrand (Hrsg.) (2011). Professionel-
le Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungspro-
gramms COACTIV. Münster: Waxmann
Professionelle Kompetenz
Die gute Lehrkraft: Überzeugungen, motivationale Orientierungen
Was bedeutet professionelle Kompetenz? und die Selbstregulation der Lehrkräfte (Baumert &
Kunter, 2006; 2011).
Als Kern professioneller Kompetenz gilt das Wissen
Im wissenschaftlichen Diskurs beschreibt professi- und Können in den Bereichen Fachwissen (tiefes
onelle Kompetenz die persönlichen Voraussetzun- mathematisches Verständnis des zu unterrichten-
gen für die erfolgreiche Bewältigung spezifischer den Schulstoffs), fachdidaktisches Wissen (Wis-
beruflicher Anforderungen, die prinzipiell erlern- sen über die Vermittlung der fachlichen Inhalte)
und vermittelbar sind (vgl. Kunter, 2011). und pädagogisches- psychologisches Wissen
(fachübergreifendes Wissen über Lehr- und Lern-
prozesse). Neben dem Wissen spielen Überzeu-
Die erfolgreiche Bewältigung der an die Lehrkraft
gungen einer Lehrkraft beispielsweise über an-
gestellten Anforderungen im unterrichtlichen und
gemessene Methoden des Lehrens eine wichtige
außerunterrichtlichen Handeln verlangt ein hohes
Rolle. Für die tatsächliche Umsetzung des Wissens
Maß an professioneller Kompetenz.
und Könnens im Unterricht sind zudem motivatio-
Ein theoretisches Modell zur professionellen Kom- nale Orientierungen (z.B. die Freude am Fach und
petenz von Lehrkräften wurde von der COAC- der Vermittlung von Inhalten) und die Selbstre-
TIV-Arbeitsgruppe um Jürgen Baumert am Berliner gulation wichtige Bestandteile der professionellen
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung vorge- Kompetenz. Letztere wird als Fähigkeit verstanden,
legt und ist schematisch in der Abbildung darge- ausgewogen mit den eigenen Ressourcen umzuge-
stellt. Zentrale Aspekte professioneller Kompetenz hen, d.h. das richtige Maß zwischen Engagement
sind nach diesem Modell das Professionswissen, und Distanz zu beruflichen Belangen zu finden.
5Ein hohes Maß an professioneller Kompetenz sollte
Lehrkräften eine qualitätsvolle Unterrichtsgestal-
tung, engagiertes Handeln im Kollegium und gute
Kontakte zur Elternschaft ermöglichen. Diese soll-
te auch einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg
und die Motivation der Schüler(innen) haben.
Motivationale
Orientierungen
Aspekte professioneller Kompetenz
Überzeugungen/
Werthaltungen/ Selbstregulation
Ziele
Professions-
wissen
Fach- Pädagogisch-
psychologisches Organisations- Beratungs-
Kompetenzbereiche Fachwissen didaktisches
Wissen wissen wissen
Wissen
Wissen
Tiefes über das Wissen
Kompetenzfacetten Wissen Wissen über
Verständnis mathe- über Wissen um
Erklärungs- über effektive
der matische mathe- Leistungs-
wissen Lernprozesse Klassen-
Schul- Denken matische beurteilung führung
mathematik von Schüler Aufgaben
(-innen)
Zentrale Publikationen zur Konzeptualisie- Kunter, M., Klusmann, U., & Baumert, J. (2009). Pro-
rung professioneller Kompetenz: fessionelle Kompetenz von Mathematiklehrkräften:
Das COACTIV-Modell. In O. Zlatkin-Troitschans-
Baumert, J., & Kunter, M. (2006). Stichwort: Profes- kaia, K. Beck, D. Sembill, R. Nickolaus, & R. Mulder
sionelle Kompetenz von Lehrkräften. Zeitschrift für (Eds.), Lehrprofessionalität. Bedingungen, Genese,
Erziehungswissenschaft, 9(4), 469–520. Wirkungen und ihre Messung (pp. 153–166). Wein-
heim: Beltz.
Baumert, J., & Kunter, M. (2011). Das Kompetenz-
modell von COACTIV. In M. Kunter, J. Baumert, Kunter, M. (2014). Forschung zur Lehrermotivati-
W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss, & M. Neubrand on. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland
(Eds.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. (Eds.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf (pp.
Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV 698-711). Münster: Waxmann.
(pp. 29–53). Münster: Waxmann. Voss, T., Kunina-Habenicht, O., Hoehne, V., & Kunter,
Klusmann, U. (2011). Allgemeine berufliche Motivati- M. (2015). Stichwort Pädagogisches Wissen von
on und Selbstregulation. In M. Kunter, J. Baumert, Lehrkräften: Empirische Zugänge und Befunde. Zeit-
W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand schrift für Erziehungswissenschaft, 18(2), 187–223.
(Hrsg.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräften:
Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV (S.
277-294). Münster: Waxmann.
6Beispielaufgabe zum fachdidaktischen Wissen
Zentrale Wissenschaftliche „Parallelogramm“
Befunde
Die Fläche eines Parallelogramms lässt
sich berechnen aus Länge der Grund-
In dem COACTIV-Forschungsprogramm wurde linie mal Länge der Höhe.
erstmals in Deutschland ein empirischer Zugang
zur Erfassung der professionellen Kompetenz von
Mathematiklehrkräften realisiert. Es wurden Tes-
tinstrumente zur Messung des Fachwissens, fach-
didaktischen Wissens und pädagogischen-psy-
chologischen Wissens in einem aufwendigen
Entwicklungsprozess von einem Team aus Psycho- Höhe
log(inn)en, Pädagog(inne)en, und Mathematik-
didaktiker(inne)n in engem Austausch mit Prakti-
ker(inne)n konstruiert. Zudem wurden zahlreiche
psychologische Fragebögen eingesetzt und zum
Teil neu entwickelt. Auf Basis dieser Instrumen-
te wurden die professionelle Kompetenz, das un- Grundlinie
terrichtliche Handeln und der Berufserfolg sowie
mögliche Ursachen für den Erwerb professioneller
Kompetenz untersucht. In Hinblick auf die Bedin- Geben Sie bitte ein Beispiel eines Parallelo-
gungen für den Erwerb der professionellen Kom- gramms (anhand einer Skizze), an dem Schüler
petenz konzentrierten sich die Forscher(innen) auf bei dem Versuch, diese Formel anzuwenden,
eventuell scheitern könnten.
die wichtige Phase des
Vorbereitungsdienstes,
Auch das pädagogische-psychologische Wissen
erwies sich als bedeutsam: Anhand der Daten
welcher verschiedene zentrale Lerngelegenheiten
der 2. COACTIV-Hauptstudie (COACTIV-R) fan-
bietet.
den die Forscher(innen) erste Hinweise darauf,
dass pädagogisches-psychologisches Wissen
angehender Lehrkräfte mit der späteren Unter-
richtsqualität in Zusammenhang stand (siehe
Welche Rolle spielt die „Unter der Lupe“).
professionelle Kompetenz
für den Unterricht?
Beispielaufgabe zur Erfassung des
Der Kern professioneller Kompetenz: pädagogischen-psychologischen Wissens:
Wissen und Können
Gefühle der Hilflosigkeit treten besonders dann
Die Ergebnisse der 1. COACTIV-Hauptstudie zeig- auf, wenn ein Misserfolg…
ten, dass das fachdidaktische Wissen von Lehrkräf- (A) auf internale, stabile Ursachen, wie z.B.
ten zur Vorhersage des Unterrichtserfolgs beitrug. mangelnde Intelligenz, zurückgeführt wird.
Lehrkräfte, die über ein höheres Maß an Wissen
über die Vermittlung mathematischer Inhalte ver- (B) auf internale, veränderbare Ursachen,
fügten, gestalteten ihren Unterricht kognitiv ge- wie z.B. geringen Fleiß, zurückgeführt wird.
haltvoller und wurden von ihren Schüler(inne)n als
(C) auf externale, stabile Ursachen, wie z.B.
stärker unterstützend wahrgenommen. Die sicht-
die Schwierigkeit der Aufgaben, zurückge-
baren Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung
führt wird.
in Klassen von Lehrkräften mit hohem fachdidakti-
schen Wissen führten im Laufe eines Schuljahres zu (D) auf externale, veränderbare Ursachen,
einem höheren Lernzuwachs in Mathematik (z.B. wie z.B. Zufall oder Pech, zurückgeführt
Baumert et al., 2010). wird.
7Unter der Lupe: Bedeutung pädagogischen-
psychologischen Wissens 7968 Schüler(innen) Fragebögen zur Unterrichts-
qualität. Mithilfe von Mehrebenen-Strukturglei-
(Voss, Kunter, Seiz, Hoehne, & Baumert, 2014) chungsmodellen konnte gezeigt werden, dass
pädagogisches-psychologisches Wissen der ange-
Die Bedeutung des fachlichen Wissens von Lehr-
henden Lehrkräfte
kräften für die Unterrichtsqualität und den Lerner-
folg der Schüler(innen) gilt als belegt. Weniger For-
schung gibt es bislang zur Bedeutung des generellen substanziell und statistisch signifikant
pädagogischen-psychologischen Wissens für den zur Vorhersage der Unterrichtsqualität
Unterrichtserfolg. Anhand eines Testinstruments aus Schülersicht beitrug.
(Voss, Kunter & Baumert, 2011) konnte das päda-
gogische-psychologische Wissen von 181 Lehramts- Schüler(innen) von Lehrkräften, die während des
kandidat(inn)en reliabel erfasst werden. Es umfasst Vorbereitungsdienstes über ein höheres pädago-
gisches-psychologisches Wissen verfügten, berich-
Wissen über Lernprozesse und Schüler- teten von weniger Unterrichtsstörungen, einem
heterogenität, Wissen über Unterrichts- besseren Monitoring der Lehrkräfte (also der Fä-
higkeit, die im Klassenzimmer ablaufende Prozesse
methoden und deren zieladäquate Orche-
und Vorkommnisse im Blick zu haben) und fühl-
strierung, Wissen über Leistungsbeur- ten sich gleichzeitig besser in ihren Lernprozessen
teilung und Wissen über Klassenführung. unterstützt (konstruktive Unterstützung). Die
von den Schüler(inne)n berichtete kognitive Akti-
Ca. zwei Jahre später, als die Lehramtskandidat(inn)en vierung erwies sich als unabhängig vom pädagogi-
bereits im Schuldienst standen, bearbeiteten deren schen-psychologischen Wissen.
Monitoring
R2 =.13
.21* Unterrichts-
störungen
R2 =.05
–20*
Pädagogisches-
psychologisches Kognitive
Wissen Aktivierung
R2 =.15
.38*
Konstruktive
Unterstützung
R2 =.16
Referendare Schülereinschätzungen
2008 2010
Dargestellt sind die standardisierten Regressionskoeffizienten zur Vorhersage der Unterrichtsqualität (erfasst über Schülerein-
schätzungen im Jahr 2010 zu den Merkmalen Monitoring, Unterrichtsstörungen, kognitive Aktivierung und konstruktive Un-
terstützung) durch das pädagogische-psychologische Wissen von Lehramtskandidat(inn)en (erfasst während des Vorbereitungs-
dienstes im Jahr 2008). Durchgezogene Pfeile symbolisieren statistisch signifikante Koeffizienten. Kontrolliert wurde in dem
Modell für die Schulformzughörigkeit (gymnasial versus nicht-gymnasiale Schule).
8Zentrale wissenschaftliche Publikationen zur Zentrale wissenschaftliche Publikationen zur
Erfassung und Bedeutung professionellen Bedeutung motivationaler Orientierungen und
Wissens: professioneller Selbstregulation:
Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Klusmann, U. (2011). Allgemeine berufliche Motivation
Jordan, A., . . . Tsai, Y.-M. (2010). Teachers’ mathe- und Selbstregulation. In M. Kunter, J. Baumert, W.
matical knowledge, cognitive activation in the class- Blum, S. Krauss, U. Klusmann, & M. Neubrand (Eds.),
room, and student progress. American Educational Professionelle Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse
Research Journal, 47(1), 133–180. des Forschungsprogramms COACTIV (pp. 277–294).
Krauss, S., Brunner, M., Kunter, M., Baumert, J., Blum, Münster: Waxmann.
W., Neubrand, M., & Jordan, A. (2008). Pedagogical Klusmann, U., Kunter, M., Trautwein, U., Lüdtke, O., &
content knowledge and content knowledge of se- Baumert, J. (2008). Teachers’ occupational well-being
condary mathematics teachers. Journal of Educational and the quality of instruction: The important role of
Psychology, 100(3), 716–725. self-regulatory patterns. Journal of Educational Psy-
Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, chology, 100(3), 702–715.
T., & Hachfeld, A. (2013). Professional competence Klusmann, U., Kunter, M. & Trautwein, U. (2009). Die
of teachers: Effects on instructional quality and stu- Entwicklung des Beanspruchungserlebens von Lehre-
dent development. Journal of Educational Psychology, rinnen und Lehrern in Abhängigkeit beruflicher Ver-
105(3), 805–820. haltensstile. Psychologie in Erziehung und Unterricht,
Seiz, J., Voss, T., & Kunter, M. (2015). When knowing 56, 200-212.
is not enough – the relevance of teachers’ cognitive Kunter, M. (2011). Motivation als Teil der professionellen
and emotional resources for classroom management. Kompetenz: Forschungsbefunde zum Enthusiasmus
Frontline Learning Research, 3(1), 54–75. von Lehrkräften. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, S.
Voss, T., Kunter, M., & Baumert, J. (2011). Assessing Krauss, U. Klusmann, & M. Neubrand (Eds.), Professio-
teacher candidates’ general pedagogical/psycholo- nelle Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse des For-
gical knowledge: Test construction and validation. schungsprogramms COACTIV (pp. 259–276). Münster:
Journal of Educational Psychology, 103(4), 952–969. Waxmann.
doi:10.1037/a0025125 Kunter, M., Tsai, Y.-M., Klusmann, U., Brunner, M., Krauss,
Voss, T., Kunter, M., Seiz, J., Hoehne, V., & Baumert, J. S., & Baumert, J. (2008). Students’ and mathematics
(2014). Die Bedeutung des pädagogisch-psychologi- teachers’ perceptions of teacher enthusiasm and in-
schen Wissens von angehenden Lehrkräften für die struction. Learning and Instruction, 18(5), 468–482.
Unterrichtsqualität. Zeitschrift für Pädagogik, 60(2),
184–201.
Begeistert und distanzierungsfähig: ten entscheidend. Begeisterung für das Fach allein
Auf die Balance kommt es an scheint sich dagegen nicht unmittelbar auf die Art
des Unterrichtens auszuwirken (Kunter et al., 2008).
Das fachliche Wissen und Können stand allerding Zudem zeigte sich, dass auch die Fähigkeit der
nicht alleine im Fokus der Forschung. Auch moti- Lehrkräfte, mit ihren eigenen Ressourcen und Kräf-
vationale und emotionale Merkmale der Lehrkräfte ten hauszuhalten – welche die Forscher(innen) als
wurden als wichtige Aspekte der professionellen selbstregulative Fähigkeit bezeichnen – relevant für
Kompetenz untersucht. Als eine oft gewünschte ihr Unterrichtsverhalten und die Motivation der
motivationale Eigenschaft von Lehrkräften wurde Schüler(innen) ist. Lehrkräfte, die
zum Beispiel deren „Enthusiasmus“ näher unter-
sucht. Die Forscher stellten fest, dass sich zwei ver-
schiedene Arten von Enthusiasmus unterscheiden zwischen hohem beruflichen Engagement
lassen: und Distanz zu beruflichen Belangen
eine gute Balance fanden,
Enthusiasmus für das Fach und
Enthusiasmus für das Unterrichten. wurden von ihren Schüler(inne)n im Hinblick auf
die von ihnen dargebotene konstruktive Unterstüt-
Für die Unterrichtsqualität aus Sicht der Schüler(in- zung im Unterricht positiver beurteilt als Lehrkräfte,
nen) war die Freude der Lehrkraft am Unterrich- die diese Balance nicht fanden. Diese Unterschie-
9de manifestierten sich auch in der fachspezifischen 1.8
Motivation der Schüler(innen): Klassen, die von ei- 1.6
1.4
ner Lehrkraft mit hohen selbstregulativen Fähigkei- 1.2
ten unterrichtet wurden, waren auch gleichzeitig 1.0
Klassen, die eine höhere Motivation für das Un- 0.8
terrichtsfach berichteten (Klusmann, Kunter, Traut- 0.6
0.4
wein, Lüdtke, & Baumert, 2008). 0.2
0.0
Die professionelle Selbstregulation erwies sich zu- Fachwissen Fachdidaktisches Pädagogisches-
dem als bedeutsam für das berufliche Wohlbefin- Wissen psychologisches
den der Lehrkräfte selber: Auch hier zeigte sich, Wissen
– ebenso wie bei der Unterrichtsqualität – dass Gymnasium Nicht-Gymnasium
Lehrkräfte mit hohem Engagement und der gleich-
zeitigen Fähigkeit sich von beruflichen Belangen
Abgebildet sind die standardisierten Mittelwertsunterschiede
distanzieren zu können das höchste berufliche
(Cohens’ d) in Kohorte 1 zwischen erstem Messzeitpunkt (An-
Wohlbefinden berichteten (Klusmann, 2011). fang des Vorbereitungsdienstes) und zweitem Messzeitpunkt
(Ende des ersten Jahres des Vorbereitungsdienstes) getrennt für
Lehramtskandidat(inn)en mit dem Studienziel Gymnasium und
nicht-Gymnasium. Man sieht, dass sich im pädagogischen-psy-
chologischen Wissen der größte Mittelwertsunterschied (d.h.
Wie entwickelt sich Zuwachs) fand und Lehrkräften mit gymnasialem Ausbildungs-
ziel in allen drei Wissensbereichen mehr dazulernten.
die professionelle Kompetenz?
Die Forscher(innen) fanden, dass sich die untersuch- Auch die Zuwächse im pädagogischen-psychologi-
ten Lehrkräfte substantiell in allen Aspekten profes- schen und fachdidaktischen Wissen variierten subs-
sioneller Kompetenz voneinander unterschieden. tantiell zwischen Personen: Lehramtskandidat(inn)en
Um zu verstehen, wie diese Unterschiede zustande in gymnasialen Ausbildungsgängen konnten so-
kommen, nahmen die Forscher(innen) die Lerngele- wohl das pädagogische-psychologische als auch
genheiten im Vorbereitungsdienst in den Blick. das fachdidaktische Wissen stärker ausbauen (sie-
he Abbildung), was sich zum Beispiel durch Un-
terschiede in den Lerngelegenheiten erklären ließ.
Entwicklung professionellen Wissens Beispielsweise lernten diejenigen mehr dazu, die
angaben, ihre praktischen Unterrichtserfahrungen
Die Befunde zeigten zunächst, dass das pädagogi- stärker zu reflektieren und bei denen das Seminar
sche-psychologische Wissen der angehenden Lehr- klarer geplant und strukturiert war sowie dieje-
kräfte im Verlaufe des Vorbereitungsdienstes be- nigen, die im Verlaufe des Vorbereitungsdienstes
deutsam anstieg. Für das fachdidaktische Wissen mehr Lerngelegenheiten im Hinblick auf den Um-
fand sich ebenfalls ein Zuwachs, der jedoch ver- gang mit Unterrichtsstörungen hatten (Voss, Rich-
gleichsweise geringer ausfiel als der des pädagogi- ter, & Kunter, 2017).
schen-psychologischen Wissens.
Das Fachwissen blieb im Mittel
über den Vorbereitungsdienst
hinweg stabil.
Die Forscher(innen) fanden he-
raus, dass die Lehramtskdan-
didat(inn)en des gymnasialen
Ausbildungsgangs im Mittel ein
höheres fachdidaktisches Wissen
aus der ersten universitären Pha-
se der Lehrerbildung in den Vor-
bereitungsdienst mitbrachten,
wohingegen die Lehramtskdandi-
dat(inn)en aus nicht-gymnasialen
Ausbildungsgängen mit höheren
Werten im pädagogischen-psy-
chologischen Wissen in den Vor-
bereitungsdienst starteten.
10Entwicklung anderer Aspekte
professioneller Kompetenz Solch ein konstruktivistischer Mentoring-Ansatz
stand in Zusammenhang mit einer positiveren
Andere Aspekte professioneller Kompetenz folgten Entwicklung der Motivation der Lehramtskandi-
nicht-linearen Veränderungsmustern: Die emotio- dat(inn)en und einer geringeren emotionalen Er-
nale Erschöpfung beispielsweise stieg im ersten Jahr schöpfung (Richter et al., 2013).
des Vorbereitungsdienstes bedeutsam an, wobei sie
im Mittel im zweiten Jahr wieder auf das Ausgangs-
niveau absank (Klusmann, Kunter, Voss, & Baumert,
2012; Richter et al., 2013). Die Lehramtskdandi- Beispielaufgabe zur Erfassung des Wissens
dat(inn)en berichteten im Mittel somit am Ende des über Klassenführung:
Vorbereitungsdienstes von einem vergleichbar hohen
Stresserleben wie am Anfang des Vorbereitungsdiens- Unterrichtssituation (Videoclip): Die Klasse ver-
tes, was auf einen „Erholungseffekt“ mit ansteigender tieft gerade ein Thema. Die Schüler(innen) sind
Erfahrung hindeutet (Voss, Wagner, Klusmann, Traut- mit einer spannenden Aufgabe beschäftigt. Es
wein, & Kunter, 2017). wird diskutiert, die Lehrkraft stellt immer wie-
der Fragen. Die Schüler(innen) sind größtenteils
Interessanterweise fanden sich Unterschiede zwi- bei der Sache. In der zweiten Reihe sitzt Mario.
schen Personen im Hinblick auf den Anstieg der Er ruft etwas in die Klasse, was mit dem Thema
emotionalen Erschöpfung: Personen, mit einer nichts zu tun hat. Auf seine Antwort hin begin-
hohen Gewissenhaftigkeit, also der Disposition, nen einige Schüler zu kichern und zu albern. Die
organisiert, zuverlässig und planvoll zu handeln, Lehrkraft geht darauf nicht ein und versucht die
berichten über einen geringen Anstieg des Bean- inhaltliche Diskussion am Leben zu erhalten. Ma-
spruchungserlebens im ersten Jahr des Vorberei- rio setzt sich zurück, verschränkt die Arme und
tungsdienstes ebenso wie Personen mit einer ge- beteiligt sich nicht mehr. Irgendwann beginnt er
ringeren Tendenz zu negativen Emotionen und in seiner Tasche zu kramen und einen Tennisball
Labilität. Darüber hinaus erwies sich das Wissen herauszunehmen, den er dann in den Händen
über eine effiziente Klassenführung als statistisch hält. Die Klasse kümmert sich nicht darum und
signifikanter Einflussfaktor auf die emotionale Er- arbeitet weiter. Mario beginnt, den Ball leicht in
schöpfung: Bei angehenden Lehrkräften, die mehr die Luft zu werfen und wieder zu fangen.
Wissen über Klassenführung vorweisen konnten,
stieg das Beanspruchungserleben weniger an als bei
angehenden Lehrkräften mit weniger Wissen. Die- Fragen im Anschluss an das Video:
ser Befund weist somit darauf hin, dass die
(A) Was machen die Schüler(innen), was den
Unterricht stört? Bitte beschreiben Sie mög-
Klassenführung als eine große lichst konkret alle Verhaltensweisen und
Herausforderung in der ersten Phase Vorkommnisse, die Sie gesehen haben und
der Lehrtätigkeit die mögliche Quellen für Unterrichtsunter-
brechungen und Störungen darstellen.
wahrgenommen wird, aber das an der Universität
vermittelte Wissen eine wichtige Ressource bei der (B) Ein Junge der Klasse hat mit einem Ball ge-
Bewältigung darstellen kann (Klusmann, Kunter, spielt. Stellen Sie sich vor, Sie sind die Lehr-
Voss, & Baumert, 2012). kraft und befürchten, dass er irgendwann be-
ginnen wird, mit dem Ball herumzuwerfen.
Weiterhin zeigte sich, dass der Ausbildungslehr- Was könnten Sie tun, um dies zu verhindern,
kraft eine zentrale Bedeutung im Hinblick auf die ohne die Klasse in ihrer inhaltlichen Diskus-
professionelle Entwicklung der angehenden Lehr- sion zu unterbrechen? Bitte nennen Sie alle
kräfte im Vorbereitungsdienst zukommt. Insbeson- konkreten Maßnahmen, die Sie einleiten
dere eine könnten.
konstruktivistische Interaktion
zwischen Mentor und Mentee, die
gekennzeichnet ist durch Anregung zum
Nachdenken und zur Auseinandersetzung
mit den eigenen praktischen Erfahrungen,
erwies sich als funktional.
11Der berufliche Alltag im Vorbereitungs- Darum haben wir uns entschlossen neben den rela-
dienst: Welche Tätigkeiten werden tiv globalen Befragungen nach dem Befinden eine
Zusatzstudie in COACTIV-R zu integrieren, die so
besonders häufig als stressrelevant erlebt?
alltagsnah wie möglich das Erleben der Lehrkräf-
te im Vorbereitungsdienst untersuchen sollte. So
Der Übergang in die berufliche Praxis wird oft als haben
große Herausforderung für die angehenden Lehr-
kräfte beschrieben. Zu groß sei die Differenz zwi-
schen den im Studium vermittelten Inhalten und über 300 Teilnehmer(innen)
den tatsächlichen praktischen Anforderungen an der COACTIV-R Studie
Lehrkräfte. Es fehle nicht nur an Wissen und Kön- zusätzlich an einer 14-tägigen
nen, sondern auch die Erwartungen der angehen-
Tagebuchstudie teilgenommen.
den Lehrkräfte wichen von den tatsächlichen Be-
dingungen der Praxis ab. Als Ergebnis, so ist häufig
zu lesen, erleiden die jungen Lehrkräfte einen „Pra-
Sie haben uns jeden Abend berichtet, welche po-
xisschock“, der sich unter anderem in hohem Stres-
sitiven und negativen beruflichen und außerberuf-
serleben und geringem Wohlbefinden zeigt.
lichen Ereignisse sie erlebt haben. Diese Ereignisse
Das Wohlbefinden der angehenden Lehrkräfte zu haben wir nach ihrem Inhalt einer von acht Tätig-
untersuchen und die Ursachen für das Erleben von keitskategorien zugeordnet. Zusätzlich haben sie
Stress besser zu verstehen, war auch ein Anliegen uns jeden Tag Fragen zur emotionalen Erschöpfung
des COACTIV Forschungsprogramms. Bislang ba- (z.B. „Ich fühlte mich heute während der Arbeit
sieren die Aussagen zum Erleben der Lehrkräfte erschöpft.“) und zur Freude (z.B. „Die Arbeit hat
beim beruflichen Übergang eher auf Berichten ein- heute insgesamt richtig Spaß gemacht.“) beant-
zelner Lehrkräfte als auf systematischen Studien. wortet (siehe „Unter der Lupe“).
Unter der Lupe: Drittens, konnten wir sehen, in welchen von acht
Ergebnisse der Tagebuchstudie Tätigkeitsbereichen die Lehrkräfte die meisten posi-
tiven und negativen Ereignisse hatten. Die meisten
(Schmidt, Klusmann und Kunter, 2016)
Ereignisse, im Positiven wie im Negativen bezogen
sich auf den Unterricht und die Ausbildung. Sehr
Die Auswertungen der Tagebuchstudie ergaben ei-
viele positive Ereignisse bezogen sich auch auf die
nige interessante Befunde.
Interaktion mit dem Kollegium. Deutlich seltener
Erstens, zeigten sich über die 14 Tage hinweg sub- wurde die Vor- und Nachbereitung thematisiert.
stantielle Schwankungen im beruflichen Erleben; Betrachtet man die Ereignisse im Unterricht genau-
sowohl, was die Häufigkeit von negativen Ereignis- er, wird deutlich, dass es insbesondere Schwierig-
sen als auch die emotionale Erschöpfung und die keiten bei der Klassenführung sind, die die ange-
Freude am Beruf betraf. Das heißt, Personen, die an henden Lehrkräfte beschäftigen.
einem Tag viele negative Ereignisse, Erschöpfung
und wenig Freude erlebten, konnten am nächsten
Tag genau das Gegenteil erleben. Diese täglichen Insgesamt sprechen unsere Befunde
Schwankungen waren größer als die Unterschiede nicht für einen großen Praxisschock.
zwischen Personen. Das heißt, es zeigte sich wenig
individuelle Stabilität im beruflichen Befinden.
Im Mittel berichten die angehenden Lehrkräfte viel
Zweitens zeigte sich, dass die Lehrkräfte deutlich Positives. Das Thema Klassenführung ist allerdings
mehr positive (6.231) als negative berufliche Er- ein Thema, das noch stärker in der Ausbildung ver-
eignisse (4369) erlebten. Auch zeigte sich bei der ankert werden sollte. Auch sind bemerkenswert
emotionalen Erschöpfung über 14 Tage auf einer viele negative Ereignisse mit dem Vorbereitungs-
Skala von 1–4 ein Mittelwert von M = 1,67 und dienst selbst assoziiert, der doch eigentlich eine
bei der Freude von M = 2,96. Dies zeigt, dass die unterstützende Funktion beim Übergang in die
Mehrheit der angehenden Lehrkräfte ihren berufli- Praxis haben sollte.
chen Alltag sehr positiv erlebt.
12Dargestellt ist die Anzahl der positiven (blau) und negativen (grün) Ereignisse in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen
(Unterrichten, Vor- und Nachbereitung...).
Zentrale wissenschaftliche Publikationen Richter, D., Kunter, M., Lüdtke, O., Klusmann, U., An-
zur Entwicklung professioneller Kompetenz: ders, Y., & Baumert, J. (2013). How different mentoring
approaches affect beginning teachers’ development in
Decker, A.-T., Kunter, M., & Voss, T. (2015). The relations- the first years of practice. Teaching and Teacher Educa-
hip between quality of discourse during teacher induc- tion, 36, 166–177.
tion classes and beginning teachers’ beliefs. European Schmidt, J., Klusmann, U., Lüdtke, O., Möller, J., & Kunter,
Journal of Psychology of Education, 30(1), 41–61. M. (2016). What makes good and bad days for begin-
Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M., Elsner, J., Besser, ning teachers? A diary study on daily uplifts and hassles.
M., Krauss, S., & Baumert, J. (2013). Teachers’ pedago- Contemporary Educational Psychology, 48, 85–97.
gical content knowledge and content knowledge: The Schmidt, J., Klusmann, U. & Kunter, M. (2016). Wird alles
role of structural differences in teacher education. Jour- besser? Tägliches Erleben positiver und negativer Ereig-
nal of Teacher Education, 64, 90–106. nisse von Lehramtskandidaten im Vorbereitungsdienst
Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M., Elsner, J., Besser, und Lehrkräften im Vergleich. Psychologie in Erziehung
M., Krauss, S., . . . Baumert, J. (2015). Content knowled- und Unterricht, 63, 278–291.
ge and pedagogical content knowledge in taiwanese Voss, T., Wagner, W., Klusmann, U., Trautwein, U., & Kun-
and german mathematics teachers. Teaching and Teacher ter, M. (2017). Changes in beginning teachers’ classroom
Education, 46, 115–126. doi:10.1016/j.tate.2014.11.004 management knowledge and emotional exhaustion du-
Klusmann, U., Kunter, M., Voss, T., & Baumert, J. (2012). ring the induction phase. Manuscript under revision.
Berufliche Beanspruchung angehender Lehrkräfte: Die Voss, T., Richter, D., & Kunter, M. (2017). Development
Effekte von Persönlichkeit, pädagogischer Vorerfahrung of teacher candidates’ content knowledge, pedagogical
und professioneller Kompetenz. Zeitschrift für Pädago- content knowledge and general pedagogical/psycholo-
gische Psychologie, 26(4), 275–290. gical knowledge. Manuscript in preparation.
13Wie geht es weiter? gungen im Verlaufe des Vorbereitungsdienstes im
Rahmen von COACTIV-R können wir die
Das COACTIV-Forschungsprogramm ist national
und international akzeptiert und rezipiert. Es hat
richtungsweisende Impulse für die Forschung zu Bedeutung der verschiedenen
Lehrkräften gegeben. Auf wissenschaftlichen Ta- – im Studium und Vorbereitungsdienst
gungen im Bereich der empirischen Schul- und erworbenen – Aspekte professioneller
Unterrichtsforschung wird das Projekt so häufig Kompetenz für die langfristige
genannt, wie kaum ein anderes Projekt. COACTIV
stand Pate für viele weitere Projekte in andern Fä-
Entwicklung und den beruflichen Erfolg
chern, Bildungskontexten und Altersstufen. Es be- von Lehrkräften untersuchen.
gann als Grundlagenforschung, die Erkenntnisse
sind jedoch nicht nur in der Forschung zur Kennt- Beispielweise können Antworten auf die Frage ab-
nis genommen worden, sondern sind ebenso von geleitet werden, welche individuellen und institu-
der Bildungsadministration, Bildungspolitik und tionellen Faktoren langfristig Ressourcen für eine
den Praktikern auf großes Interesse gestoßen. erfolgreiche Professionalisierung von Lehrkräften
darstellen und was potenzielle Risikofaktoren sind.
Daher möchten wir dieses einmalige Wir haben dazu verschiedene Studien mit unter-
Forschungsprogramm fortführen. schiedlichen methodischen Ansätzen und inhaltli-
chen Schwerpunkten geplant und würden uns sehr
freuen, wenn Sie uns weiter unterstützen und die
Wir arbeiten weiterhin aktiv mit den Daten der
Fortführung der Studie ermöglichen!
Studie, und weitere Publikationen mit der reich-
haltigen Datenbasis und den vielen Zusatzstudien In dem kurzen Fragebogen zu dem Sie den Link er-
sind in Arbeit und Planung. Darüber hinaus planen halten haben, können Sie Ihr Interesse für weitere
wir weiterführende Studien. Studien angeben.
Die nächsten Schritte
In COACTIV-R wurde eine sehr große Stichprobe
von über 800 Lehramtskandidat(inn)en aus vier
Bundesländern umfassend in ihrer professionellen
Entwicklung im Vorbereitungsdienst untersucht. Es
handelt sich somit um eine sehr große Stichprobe,
die bereits mehrfach untersucht wurde und über
die umfangreiche Information zu persönlichen Impressum
Merkmalen, zur schulischen und universitären
IPN · Leibniz-Institut für die Pädagogik
Ausbildung, zu Merkmalen des Vorbereitungs- der Naturwissenschaften und Mathematik
dienstes (und die Nutzung der Lerngelegenhei- Olshausenstraße 62
ten im Vorbereitungsdienst) sowie zu verschiede- 24118 Kiel
nen Aspekten der professionellen Kompetenz Tel.: +49 (0)431 880 - 30 90
E-Mail: klusmann@ipn.uni-kiel.de
vorliegen. Diese Datengrundlage ist einzigartig, www.ipn.uni-kiel.de
und wir möchten sie gerne für die Beantwortung
weiterer spannender und drängender Forschungs- Redaktion:
fragen nutzen. Für uns bietet die Datengrundlage Thamar Voss
die einmalige Gelegenheit, die professionelle Ent- Uta Klusmann
Dirk Richter
wicklung von Lehrkräften längerfristig und diffe-
renziert weiter verfolgen zu können. Wir würden Gestaltung und Layout:
uns somit sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse für K. Graff, S. Schnetger, K. Vierk / IPN
weitere Forschungsprojekte wecken können!
Abbildungsnachweis:
Auf der Grundlage der von uns angedachten wei- S. 2 oben links: © contrastwerkstatt/Fotolia.com;
terführenden Studien werden wir empirisch fun- oben Mitte: © pixabay.com; oben rechts: © pixabay.com
dierte Aussagen über die Kompetenzentwicklung S. 6 © contrastwerkstatt/Fotolia.com
von Lehrkräften nach Abschluss der Ausbildung S. 10 © contrastwerkstatt/Fotolia.com
treffen können. Durch Informationen der Befra-
14Sie können auch lesen