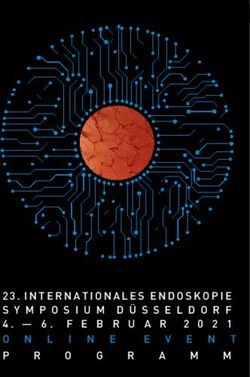Bitte nicht stören Süddeutsche Zeitung Die Seite Drei Dienstag, 13. November 2012
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Süddeutsche Zeitung Die Seite Drei Dienstag, 13. November 2012 Bitte nicht stören Ein Hanseat mault nicht, sondern genießt in Stille. Für die Stadt Hamburg wird die Selbstgenügsamkeit zum Problem. Das Fiasko um die Elbphilharmonie ist da nur ein Symptom VON JENS SCHNEIDER Hamburg – „Hören Sie was?“, fragt Thomas Möller. Nichts. Der Hafenlärm bleibt draußen. Dann stemmt sich der Mann vom Baukonzern Hochtief mit der Schulter gegen die riesige Fensterscheibe, um zu zeigen, wie fest die ist. Das jagt einem einen Schrecken ein, 100 Meter über dem Hafenbecken, im 26. Stock. Die Fenster sind Sonderanfertigungen, überhaupt ist ja alles einzigartig. Alleine der Blick. Unten die Landungsbrücken, die Elbe zieht sich bis zum Horizont, als ginge es gleich nach Amerika. Schade, dass auch drinnen kein Geräusch entsteht. Auf dem Weg zur Spitze der Elbphilharmonie, wo schräg über dem Konzertsaal ein Luxusapartment geplant wurde, ist es fast menschenleer. Hier sollten eigentlich 600 Bauleute arbeiten. Nur 50 bewachen jetzt den Stillstand. Von außen sieht der Bau fast fertig aus. Das neue Hamburger Wahrzeichen, das eines der zehn besten Konzerthäuser der Welt werden soll. Drinnen fühlt sich der Bau an wie ein Mausoleum. „Eine Katastrophe“, sagt einer der Bauleute, „Ground Zero.“ Vor über einem Jahr hat der Baukonzern Hochtief die Arbeit eingestellt. Der Konzern und der Bauherr, die Stadt Hamburg, sind im Clinch verkeilt. Sie streiten über Geld, fehlende Baupläne, vor allem über die Statik für das Dach. Durch einen Dschungel aus Leitern und Gerüsten klettert der Baustellenchef zu einer Messstation unterm Saaldach. Zwei Statiker haben einen Tisch aufgebaut. Ihre Laptops sind mit Fühlern im Dach verbunden, jeder Sensor ist klein wie ein Fingernagel. Sie sollen Risse feststellen, die entstehen könnten, während das Dach abgesenkt wird. Der Sinn der Testreihen ist umstritten. Wie es weitergeht, erst recht. Die Fachleute der Stadt und von Hochtief reden nicht mehr miteinander. Verhandelt wird auf höchster Ebene, in geheimen Treffen zwischen Konzernspitze und Senat. Sicher ist, dass die Stadt noch weit mehr als geplant für den Bau ausgeben muss, von dem die Hamburger Bürgerschaft einst stolz versprach, er solle vor allem aus Spenden wachsen. Christoph Lieben-Seutter ist Hamburgs Experte im Fach Warten. Vor fünf Jahren wurde der Wiener der ElbphilharmonieIntendant. Eine tolle Herausforderung: Wer sonst darf ein Konzerthaus von null aufbauen? Er plante zum Eröffnungstermin 2010 ein grandioses Programm. Als er absagen musste, fühlte sich das noch fast normal an. Inzwischen plant er nicht mehr für die Eröffnung. Er richtet stattdessen viele „Elbphilharmonie-Konzerte“ aus. Gerade stellte er sein Musikfest „Lux aeterna“ in der Grabkammer des Michels vor. Überall in Hamburg präsent zu sein, sagt er, „das ist unser Markenzeichen“. Tief im Gewölbe freute er sich über die vielen Spielorte. Den © Süddeutsche Zeitung GmbH, München Seite 1 von 6
Michel, den Marien-Dom, Kampnagel, die Laeiszhalle: In der alten Musikhalle gab es mehr al 100 „Elbphilharmonie-Konzerte“. „Intendant ohne Haus zu sein, ist auch ein Job“, sagt Lieben-Seutter, der Wiener ist, also in Fatalismus geschult. Der Intendant könnte längst die erste Spottfigur Hamburgs sein. Je länger der Bau sich verzögert, desto absurder erscheinen die überall präsenten Plakate für Elbphilharmonie-Konzerte, die nie in der Elbphilharmonie stattfinden. Spott? Gelegentlich wird er getröstet. Meistens sprechen die Hamburger ihm Mut zu. „Es gibt diese Sehnsucht nach guten Nachrichten“, sagt er. „In dem Moment, wenn nur der Funken einer positiven Nachricht kommt, haben alle strahlende Gesichter.“ So oft es geht, lässt er Besucher über die Baustelle führen. Es ist der beschwerlichste und beliebteste Sonntagsspaziergang Hamburgs, zugleich ist er eine Art kollektives Antidepressivum: „Die Führungen sind unsere Wunderwaffe. Egal wen du auf die Baustelle schickst, die Leute kommen begeistert zurück.“ Es gibt zwei große Bau-Katastrophen in Deutschland. Über Berlins Flughafen höhnt das ganze Land. Die Berliner verkaufen ätzende Postkarten: Berlin kann alles, außer Flughafen, S-Bahn und Fußball. Die S-Bahn fällt immer wieder aus, Hertha BSC muss sich über einen Sieg gegen Sandhausen freuen. Und so weiter. In Hamburg nun wäre Spott über die eigene Stadt Frevel. Der HSV feiert auf einer Uhr im Stadion Jahre, Tage, Stunden und Sekunden, die er als einziger Verein seit der Gründung in der Bundesliga ist. Große Erfolge liegen Jahre zurück. Man ist stolz, ein Dino zu sein, und nach jedem Sieg gefühlt in der Champions League. Und während bei der Elbphilharmonie jeder Monat Stillstand zweieinhalb Millionen Euro kostet, übt das Bürgertum sich seit Jahr und Tag: in Vorfreude. „Hamburg ist ein bisschen wie ein eigener Planet“, sagt der Wiener Intendant. „Im Unterschied zu den Bewohnern anderer Metropolen sind die Hamburger stolz auf ihre Stadt und sagen das auch. Überall hörst du, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist.“ Es sei ruhig hier: „Mag sein, dass in Berlin die Clubs spannender sind und mehr los ist.“ Aber er findet die Stimmung ideal: „Der Bürgerstolz bringt ein Engagement, das in Berlin oder Wien unvorstellbar wäre.“ Christoph Lieben-Seutter muss sehr behutsam mit seinen Hamburgern umgehen. Im Sommer ist ihm eine kleine Wahrheit rausgerutscht. Die Elbphilharmonie sei „als Lachnummer um die Welt gegangen“, sagte er. Es brach ein Sturm los. Das Hamburger Abendblatt warnte: Wenn es Hanseaten an die Ehre gehe, verstünden sie Späße nur bedingt. Der Hanseat. Das ist das Phantom, das seit ewigen Zeiten die Geschicke der Stadt bestimmt, egal wer gerade regiert. Es gibt genaue Vorstellungen, was sich für den Hanseaten gehört. Und ein Idealbild. „Der blaue Blazer, dazu Goldknöpfe, das ist der Standard“, sagt Jens Kerstan, 46. Er kennt sich aus. Während seiner Zeit als Trainee eines Maschinenbaukonzerns spotteten die Kollegen: Hatte sein Sakko eine Knopfreihe, sprachen sie vom „einfachen Reeder“. Der Zweireiher? „Doppelter Reeder“. Kerstan ist Sohn eines Reeders, sein Vater stieg einst bei der TT-Linie bis in die Spitze auf. Kerstan ist Fraktionschef der Hamburger Grünen. Während des Gesprächs bei seinem Stammitaliener hinterm Rathaus fällt ihm ein, dass er eigentlich weg wollte. © Süddeutsche Zeitung GmbH, München Seite 2 von 6
Er war aber nur kurz im Ausland. Auch er hat in sich, was er bei vielen Hamburgern spürt: Wohin soll einer gehen, der aus Hamburg kommt? „Der Hamburger wechselt bestenfalls den Stadtteil.“ Er erinnert sich an die Irritationen im Hamburger Bürgertum, als die Grünen die soziale Ungleichheit in Deutschlands Stadt mit den meisten Millionären beklagten: „So was hört der Hamburger nicht gern.“ Auch fällt ihm auf, dass hier nur Städte-Rankings wahrgenommen würden, bei denen Hamburg gut abschneidet: „Man will nicht hören, was schlecht ist.“ Eigentlich beneidenswert. Wenn man sich in Hamburg über den vielen Regen beklagt, reden die Leute über die Stunden, in denen es nicht regnet. Andere kennen Statistiken, die belegen, dass es woanders mehr regnet. „Hier gibt es seit Jahrhunderten das Gefühl, es allein am besten zu schaffen“, sagt Kerstan. „Das ist eben die Stadt, die einst dem dänischen König trotzte und es sich herausnahm, erst 1888 wirtschaftlich dem deutschen Reich beizutreten.“ Doch die Selbstzufriedenheit werde nun zum „Entwicklungshemmnis“. Ein Hemmnis, das der Grund sein könnte, weshalb alles Wichtige schiefgeht, was mit Elbe anfängt. „Am Anfang“, sagt Kerstan, „war ich begeistert von diesem Bau. Endlich eine große Investition in Kultur in der Stadt der Pfeffersäcke. Aber der Senat hat mit einem naiven Selbstbewusstsein eine komplizierte Vertragsstruktur geschaffen. Sie ist der Hauptgrund für das Fiasko.“ Mit seiner Amtsübernahme kündigte SPD-Bürgermeister Olaf Scholz an, dass alles anders werden soll: „Er hat die große Lösung versprochen und sich überschätzt. Aber er und seine Leute tun, als könnten sie alles allein.“ Genau so eine „Wagenburgmentalität“ sieht Kerstan bei der Elbvertiefung. Die Elbe soll wieder mal ausgebaggert werden, damit auch größte Containerschiffe den Hafen erreichen. Ginge es nach dem Senat, würde längst gebaggert. Wegen einer Klage von Umweltverbänden stoppte das Bundesverwaltungsgericht das Projekt. Seither passiert nichts. Der Grüne Kerstan: „Nun wird über das Gericht geschimpft, die Hafenwirtschaft drischt auf die Umweltschützer ein. Man fragt nie, was man anders machen könnte.“ Die stolze Stadt stelle sich nicht infrage: „Alles wird dem Hafen untergeordnet – wie vor 100 Jahren. Dabei ist Hamburg längst viel mehr als der Hafen.“ Sobald ein wenig die Sonne scheint, zieht es die Hamburger an den Elbstrand. Gegenüber werden Containerschiffe beladen. „Da sitzen die Leute in der Strandperle und bestaunen die Pötte. Da machen auch die Leute aus den Werbeagenturen große Augen und glauben, dass Hamburg auf den Hafen setzen muss“, sagt Reeder- Sohn Kerstan. Die Stadt, glaubt er, sollte sich aber nicht immer nur an der Tradition berauschen. Es sei sehr schwer, Hamburger zu motivieren: „Hier lebt ein bestimmter Typus von Leuten. Aufregung und Neues suchen sie in der Ferne, zum Beispiel in Berlin. Zu Hause soll alles bleiben, wie es war.“ Nach Berlin fährt der ICE in weniger als zwei Stunden, und während es abends aus Hamburg keinen Spätzug gibt, kommt man aus der Hauptstadt noch spät zurück. Das B-Wort: Berlin. In den letzten Jahren ist der Name der Hauptstadt für die Hamburger – anders als für die von Berlin räumlich wie mental weit entfernten Münchner – zu einem Trauma © Süddeutsche Zeitung GmbH, München Seite 3 von 6
geworden: Firmen wanderten ab, Künstler, Schauspieler. Einige hinterließen ätzende Kommentare, die nachwirken wie Spuren von Hundehäufchen auf einem Teppich. Amelie Deuflhard zog in die Gegenrichtung. In Berlin leitete sie die Sophiensäle und erregte mit kühnen Konzepten für die künstlerische Nutzung des Palastes der Republik Aufsehen. Nun führt die gebürtige Stuttgarterin seit 2007 die Kampnagel- Fabrik. Sie lässt zum Gespräch einen kürzlich erschienenen Text aus dem Hamburger Abendblatt ausdrucken: eine Selbstprüfung, ob Hamburg eine Weltstadt sei – mit New York, London oder Paris als Maßstab. Sie findet schon die Frage sehr komisch und sehr hamburgisch: „Am Ende geht der Text natürlich so aus, dass Hamburg eine Weltstadt ist.“ Wenn sie hier richtig hip gestylte Leute sieht, ist sie sicher, dass die von auswärts kommen: „Und so ist es dann auch.“ Für eine Weltstadt würden schon die Etats für große Kunstausstellungen fehlen. Der Tourismus sei darauf ausgerichtet, Kleinbürger aus der Provinz zu Musicals herzukarren. Hamburg sei, sagt sie, gewiss schön und wohlhabend, und: „Diese Hochzufriedenheit hat auch was Positives.“ Sie schätze das Mäzenatentum: „Es ist viel Geld da, das ergibt wunderbare Möglichkeiten. Mich erinnert das an die Tradition einer Eliteschule.“ Woher rührt das Gefühl, zwischen der Jugendmetropole Berlin und der Hochkulturmetropole München wichtig zu sein? Deuflhard fallen da die Versuche der Kultursenatorin Barbara Kisseler ein, den Hamburger Maßstab zurechtzurücken: „Wenn Frau Kisseler mutig sagt, Hamburg solle anstreben, in Sachen Kultur zweite Stadt nach Berlin zu sein, dann geht immer ein Raunen durch den Saal.“ Amelie Deuflhard versucht, den verstörten Hamburgern hinterher zu erklären, dass das auch was wäre: Zweiter. Das verstehen die Leute hier nicht: Sind wir etwa nicht Erster? „Diese Hybris ist in Hamburg schon sehr verbreitet.“ Die Stadt neige dazu, sich in Traditionen einzurichten. „Wenn man sehr zufrieden ist, ändert man auch nichts.“ Und merke nicht, was sich verändert: „Die Hälfte der Kinder hier haben einen Migrationshintergrund. Wo tauchen die auf? Wo sind die im Theater, in Konzerten und wenn Kunst gezeigt wird?“ In dieser Welt spielt die Elbphilharmonie keine Rolle. So hat sich auch die linksalternative Szene längst abgewandt. Sie ignoriert die Elbphilharmonie und kämpft gegen Vorhaben, die ihre Welt berühren. „Für die ist das gegessen“, sagt Deuflhard, „das Ding steht als Fassade da, nur kann da keiner spielen.“ Einen Flughafen braucht man. Eine Philharmonie muss man nicht brauchen. Das vermindert den Druck für den Bürgermeister und die parteilose Senatorin Kisseler, wenn sie mit Hochtief verhandeln. Scholz holte Kisseler 2011 aus Berlin. „Es war eine ziemliche Umstellung“, sagt sie. Sie sucht nach dem richtigen Wort für Hamburg. Selbstgenügsamkeit? Könnte passen. Es gebe, sagt sie, einen beneidenswert hohen Identifikationsgrad der Hamburger mit ihrer Stadt. „Da ist die Elbphilharmonie sogar ein ganz gutes Beispiel.“ Das Haus sei ja ein Zeichen für ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was den Einsatz privaten Geldes angeht. Ihr fällt das Bild von den heiteren Menschen ein, die immer das halbvolle Glas wahrnehmen und über das hinwegsehen, was fehlt. © Süddeutsche Zeitung GmbH, München Seite 4 von 6
„In Hamburg herrscht das Gefühl vor, dass man mit seiner Stadt nicht nur zufrieden ist, sondern glücklich.“ Kisseler macht eine Pause: „Nur wenn man in Hamburg genau hinguckt, gibt es natürlich Ecken, wo man sagen muss: Da ist das Glück aber lange nicht gewesen.“ Sie formuliert so vornehm, wie es Hanseaten erwarten. Und doch deutlich. An manchen Stellen spürt Kisseler „eine überraschend weitgehende Bereitschaft, über Dinge hinwegzusehen“. Über die Verhandlungen zur Elbphilharmonie sagt sie kein Wort. Was soll sie sagen? Sie braucht eine Lösung. An der Baustelle haben die Pförtner neben der Schranke nun einen kleinen Rasen und Blümchen gepflanzt – eine Art Schrebergarten. Im Hamburger Rathaus drängt die Opposition Kisseler und den Bürgermeister, sie über den Verhandlungsstand zu informieren. Ziel der Geheimgespräche ist ein Neuanfang, dabei könnte der Generalunternehmer Hochtief mehr Verantwortung übernehmen. Die Einigung könnte nach Schätzungen über 200 Millionen Euro Kosten zusätzlich bedeuten. Derzeit sind 323 Millionen veranschlagt. Angefangen hatte man bei 114 Millionen. Noch teurer könnte eine Kündigung des Vertrags mit Hochtief werden. Ein Schnitt, für den es in der Stadt Sympathien gibt, wo manche den Baukonzern als Hauptschuldigen in der Misere sehen. Oppositionspolitiker warnen nun vor neuer Selbstüberschätzung: Ohne Hochtief müsse der Bau ganz neu geordnet werden. Die Fertigstellung könnte sich dann wieder einmal um Jahre verzögern. Bürgermeister Olaf Scholz gab sich bis jetzt nach Hamburger Art: gelassen. Er erinnerte daran, woran neu eingesetzte Entscheidungsträger immer gerne erinnern: Er habe das Problem von den Vorgängern geerbt. Und er verließ sich auf den Langmut des Hamburger Bürgertums. Inzwischen weiß Scholz aber, dass sogar dieser Langmut begrenzt sein könnte. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der distinguierte „Freundeskreis der Elbphilharmonie“ zum jährlichen Dinner ins Hotel Vier Jahreszeiten geladen. Es sollte ein gediegener Abend mit den Großspendern sein, auf der Menükarte stand das wieder einmal recht selbstgenügsame Sprüchlein: „Das Beste am Norden ist unsere Geduld.“ Doch Scholz erlebte Ungeheuerliches. In seiner Rede attackierte ihn Nikolaus Schües, Vorsitzender des Freundeskreises, heftig. Schües stammt aus einer Reeder- Familie mit viel Tradition, sie hat 1901 den Bau der Laeiszhalle, der heutigen Musikhalle, finanziert. Nun forderte Schües, dass endlich was passieren müsse. Und verglich die Elbphilharmonie mit dem Berliner Großflughafen. Der „Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg“ solle sich und der Stadt ersparen, in die gleiche Lage zu kommen wie sein weithin blamierter SPD- Parteifreund Klaus Wowereit in Berlin. Schluck! Scholz legte sein Grußwort beiseite und antwortete. Er versprach, dass die Philharmonie zu Ende gebaut werde. Und setzte sich mit dem Versprechen selbst unter Druck. Vor Weihnachten soll es eine Entscheidung geben: „Wer baut, steht dann fest.“ Nun ist die Ruhe dahin. Wann eröffnet werden soll, sagte Scholz nicht. © Süddeutsche Zeitung GmbH, München Seite 5 von 6
Aber auch für den Intendanten ohne Haus – Christoph Lieben-Seutter – könnten die Chancen wieder steigen, dann dabei zu sein. Am Mittwoch nimmt er erst mal an einer kleinen Zeremonie in der Speicherstadt teil, nur einen Spaziergang von der Baustelle entfernt. Im „Miniaturwunderland“ soll eine kleine Elbphilharmonie entstehen. Die Welt aus Modelleisenbahnen, Häusern und Figuren ist derzeit eine der größten Hamburger Attraktionen. © Süddeutsche Zeitung GmbH, München Seite 6 von 6
Sie können auch lesen