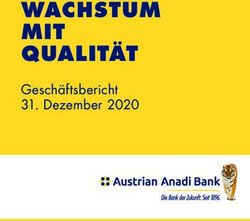Breitband in Österreich - Evaluierungsbericht 2017 - BMK
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Breitband in Österreich
Evaluierungsbericht 2017
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Breitbandbüro
Stabstelle Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
Wien, 2018; Band VI
www.bmvit.gv.at/breitbandbuero
infothek.bmvit.gv.atImpressum Medieninhaber: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) Radetzkystraße 2, 1030 Wien Für den Inhalt verantwortlich: Stabstelle Informations- und Kommunikationsinfrastruktur Stand 2018
Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Inhalt
Executive Summary ..................................................................................................... 4
1. Die sozioökonomische Bedeutung des IKT-Sektors für Österreich........................... 7
1.1. Einleitung ..............................................................................................................................7
1.2. Die wirtschaftliche Bedeutung des IKT-Sektors für Österreich .............................................. 9
1.3. Die gesellschaftspolitische Bedeutung des IKT-Sektors für Österreich ................................. 13
1.4. Der Networked Readiness Index des World Economic Forum .............................................. 17
1.5. Digital Economy und Society Index der Europäischen Kommission......................................18
2. Breitbandinitiative Breitband Austria 2020 ............................................................20
2.1. Breitbandstrategie sowie Masterplan zur Breitbandförderung ............................................ 20
2.2. Stand und Entwicklung der Festnetz-Breitbandversorgung ................................................ 24
2.3. Evaluierung der 1. Programmphase der Breitbandinitiative ................................................ 29
2.4. Programmsteuerung, Monitoring und Förderabwicklung ....................................................32
2.5. Ausblick zur Breitbandinitiative bis 2020 ............................................................................. 33
2.6. Ausblick Erfordernisse 2030 ................................................................................................ 34
2.7. Maßnahmen der Bundesländer........................................................................................... 40
3. Serviceangebote des Breitbandbüros .................................................................... 49
3.1. Einleitung und Kontakte ..................................................................................................... 49
3.2. Öffentlichkeitsarbeit und Informationskampagnen ............................................................ 50
3.3. Dienstleitungsangebote rund um die Breitbandinitiative ..................................................... 51
4. Stand ausgewählter Maßnahmen der Breitbandstrategie ...................................... 63
3Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Executive Summary
Die sozioökonomische Bedeutung des IKT-Sektors für Österreich
- Das Internet hat in den vergangenen Jahrzehnten einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Für
entwickelte Volkswirtschaften ist der Grad der Digitalisierung ein zunehmend wichtiger
Wettbewerbsfaktor. Dieser Befund gilt auch für Österreich: Die Erfüllung der Digitalisierungsziele der
Europäischen Kommission und der österreichischen Bundesregierung sind für Österreichs Wirtschaft
und Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer von immanenter Bedeutung.
- In Österreich waren im Jahr 2015 nach OECD-Definition über 15.900 Unternehmen mit 106.200
Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von 29,4 Mrd. Euro im IKT-Sektor tätig. Die Investitionen
sind gegenüber dem Jahr 2010 um knapp 17 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro gestiegen. Die
Bruttowertschöpfung hat sich im gleichen Zeitraum um 25 Prozent auf mehr als 10,1 Mrd. Euro erhöht.
- Die nach OECD definierte IKT-Branche ist der achtgrößte Sektor Österreichs – weitaus größer als
beispielsweise der traditionell wichtige Sektor „Beherbergung und Gastronomie“.
- Der Einsatz von IKT ist für Unternehmen unverzichtbar geworden. So gut wie jedes Unternehmen in
Österreich verfügt über einen Internetzugang zudem verfügen knapp neun von zehn Unternehmen
über eine eigene Website.
- 2017 waren 89 Prozent der Haushalte mit einem Internetzugang ausgestattet und 88 Prozent der
Bürgerinnen und Bürger nutzen das Internet regelmäßig. Zudem haben bereits 62 Prozent der
Personen in den letzten zwölf Monaten Waren und Dienstleistungen online eingekauft.
- Um bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien Chancengleichheit zu
schaffen ermöglicht das BMVIT die Gewährung einer Zuschussleistung für sozioökonomisch
benachteiligte Personen.
- Festnetz- und Mobilfunk zusammengenommen gibt es in Österreich bereits mehr als 11,1 Mio.
Breitbandanschlüsse. Davon werden bereits mehr als 75 Prozent in den Mobilfunknetzen realisiert.
- Bei Betrachtung der Indizes „Networked Readiness Index (NRI)“ sowie „Digital Economy und Society
Index (DESI)“ hat Österreich im internationalen Vergleich neben dem Ausbau insbesondere auch bei
der Nutzung von digitalen Infrastrukturen Aufholbedarf. Während im EU-Durschnitt der Anteil der Anschlüsse
mit mehr als 100 Mbit/s bereits 20 Prozent beträgt, sind es in Österreich lediglich sieben Prozent.
Breitbandinitiative Breitband Austria 2020
- Im Zuge der Breitbandinitiative „Breitband Austria 2020“ stellt das BMVIT seit Mitte 2015 österreichweit
eine Milliarde Euro an Förderungsmitteln für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur zur Verfügung.
- Die Breitbandinitiative hat am österreichischen Telekommunikationssektor eine bis dato nie
dagewesene Dynamik ausgelöst.
- Im Rahmen der bisherigen Ausschreibungen aus der Breitbandmilliarde haben 173 Förderungsnehmer
in 534 Projekten Förderungszusagen über insgesamt 344,3 Millionen Euro erhalten. Berechnungen
externer Evaluatoren (Konsortium aus WIFO/WIK-Consult) zufolge werden dadurch weitere
Investitionen in der zweieinhalbfachen Höhe der Förderungsmittel initialisiert (860 Mio. Euro)
4Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
- Insgesamt profitieren knapp 690.000 Österreicherinnen und Österreicher in über 1.140 Gemeinden von
den bisherigen Förderzuschlägen. Das sind über 36 Prozent aller bisher unterversorgten Wohnsitze.
- Die durch die Breitbandinitiative ausgelöste Marktdynamik zeigt sich auch anhand der von den
Betreibern zusätzlich zur BBA2020 gemeldeten Ausbaudaten.
- In mehr als 170 Gemeinden in denen mit Förderung ausgebaut wird, bauen Telekombetreiber auch
ohne Förderung zusätzlich aus. Zudem wird in über 160 Gemeinden ohne Förderung ausgebaut.
Insgesamt werden also in naher Zukunft Bürgerinnen und Bürger in mehr als 1.300 Gemeinden von
einer verbesserten Breitbandversorgung profitieren.
- Die Europäische Kommission stuft die Breitbandversorgung anhand von Mobilnetzen unter bestimmten
Bedingungen auch als Alternative zu leitungsgebundenen NGA-Netzen ein. In Österreich werden aktuell
99 Prozent der Haushalte mit der LTE-Mobilnetztechnologie versorgt.
- Bisher konnten im Zuge von der Breitbandinitiative Breitband Austria 2020 über 3.100 PoP-Standorte
(„Point-of-Presence“) in mehr als 1.100 Gemeinden neu mit Glasfaser angebunden werden. Die Errichtung
und Anbindung neuer Mobilfunkstationen, ist insbesondere für den zukünftigen 5G-Ausbau wichtig.
- Die externen Evaluatoren des Konsortiums der WIFO/WIK-Consult stellen Österreich und damit der
Strategie des BMVIT ein gutes Zeugnis aus. Das Ziel, 2020 nahezu flächendeckend schnelles Internet in
ganz Österreich bereit zu stellen, wird aus Sicht der Evaluatoren erreicht werden.
Zielhorizont 2030
- Bei jeder Strategie muss nach einigen Jahren die Frage gestellt werden, ob die technologischen
Prämissen, die Marktgegebenheiten sowie die politischen Ziele, auf denen sie ursprünglich aufgebaut
hat, zum jetzigen Zeitpunkt und für die absehbare Zukunft noch aktuell sind.
- Das Konsortium WIFO/WIK-Consult sieht in diesem Zusammenhang insbesondere vier Entwicklungen,
die verglichen mit der Ausgangssituation der „Breitbandstrategie 2020“ wichtige Änderungen
beziehungsweise Konkretisierungen erfahren haben:
o Die 5G-Entwicklung ist konkreter und umsetzungsnäher geworden.
o Die Orientierung an flächendeckenden Glasfasernetzen als universelle Festnetzinfrastruktur wird
immer klarer und in mehr und mehr Ländern Realität.
o Die EU ist dabei, die Breitbandziele ihrer Digitalen Agenda neu zu formulieren.
o Die Nachfrageentwicklung bestätigt den Bedarf nach Bandbreiten deutlich jenseits des 100 Mbit/s
Ziels bereits ab 2025.
- Vor diesem Hintergrund setzte auch die österreichische Bundesregierung im Regierungsprogramm
2017-2022 neue Gigabit-Ziele:
o Zügiger Ausbau einer modernen, leistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur.
o Vollständige Investition der noch verfügbaren Mittel aus der Breitbandmilliarde.
o 100 Mbit/s als 2020 Zwischenziel auf dem Weg zum Gigabit-Netzausbau.
o Österreich bis Anfang 2021 zum 5G-Pilotland machen.
5Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
o Ziel bis 2025: Landesweite Versorgung mit Gigabit-Anschlüssen, zusätzlich zur landesweiten
mobilen Versorgung mit 5G.
o Zweckbindung zukünftiger Erlöse aus Frequenzversteigerungen für den Ausbau der digitalen
Infrastruktur.
- Mit der im April 2018 vorgestellten 5G-Strategie Österreichs wurden 34 konkrete Maßnahmen
festgelegt, deren Umsetzung die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen zur Einführung des 5G-
Mobilfunkstandards ermöglichen wird.
- Zur Erreichung einer nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit von Gigabit-Anschlüssen bis 2025 sowie
der landesweiten mobilen Versorgung mit 5G ist die österreichische Breitbandstrategie jedoch neu
auszurichten.
- Aufbauend auf 5G-Strategie arbeitet das BMVIT derzeit an einer neuen Breitbandstrategie zur
Erleichterung des Ausbaus hochleistungsfähiger Breitbandinfrastruktur. Ziel sind flächendeckende
konvergente Fest- und Mobilfunknetze. Ein nationaler Schulterschluss zur Ankurbelung der
Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro ist erforderlich.
Die Serviceleistungen des Breitbandbüros
- Das Breitbandbüro innerhalb der Stabstelle Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des
BMVIT präsentierte sich in dieser Berichtsperiode auf verschiedenen Veranstaltungen der lokalen,
regionalen und nationalen Ebene als zentrale Anlaufstelle.
- Zudem wurde es um die beiden Mitarbeiter des neu eingerichteten mobilen Breitbandbüros sowie auf
EU-Ebene um das Broadband Competence Office ergänzt. Über das Jahr 2017 zusammengenommen
wurden mehr als 300 Anfragen und Beratungen zu Themen der Breitbandversorgung sowie
Breitbandförderungen abgearbeitet.
- Erstmalige sowie aktualisierte Publikationen und Werkzeuge wie Infofolder, Planungsleitfäden,
Machbarkeits-und Grobkosten-Analysen informieren über Kenndaten zu den einzelnen
Förderungsprogramme sowie Grundlagen in der Planung sowie dem Ausbau physischer Breitband-
Infrastrukturen.
- Das Breitbandbüro nahm in der Umsetzung der Kostensenkungsrichtlinie durch die Bundesländer eine
koordinierende und unterstützende Tätigkeit wahr.
- Um die potenzielle Gefahr eines Qualifizierungsengpasses bei der Errichtung und dem Betrieb der
Breitbandinfrastruktur zu verhindern, nahm der IKI-Beirat in 2017 die Arbeit auf.
- Freiwillig bereitgestellte Versorgungsinformationen von mittlerweile 182 Betreibern stellt der
Breitbandatlas in grafischer Weise dar.
- Zudem bringt sich das Breitbandbüro laufend in noch offene Maßnahmen der Breitbandstrategie ein.
6Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
1. Die sozioökonomische Bedeutung des IKT-Sektors
für Österreich
1.1. Einleitung
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) haben in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass
die Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsproduktivität global stark gestiegen sind. So werden in der Europäischen
Union bis zu einem Viertel des Wirtschaftswachstums und bis zu 40 Prozent der Produktivitätssteigerung auf
den Einsatz von IKT zurückgeführt. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) hat darüber
1
hinaus positive Effekte von IKT-Infrastruktur auf das lokale Beschäftigungswachstum festgestellt. Neben den
positiven wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Digitalisierungsgrad heute auch einen wesentlichen Einfluss
auf die soziale Prosperität eines Landes.
Die zunehmende Digitalisierung betrifft sämtliche Wirtschafts- und Lebensbereiche und schreitet mit rasantem
Tempo voran. Während der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im
privatwirtschaftlichen Sektor wie auch in der öffentlichen Verwaltung bis vor kurzem vorwiegend auf die
Verbesserung von Effizienz und Effektivität der Leistungserbringung ausgerichtet war, tragen die aktuellen
Entwicklungen rund um die Themen „Internet of Things (IoT)“, „Big Data“ und „5G“ das Potential in sich,
Leistungen nicht nur serviceorientierter und günstiger zu erbringen, sondern Prozesse, Arbeitsmodelle und
Wert-schöpfungsketten völlig neu zu denken.
Digitalisierung eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte des technologischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Wandels. Schon bisher haben uns neue Technologien vollkommen neue
Handlungsspielräume ermöglicht: Sie haben das Leben der Menschen erleichtert und verbessert. Sie haben
Weltbilder verändert und weiterentwickelt. Sie haben mitgeholfen, durch Innovationskraft und wirtschaftliche
Dynamik breiten Wohlstand und soziale Sicherheit möglich zu machen.
Nur als wettbewerbsstarker digitaler Innovationsführer wird es Österreich in Zukunft möglich sein, sein
Wirtschafts- und Sozialmodell aufrechtzuerhalten sowie Chancengerechtigkeit und soziale Sicherheit durch
innovative, leistungsfähige Unternehmen und hochwertige Arbeitsplätze abzusichern. Die digitale Infrastruktur
ist auch im Sinne der Daseins- und Zukunftsvorsorge für ganz Österreich ein unverzichtbares Rückgrat für die
künftige Entwicklung unseres Landes.
Faktoren wie Verkehrslage, Nachfragepotential, Geschäftsräume oder Konkurrenzsituation, die in der
Vergangenheit die Standortwahl von Unternehmen maßgeblich beeinflussten, verlieren in einer globalisierten,
vollständig vernetzten Welt zunehmend an Bedeutung.
Um im internationalen Wettbewerb zu reüssieren und das volkswirtschaftliche Wachstum und damit
einhergehend zukünftige Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu fördern, braucht es einen modernen Rahmen,
der den neuen Herausforderungen gerecht wird. Für die österreichischen Regionen, deren Unternehmen sowie
für Bürgerinnen und Bürger ist es daher von erheblicher Bedeutung, den Zugang zu internationalen Absatzmärkten
auszubauen und langfristig abzusichern – hierfür ist eine ausgebaute Breitbandinfrastruktur essenziell.
Österreich kann im internationalen Wettbewerb nur dann erfolgreich sein, wenn die auf Basis neuer
Schlüsseltechnologien entwickelten Anwendungen und Dienste möglichst allen Menschen im Land zur
Verfügung stehen und jede und jeder Einzelne an der Digitalisierung aktiv teilhaben kann. Als Land mit einem
1
WIFO, Österreich im Wandel der Digitalisierung (2016), S. 102
7Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
hohen Lohnniveau kann Österreich nur durch Innovation und eingesetzte Technologie den Industriestandort
weiter ausbauen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Eine moderne und leistungsstarke digitale
Infrastruktur ist dafür notwendig. Nicht zuletzt auf Grund der hohen Anzahl und geografischen Verteilung von
erfolgreichen KMUs ist eine flächendeckende Breitbandversorgung ausschlaggebend für die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung des Landes.
Diese Entwicklungen basieren auf einer dichten Vernetzung, ausreichender Übertragungskapazitäten, sicheren
Verbindungen sowie preiswertem Equipment. Für die gute Zusammenarbeit entlang der digitalen
Wertschöpfungsketten ist daher eine zuverlässiger und hochwertige Breitbandinfrastruktur Voraussetzung.
Konkret übernehmen die Breitbandinfrastrukturen die grundlegende Aufgabe der Datenübertragung und
werden vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) in einer Systematik neben
weiteren Themenfeldern den „IKT-Enabler“ zugeordnet. Dieser Bereich versteht sich dabei als Wegbereiter für
die Digitalisierung und öffnet Österreich erst die Tore zu einem florierenden Wirtschaftsstandort.
Abbildung 1: Die vier Bereiche an IKT-Aktivitäten des BMVIT und der ihnen zugeordneten Themenfelder (Quelle: BMVIT)
Um die ambitionierten Ziele der österreichischen Bundesregierung zu erreichen, ist eine regelmäßige
Evaluierung der zugrunde liegenden Instrumente notwendig. Ziel dieses Berichtes ist es, mittels eines
umfassenden Monitorings den Status quo festzuhalten, allfällige Schwachstellen aufzuzeigen und
Verbesserungen für zukünftige Maßnahmen auszuarbeiten.
Für das Monitoring der Zielerreichung bis 2020 und darüber hinaus sind im verstärkten Maß statistische Daten
notwendig um Indikatoren zur Beschreibung der Informationsgesellschaft zu definieren und messen zu können.
Integraler Bestandteil dieser Indikatoren sind die Resultate der von der Statistik Austria jährlich publizierten
Leistungs- und Strukturstatistik sowie der Erhebung über den IKT-Einsatz in Unternehmen, Haushalten und von
einzelnen Personen.
8Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
1.2. Die wirtschaftliche Bedeutung des IKT-Sektors für Österreich
Im Jahr 2008 hat die OECD den IKT-Sektor erstmals nach der Klassifikation „ISIC Revision 4“ in 21 Klassen in vier
2
unterschiedlichen Sektoren gegliedert. Dazu zählen die Produktion und Reparatur von Hardware, der
Großhandel mit IKT-Produkten, Softwareverleger, Firmen im Telekommunikationsbereich sowie IKT-
3
Dienstleistungsunternehmen.
In Österreich können die entsprechenden Daten aus der von Statistik Austria jährlich publizierten Leistungs-
4
und Strukturstatistik ermittelt werden, wobei die aktuellste Statistik das Jahr 2015 betrifft.
Im Jahr 2015 zählten in Österreich demnach insgesamt 15.916 Unternehmen zum IKT-Sektor. Das sind rund 4,8
Prozent aller Unternehmen.
272 264
269 260
248 741 721
247 720
747 715
272 245 744
747 735
IKT-Herstellung
IKT-Handel
4,8% 4,8%
4,8% 4,8%
4,7% IKT-Dienstleistung
4,7%
4,5% 4,5% Anteil der IKT- an
allen Unternehmen
12.598 12.486 13.429 13.803 14.104 14.408 14.782 14.931
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl an Unternehmen des IKT-Sektors, 2008 bis 2015 (Datenquelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik ab 2008)
Der Anteil der IKT-Unternehmen stieg besonders in den ersten Jahren der Krise recht stark und entwickelt sich
seither weitestgehend stabil. Betrachtet man den Teilsektor IKT-Dienstleistungen so stieg die Anzahl der
Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren um über 11 Prozent auf insgesamt 14.931 Unternehmen an.
Während im Teilsektor IKT-Handel die Anzahl der Unternehmen im gleichen Beobachtungszeitraum leicht
gesunken ist, hat sich der Teilsektor IKT-Herstellung stabil entwickelt.
Insgesamt beschäftigten die IKT-Unternehmen im Jahr 2015 rund 106.200 Beschäftigte, das waren 3,7 Prozent
aller unselbstständig Erwerbstätigen
2
Abrufbar unter: http://www.oecd.org/science/sci-tech/42978297.pdf
3
Auf europäischer Ebene wird diese Klassifikation durch die NACE Revision 2 und auf österreichischer Ebene nach ÖNACE 2008 abgebildet: In Österreich
handelt es sich um die folgenden ÖNACE 2008 Codes: 261-264, 268 (Produktion von IKT-Gütern); 465 und 582 Vertrieb von IKT; 611-613 und 619
(Telekommunikation); 620 und 631 (IKT-Dienstleister), 951 (IKT-Reparatur).
4
Abrufbar unter: http://statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/unternehmen_arbeitsstaetten/leistungs-_und_strukturdaten/index.html
9Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
12.128 12.239
12.067 11.986
15.755 11.315 8.833
15.212 11.600 8.752
8.850
8.694
8.677
8.428
8.678 8.565
IKT-Herstellung
IKT-Handel
3,7% 3,7%
3,6% 3,6%
3,5% 3,5%
3,5% 3,5% IKT-Dienstleistung
69.900 69.732 73.030 76.114 79.350 81.544 84.581 85.126
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 3: Entwicklung der Anzahl an Beschäftigten des IKT-Sektors, 2008 bis 2015 (Datenquelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik ab 2008)
Im Gegensatz zur Entwicklung der IKT-Unternehmen verzeichnete der Anteil der IKT-Beschäftigten erst in den
Jahren nach 2011 Zuwachs. Im Vergleich zu vor fünf Jahren bemisst der Teilsektor der IKT-Dienstleistungen mit
16,6 Prozent die größte Steigerung in der Anzahl der Beschäftigten, gefolgt von IKT-Herstellung mit 5,5 Prozent
und IKT-Handel mit 4,8 Prozent.
Die Unternehmen des IKT-Sektors in Österreich erzielten 2015 einen Umsatz von 29,4 Mrd. Euro. Gemessen am
Umsatz ist die nach OECD definierte IKT-Branche der achtgrößte Sektor Österreichs – weit größer als
beispielsweise der traditionell wichtige Sektor Beherbergung und Gastronomie.
3,5
3,0 3,2
3,1
3,3
4,1
3,4 3,2
8,4 9,0
8,7 8,9
8,1
7,0 IKT-Herstellung
6,7 7,2
4,2% IKT-Handel
4,0% 4,0% IKT-
3,9%
3,8% Dienstleistung
3,8% 3,8%
3,8% Anteil IKT- an
allen Umsätzen
14,2 14,1 13,8 14,9 15,4 16,0 16,6 16,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 4: Entwicklung der Umsatzerlöse des IKT-Sektors in Mrd. Euro, 2008 bis 2015 (Datenquelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik ab 2008)
10Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Im Vergleich zu vor fünf Jahren erhöhte sich der Umsatz der Teilsektoren IKT Handel und IKT Dienstleistungen
um 24,6 respektive 22,3 Prozent. Die IKT Herstellung verzeichnete einen starken Rückgang vom Jahr 2008 auf
2009, von dem sich der Sektor bisher nicht erholen konnte. Der Teilsektor lag 2015 weiterhin knapp 14 Prozent
unter dem Vorkrisenniveau. Dennoch entwickelte sich der Anteil der IKT-Umsätze aufgrund der starken
Zuwächse in den Teilsektoren Handel und Dienstleistungen positiv.
2015 investierten die IKT-Unternehmen zusammen mehr als 1,6 Mrd. Euro – gegenüber 2010 eine
Investitionssteigerung um 16,7 Prozent und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau von 2008.
134
234
44 271 323 111 219
94 89 34 26
29 29
29 28
36
IKT Herstellung
4,5%
4,4% 4,4% IKT Handel
4,3%
4,2%
3,9% 4,0% IKT Dienstleistung
3,8%
Anteil IKT- an allen
Investitionen
1.515 1.229 1.240 1.283 1.188 1.345 1.254 1.369
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 5: Entwicklung der Investitionen des IKT-Sektors in Mio. Euro, 2008 bis 2015 (Datenquelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik ab 2008)
Gemessen an der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten ist der IKT-Sektor in Österreich 2015 zu 5,3 Prozent an
der gesamten Wertschöpfung beteiligt und ist wiederrum weit größer als der traditionell wichtige Sektor
Beherbergung und Gastronomie.
1,3
1,2
1,3 0,8
1,3 1,3 0,8
1,2 1,1
1,1 0,8 IKT Herstellung
0,8 0,8
0,7 0,6 0,7
IKT Handel
5,3%
5,2%
IKT Dienstleistung
5,0%
4,9% 4,9% Anteil IKT- an der
4,8% 4,8% gesamten
4,7%
6,3 6,2 6,3 6,7 6,7 7,1 7,6 8,0 Wertschöpfung
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 6: Entwicklung der Bruttowertschöpfung zur Faktorkosten des IKT-Sektors in Mio. Euro, 2008 bis 2015 (Datenquelle: Statistik Austria, Leistungs- und
Strukturstatistik ab 2008)
11Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Die Bruttowertschöpfung hat sich in den letzten fünf Jahren um 25 Prozent auf mehr als 10,1 Mrd. Euro erhöht.
Der größte Zuwachs ist im Sektor IKT-Dienstleistungen zu beobachten.
Eine weitere wichtige Betrachtungsgröße zum Thema Beschäftigung ist die durchschnittliche Anzahl an
Beschäftigten des jeweiligen IKT-Teilsektors in Relation zum IKT-Gesamtsektor.
62
58
47 46 45 46 46
45
IKT Herstellung
IKT Handel
IKT Dienstleistung
12 12 11 12 12 12 12 12
6 6 5 6 6 6 6 6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 7: Durchschnittliche Beschäftigte pro IKT-Teilsektor, 2008 bis 2015 (Datenquelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik ab 2008)
Darin verzeichnete der Teilsektor IKT-Herstellung im Vergleich zu den anderen Teilsektoren hohe
Durchschnittswerte in der Anzahl der Beschäftigten. Mit nur sechs durchschnittlich Beschäftigten pro IKT-
Unternehmen verfügt die IKT-Dienstleistung über die geringste Anzahl an Beschäftigten. Gleichzeitig
verzeichnete der Teilsektor IKT-Dienstleistungen in den letzten Jahren sowohl in Bezug auf die Anzahl an
Unternehmen als auch Beschäftigten die größten Zuwachsraten aller IKT-Sektoren.
12Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
1.3. Die gesellschaftspolitische Bedeutung des IKT-Sektors für Österreich
Eine der grundlegenden Voraussetzungen, damit sich die Vielfalt an Möglichkeiten der Informations- und
Kommunikationstechnologien entfalten können, liegt in der sowohl mobilen als auch stationären
flächendeckenden Breitbandversorgung. Jedoch erst durch die aktive Nutzung dieser Technologien durch eine
Vielzahl an Akteurinnen und Akteuren in Wirtschaft und Gesellschaft lässt sich das volle Potential ausschöpfen.
Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien in den letzten Jahrzehnten hat
auch Österreichs Wirtschaft und Gesellschaft strukturell verändert. Die große Bedeutung des Internets zeigt
5
sich anhand der Erhebung zur Informationsgesellschaft durch die Statistik Austria. Der Einsatz von IKT ist für
Unternehmen unverzichtbar geworden. So gut wie jedes Unternehmen in Österreich verfügt über einen
Internetzugang und knapp neun von zehn Unternehmen haben zudem eine eigene Website. Die Nutzung von
Festnetz-Breitbandinternet als Basis für leistungsfähige und schnelle Verbindungen hat sich in über 98 Prozent
der Unternehmen etabliert. Auch mobile Breitbandverbindungen werden mittlerweile in 81 Prozent der
Unternehmen genutzt.
2017 waren 89 Prozent der Haushalte mit einem Internetzugang ausgestattet. In 71 Prozent aller Haushalte
waren feste Breitbandverbindung und in 63 Prozent aller Haushalte mobile Breitbandverbindungen in Verwendung.
Als besonders internetaffin präsentieren sich die drei Altersgruppen der unter 45-Jährigen, die zu beinahe 100
Prozent online sind. Auch die Gruppen der 55 bis 64 und die der 65 bis 74-Jährigen konnten in den letzten Jahren
starke Zuwächse verzeichnen.
99 100 97
100 98
92 91
87
83 82
77 80
69
62 Internetnutzung 2002
62
Internetnutzung 2007
49 52
44 46 Internetnutzung 2012
38 Internetnutzung 2017
32
23
15
3
16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre 65-74 Jahre
Abbildung 8: Entwicklung der Internetnutzung nach Altersgruppen, 2002 bis 2017 (Datenquelle: Statistik Austria 2017)
Das Versenden und Empfangen von E-Mails gehörte weiterhin zu den wichtigsten Zwecken der
Internetnutzung. 88 Prozent der Personen, die in den letzten drei Monaten das Internet genutzt haben, taten
dies. Darüber hinaus gaben 71 Prozent an im Internet Nachrichten gelesen zu haben. Ihre Bankgeschäfte
erledigen bereits 65 Prozent über das Internet, 58 Prozent nutzen soziale Netzwerke und 43 Prozent
Telefonieren über das Internet.
5
Abrufbar unter: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/informationsgesellschaft/index.html
13Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
In den letzten zwölf Monaten kauften 62 Prozent der Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren Waren und
Dienstleistungen online ein. Kleidung und Sportartikel wurden vor Urlaubsunterkünften (66 respektive 44
Prozent) am häufigsten über das Internet gekauft.
Im EU-Vergleich liegt Österreich bei der regelmäßigen Nutzung des Internets mit 85 Prozent knapp über dem
EU-Durchschnitt von 81 Prozent.
96 95 95 94
93 92
87 86 86 85
83 81 81
80 79 79 79 79 78
77 76 75
73 71
69 67
65
62 61
Abbildung 9: Internetnutzung durch Einzelpersonen zumindest einmal pro Woche, 2017 (Datenquelle: Eurostat1)
Um bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien Chancengleichheit zu schaffen
ermöglicht das BMVIT auf Basis des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes (FeZG) die Gewährung einer
Zuschussleistung für sozioökonomisch benachteiligte Personen.
Die Höhe der Zuschussleistung beträgt derzeit zehn Euro pro Monat. Sie ist durch die
Fernsprechentgeltzuschussverordnung vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festgelegt.
Bei Zuerkennung der Zuschussleistung erhält der Anspruchsberechtigte einen Bescheid durch die Gebühren Info
Service GmbH (GIS) ausgestellt. Erst durch Vorlage dieses Bescheides beim Betreiber seiner Wahl erwirbt sich
der Anspruchsberechtigte das Recht auf eine monatliche Gutschrift auf das ihm vom Betreiber in Rechnung
gestellte Fernsprechentgelt.
Dem BMVIT ist es gelungen, bei allen vertraglich zur Einlösung verpflichteten Betreibern zu bewirken, den
6
Anspruchsberechtigten die freie Wahl von Tarifmodellen zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen
7
bezüglich der Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt sind auf der Website des BMVIT und der GIS Gebühren
8
Info Service GmbH zu entnehmen.
6
Derzeit kann bei folgenden Betreibern Zuschussleistungen eingelöst werden: A1 Telekom Austria AG, AICALL Telekommunikations- Dienstleistungs GmbH,
Hutchison Drei Austria GmbH, Kabel-TV Amstetten GmbH, T-Mobile Austria GmbH und Mass Response.
7
Abrufbar unter: https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/recht/aut/gesetze/fezg.html
8
Abrufbar unter: https://www.gis.at/befreien/fernsprechentgelt/
14Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Festnetz- und Mobilfunk zusammengenommen gibt es in Österreich bereits mehr als 11,1 Mio.
Breitbandanschlüsse. Aus der Abbildung 10 ist ein deutlicher und kontinuierlicher Anstieg der Anzahl der
Kategorie Smartphone seit 2009 und der Kategorie mobiles Breitband seit 2015 erkennbar. Bereits mehr als
75 Prozent aller Breitbandanschlüsse werden in den Mobilfunknetzen realisiert.
5000
4500
4000
3500 Smartphone
Anschlüsse in Tausend
3000
Mobiles
2500 Breitband
xDSL
2000
1500 Kabel
1000
FTTH
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q3/2017
Abbildung 10: Breitbandanschlüssen nach Infrastruktur, 2009 bis 3. Quartal 2017 (Datenquelle: RTR-GmbH, RTR Telekom Monitor 2/2017, RTR Telekom Monitor
Jahresbericht 2012 und 2011)
Dagegen verzeichnet das leitungsgebundene Breitbandinternet nur geringe Zuwachsraten auf insgesamt
2,5 Mio. Anschlüsse. Im Vergleich zu den in Österreich führenden Festnetztechnologien (xDSL und Kabel) spielt
FTTH mit 46.000 Anschlüssen aktuell noch keine erhebliche Rolle. Auch im internationalen Vergleich liegt
Österreich beim Anteil der FTTH-Anschlüssen deutlich abgeschlagen.
100%
90%
80%
70%
60%
50% Satellit
xDSL
40%
Kabel
30%
FTTH
20%
10%
0%
Abbildung 11: Prozentueller Anteil der Breitbandanschlüsse nach Infrastruktur, 2017 (Datenquelle: OECD, Broadband Portal1)
15Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Von den insgesamt 2,5 Mio. Festnetz-Breitbandanschlüssen beziehen erst 29 Prozent der Kundinnen und
Kunden Produkte mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Mbit/s sowie acht Prozent mit Geschwindigkeiten
von mehr als 100 Mbit/s. Produkte mit Geschwindigkeiten unter 30 Mbit/s nehmen die vergangenen Jahre über
jedoch stetig ab.
107 199
2.500 84
71
40
35
340 394
2.000 190 274 495
515
≥ 100 Mbit/s
Anschlüsse in Tausend
1.500
590 ≥ 30 Mbit/s bis < 100 Mbit/s
679 726
834 821 731
≥ 10 Mbit/s bis < 30 Mbit/s
1.000
≥ 144 kbit/s bis < 10 Mbit/s
500
1.313 1.240 1.217 1.144 1.100 1.060
0
2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2017
Abbildung 12: Festnetz-Breitbandanschlüssen nach Bandbreitenkategorie, 2012 bis 3. Quartal 2017 (Datenquelle: RTR-GmbH, Telekom Monitor 2/2017)
Im europäischen Vergleich ist Österreich beim Anteil der Nutzung von Anschlüssen mit mehr als 100 Mbit/s weit
abgeschlagen. Während im EU-Durschnitt der Anteil aller festen Breitbandverbindungen mit mehr als 100 Mbit/s
bereits 20 Prozent beträgt, sind es in Österreich lediglich sieben Prozent.
65
61
55
52
49
42
38
33
30
24 24 24
22 22 22 20
18 17
15 14 14
13 12 11
8 7 2
Abbildung 13: Prozentueller Anteil der Festnetz-Breitbandanschlüsse mit mehr als 100 Mbit/s, 2017 (Quelle: Europäische Kommission, Digital Agenda
Scoreboard)
16Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
1.4. Der Networked Readiness Index des World Economic Forum
9
Das World Economic Forum ermittelt seit zehn Jahren den Networked Readiness Index (NRI) aus mehr als 139
Ländern. Zusammen erwirtschaften diese Länder rund 98 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Der NRI
fasst die Entwicklung der Länder im IKT-Bereich sowie deren Stärken und Schwächen in einem Ranking
zusammen. Er stellt ein theoretisches Modell dar, welches das Individuum, die Wirtschaft und die öffentliche
Hand berücksichtigt. All diese Faktoren werden hinsichtlich ihres Umfelds, ihrer Bereitschaft, ihrer Nutzung und
ihres Einflusses analysiert. Das Ergebnis sind Subindizes mit einzelnen Säulen, denen die einzelnen Indikatoren
zugewiesen sind. Wichtige Datenquellen für die Indikatoren sind beispielsweise Untersuchungen der
International Telecommunication Union (ITU), der Vereinten Nationen oder der Weltbank.
10
Österreich befindet sich innerhalb des NRI 2016 auf der 20. Position und ist somit unter den fortgeschrittenen
Industrienationen zu finden.
Land Rang 2016 Rang 2012 Tendenz
Singapur 1 2 ▲
Finnland 2 3 ▲
Schweden 3 1 ▼
Norwegen 4 7 ▲
USA 5 8 ▲
Niederlande 6 6 ▬
Schweiz 7 5 ▼
Vereinigtes Königreich 8 10 ▲
Luxemburg 9 21 ▲
Japan 10 18 ▲
Dänemark 11 4 ▼
Deutschland 15 16 ▲
Österreich 20 19 ▼
Belgien 23 22 ▼
Frankreich 24 23 ▼
Irland 25 25 ▬
Tabelle 1:Ausgewählte Länder des Networked Readiness Index (NRI) im Vergleich (Quelle: World Economic Forum, Global Information Technology Report 2016
und 2012)
Die Gruppe der drei führenden Staaten mit Singapur, Finnland und Schweden konnte im Betrachtungszeitraum
die Positionen halten, Österreich verlor hingegen einen Rang. Unter Berücksichtigung der EU-28-Länder belegt
Österreich den 8. Platz.
9
Abrufbar unter: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/
10
Anmerkung: Die nächste Version des NRI wird im 4. Quartal 2018 erwartet.
17Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
1.5. Digital Economy und Society Index der Europäischen Kommission
11
Im Jahr 2015 hat die Europäische Kommission den neuen Digital Economy und Society Index (DESI) mit über 30
12
Indikatoren eingeführt. Das jährlich erstellte „Digital Scoreboard “ bietet Informationen zur Entwicklung der
digitalen Wirtschaft und Gesellschaft in Europa. Der Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft umfasst
dabei folgende Themen:
1. Konnektivität,
2. Internetkompetenzen,
3. Nutzung von Online-Angeboten,
4. Entwicklungsstand der Digitaltechnik sowie,
5. Entwicklungsstand von digitalen öffentlichen Diensten.
Die „Konnektivität“ misst neben der Verfügbarkeit und Nutzung auch die Qualität der Breitbandinfrastruktur. In
der zweiten Kategorie werden die Internetkompetenzen erhoben, welche notwendig sind, um die Vorteile der
digitalen Gesellschaft zu nutzen. Die „Nutzung von Online-Angeboten“ umfasst alle Aktivitäten, von der
Verwendung von Onlineinhalten bis zu Onlineshopping und Onlinebanking. Im „Entwicklungsstand der
Digitaltechnik“ wird der Stand der Unternehmensdigitalisierung und Nutzung von Online-Vertriebskanälen
untersucht. Abschließend misst der „Entwicklungsstand digitaler öffentlicher Dienste“ den Digitalisierungsgrad
von öffentlichen Dienstleistungen und fokussiert dabei auf die Themengebiete eGovernment und eHealth.
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Digitale öffentliche Dienste Entwicklungsstand der Digitaltechnik Online-Nutzung Internetkompetenzen Konnektivität
Abbildung 14: Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2018 (DESI2018) (Datenquelle: Europäische Kommission, DESI 2018)
11
Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy-and-society-index-desi
12
Abrufbar unter: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-scoreboard
18Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Im aktuellen Index führen Dänemark, Schweden, Finnland und die Niederlande die Reihung an. Österreich
verlor im Vergleich zur Bewertung von 2014 innerhalb der EU-28-Länder einen Platz und befindet sich nunmehr
auf dem 11. Rang.
Land Rang 2018 Rang 2014 Tendenz
Dänemark 1 1 ▬
Schweden 2 2 ▬
Finnland 3 3 ▬
Niederlande 4 4 ▬
Luxemburg 5 5 ▬
Irland 6 12 ▲
Großbritannien 7 6 ▼
Belgien 8 7 ▼
Estland 9 8 ▼
Spanien 10 14 ▲
Österreich 11 11 ▬
Malta 12 9 ▼
Litauen 13 13 ▬
Deutschland 14 10 ▼
Tabelle 2 Ausgewählte Länder des Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) im Vergleich (Quelle: Europäische Kommission, DESI2018, DESI2014)
Bei Betrachtung der Detailergebnisse Österreichs in den einzelnen gewichteten DESI-Dimensionen ist im
Betrachtungszeitraum in der „Konnektivität“ eine Rangverschlechterung zu verzeichnen.
DESI-Dimension Rang 2018 Rang 2014 Tendenz
1 Konnektivität 17 15 ▼
2 Internetkompetenzen 7 7 ▬
3 Nutzung von Online-Angeboten 19 23 ▲
4 Entwicklungsstand der Digitaltechnik 10 16 ▲
5 Entwicklung von digitalen öffentlichen Diensten 8 8 ▬
Tabelle 3: Österreichs Position in den fünf Dimensionen des DESI2018 zum DESI2014 (Quelle: Europäische Kommission, DESI 2018, DESI2014)
19Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
2. Breitbandinitiative Breitband Austria 2020
2.1. Breitbandstrategie sowie Masterplan zur Breitbandförderung
13
Aufbauend auf den Zielen der „Digitalen Agenda für Europa “ der Europäischen Kommission hat das
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) im Herbst 2012 die „Breitbandstrategie
14
2020 “ vorgelegt. In dieser werden die Rahmenbedingungen für einen nahezu flächendeckenden
Breitbandausbau analysiert und ein evolutionärer Weg zur Erreichung der österreichischen Ziele formuliert:
- 2018 sollen in den Ballungsgebieten (70 Prozent der Haushalte) ultraschnelle Breitband-
Hochleistungszugänge (>100 Mbit/s) zur Verfügung stehen.
- 2020 soll eine nahezu flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit ultraschnellen Breitband-
Hochleistungszugängen (>100 Mbit/s) erreicht werden.
15
Im 2014 erschienenen „Masterplan zur Breitbandförderung “ wurden die Förderungsprogramme Access,
Backhaul und Leerrohr skizziert. Das Access Programm zielt darauf ab, leistungsfähige Glasfasernetze weiter
auszudehnen und damit größere Flächen mit zukunftssicherem Breitband-Internet zu versorgen. Das Backhaul
Programm erhöht durch die Anbindung bestehender Mobilfunkmasten sowie regionalen Netzen an das
Glasfasernetz die Leistungsfähigkeit bereits bestehender Netze. Das Leerrohr Programm richtet sich vorrangig
an Gemeinden, die ohnehin Grabungsarbeiten durchführen und dabei kostengünstig zusätzliche Rohre für neue
oder zukünftige Breitbandleitungen mitverlegen.
Der Masterplan sieht für alle Förderungsmaßnahmen folgende Umsetzungsprinzipien vor:
1. Hebelwirkung – effizienter Einsatz der Förderungsmittel durch Mobilisierung privater Investitionen
2. Wettbewerb – offene, transparente, nichtdiskriminierende Auswahlverfahren
3. Kooperation – Nutzung bestehender Kommunikationsinfrastrukturen
4. Zukunftsfähigkeit – keine „stranded investments“
5. Bedarfsorientierung – rascher Ausbau unter Berücksichtigung bestehender Kommunikationsnetze
(keine „Überbauung“)
6. Technologieneutralität – Ziel bleibt die komplementäre Versorgung über fixe und mobile
Breitbandnetze
Der unter Einbeziehung der Breitbandkoordinatorinnen und -koordinatoren aus den Bundesländern erstellte
und mit Vertreterinnen und Vertretern der Telekommunikationsbranche abgestimmte Masterplan wird in drei
Phasen (2015-2016 / 2017-2018 / 2019-2020) umgesetzt, wobei jede Phase mit einer externen Evaluierung
abgeschlossen wird.
13
Abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:de:PDF
14
Abrufbar unter: https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/publikationen/bbs2020.html
15
Abrufbar unter: https://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/publikationen/breitbandoffensive.html
20Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Der Einsatz öffentlicher Mittel wird durch das europäische Wettbewerbsrecht limitiert. Für den geförderten
Breitbandausbau hat die Europäische Kommission 2013 die „Leitlinien der EU für die Anwendung der
16
Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau “ erlassen. Diese
„Breitbandleitlinien“ bildeten auch die Grundlage für die Vereinbarkeitsprüfung durch die Europäische
Kommission, wonach der Einsatz von Förderungsmitteln zur Unterstützung von Investitionsvorhaben im
17
Rahmen der österreichischen Breitbandinitiative „Breitband Austria 2020“ notifiziert wurde.
Seit Mai 2017 ergänzt Connect – ein viertes nach De-minimis erlassenes Programm – die übrigen
Förderungsprogramme im Rahmen der Breitbandinitiative Breitband Austria 2020. Zweck des mit 30 Mio. Euro
dotierten Programmes ist die Förderung von einmaligen Kosten zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses für
Schulen und KMUs. Ziel der Förderung ist die Schaffung von nachhaltigen, punktuellen verbesserten
Versorgungssituationen.
Die aufeinander abgestimmten Förderungsprogramme werden überwiegend aus der Breitbandmilliarde des
Bundes finanziert. Daneben werden auch Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-Fonds) sowie Landesmittel eingesetzt. Nach Übertragung von 60 Mio.
Euro zur Abwicklung des Anwendungsförderungsprogrammes „austria electronic network – AT:net“ an das BKA
stehen aus der Breitbandmilliarde inklusive der Mittel aus dem ELER-Fonds sowie der Landesmittel rund 980
Mio. Euro zur Disposition.
Tabelle 4 zeigt die Mittelherkunft und das nach der Übertragung revidierte Ausschreibungsvolumen über die
18
gesamte Programmlaufzeit der Breitbandinitiative Breitband Austria 2020.
Breitband Austria 2020 Rechtsgrundlage 2016 2017 2018 2019 2020
Bund BBA2020_Access EK-Beschluss
BBA2020_Backhaul EK-Beschluss
280 180 180 200 100
BBA2020_Leerrohr EK-Beschluss
BBA2020_Connect De-minimis-VO
EU ELER-Fonds ELER-Verordnung 13,3 13,3
Länder ELER-Kofinanzierung Landesrecht 6,7 6,7
Summe 280 200 200 200 100
Tabelle 4: Finanzplan in Mio. Euro über alle Förderungsinstrumente (Quelle: BMVIT)
16
Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0126(01)&from=DE
17
Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/259470/259470_1726891_122_2.pdf
18
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Bundesbudget sowohl Anteile für die Abwicklung der Förderungsprogramme durch die
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) als auch Anteile für begleitende Maßnahmen enthalten sind.
21Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Im Zuge der Breitbandinitiative Breitband Austria 2020 hat das BMVIT seit Mitte 2015 österreichweit 514,1 Mio.
Euro an Förderungsmittel für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur ausgeschrieben.
Ausschreibungs- Gewährung BM Prozentuell
BBA2020 Reporting
volumen Ende 2017
Access 1. Ausschreibung 2015 96,1 Mio. Euro 95,7 Mio. Euro 99,6 %
ELER Access 1. Ausschreibung 2016 26,0 Mio. Euro 25,2 Mio. Euro 96,9 %
Access 2. Ausschreibung 2017 78,3 Mio. Euro 60,8 Mio. Euro 77,7 %
Backhaul 1. Ausschreibung 2015 96,1 Mio. Euro 67,2 Mio. Euro 69,9 %
Backhaul 2. Ausschreibung 2016 58,8 Mio. Euro 18,5 Mio. Euro 31,5 %
Leerrohr 1. Ausschreibung 2015 40,0 Mio. Euro 16,3 Mio. Euro 40,8 %
Leerrohr 2. Ausschreibung 2016 60,6 Mio. Euro 21,8 Mio. Euro 36,0 %
Leerrohr 3. Ausschreibung 2016 29,4 Mio. Euro 24,3 Mio. Euro 82,7 %
Leerrohr 4. Ausschreibung 2017 28,8 Mio. Euro 14,3 Mio. Euro 49,7 %
19
Connect (offener Ausschreibung) (30,0 Mio Euro ) 0,2 Mio. Euro
Summe 514,1 Mio. Euro 344,3 Mio. Euro 67,0 %
Tabelle 5:Bisherige Ausschreibungen in der Breitbandinitiative BBA 2020, 2017 (Quelle: BMVIT)
Der Aufteilungsschlüssel der Breitbandmilliarde wurde 2014 anhand der aktuellen Versorgungs- sowie
Planungsdaten der Telekommunikationsbetreiber errechnet. Diese wurden aus den Ergebnissen der
abgeschlossenen Förderungsperiode Breitband Austria 2013 sowie der im Wege einer Betreiberkonsultation
gemeldete Daten eruiert. Das Ergebnis dieses Prozesses wurde durch die Befassung der von den
Landeshauptleuten eingesetzten Breitbandkoordinatoren auf Landesebene plausibilisiert.
Die Breitbandinitiative hat am österreichischen Telekommunikationssektor eine bis dato nie dagewesene
Dynamik ausgelöst. Im Rahmen der bisherigen Ausschreibungen aus der Breitbandmilliarde haben 173
Förderungsnehmer in 534 Projekten Förderungszusagen über insgesamt 344,3 Mio. Euro erhalten.
Berechnungen der Evaluierung der ersten Phase der Breitbandinitiative BBA 2020 zufolge werden dadurch
weitere Investitionen in der zweieinhalbfachen Höhe der Förderungsmittel initialisiert – was über 860 Mio. Euro
entspricht. Dabei nicht berücksichtigt sind indirekte Effekte wie induzierte Investitionen in Gebieten, die an
20
Förderungsgebiete angrenzen.
Die Förderungsmittel werden in den Bundesländern unterschiedlich stark nachgefragt. Neben der
Breitbandinitiative des Bundes gibt es in Österreich einige Bundesländer mit eigenen Strategien für den
Breitbandausbau. Diese Länder stellen mitunter auch eigene Landesmittel für den Ausbau zur Verfügung.
Dieser Umstand macht sich auch bei der Inanspruchnahme der Förderungsmittel bemerkbar.
Während die A1 Telekom Austria AG mit dem Ausbau ihrer FTTC-Technologie der einzige bundesweite
Förderungsnehmer ist, forcieren die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol den Glasfaser
21
Breitbandausbau. Diese drei Länder haben daher auch die meisten Förderungsgelder in Anspruch genommen.
19
Die Connect Ausschreibung ist mit insgesamt 30,0 Mio. Euro dotiert, jedoch erfolgte keine Aufteilung der Mittel anhand des Aufteilungsschlüssels der
Breitbandmilliarde auf Bundesländerebene.
20
WIK/WIFO, Evaluierung der Breitbandinitiative (2017), S.119
21
Oberösterreich und Tirol haben mehr Mittel in Anspruch genommen als jeweils ausgeschrieben waren.
22Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Damit geraten Ausbauvarianten zunehmend in den Blickpunkt, die konsequent auf den direkten
Glasfaserausbau setzen und dabei mögliche Brückentechnologien überspringen.
Ausschreibungs- Gewährung BM Prozentuell
BBA2020 Reporting
volumen
Burgenland 11,4 Mio. Euro 7,2 Mio. Euro 63,2 %
Niederösterreich 131,0 Mio. Euro 97,6 Mio. Euro 74,5 %
Wien 25,7 Mio. Euro 3,1 Mio. Euro 12,1 %
Kärnten 58,8 Mio. Euro 31,0 Mio. Euro 52,7 %
Steiermark 124,1 Mio. Euro 49,7 Mio. Euro 40,0 %
Oberösterreich 89,2 Mio. Euro 91,0 Mio. Euro 102,0 %
Salzburg 9,2 Mio. Euro 7,8 Mio. Euro 84,8 %
Tirol 51,2 Mio. Euro 51,7 Mio. Euro 101,0 %
Vorarlberg 13,5 Mio. Euro 5,2 Mio. Euro 38,5 %
Summe 514,1 Mio. Euro 344,3 Mio. Euro 67,0 %
Tabelle 6: Bisherige Verteilung der Breitbandmilliarde zwischen den Bundesländern, 2017 (Quelle: BMVIT)
Um den Glasfaserausbau vor allem in schwer zu erschließenden Regionen voranzutreiben, haben neben
Niederösterreich (NÖGIG – Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft mbH) mittlerweile auch
Kärnten (BIK – Breitbandinfrastruktur Kärnten GmbH) und Oberösterreich (Fiber Service OÖ GmbH) eine
Landesgesellschaft gegründet. Darüber hinaus prüft derzeit auch die Steiermark die Gründung einer
Landesgesellschaft. Salzburg als bestversorgtes Bundesland in Österreich setzt hingegen auf die landeseigenen
Salzburg AG als Investor im Wettbewerb und Tirol verfolgt ein eigenes Konzept mittels direkter Förderungen an
die Gemeinden.
23Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
2.2. Stand und Entwicklung der Festnetz-Breitbandversorgung
Bei der Konzeptionierung der Breitbandinitiative Breitband Austria 2020 im Jahr 2014 konnten von den in
Summe rund 9,7 Mio. Haupt- und Nebenwohnsitzen in Österreich anhand von der von der Europäischen
Kommission definierten Kriterien rund 1,9 Mio. Wohnsitze als förderungsfähig identifiziert werden.
Von den bisherigen Förderungszuschlägen profitieren insgesamt knapp 690.000 Österreicherinnen und
Österreicher in 1.140 Gemeinden. Das sind über 36 Prozent der bisher unterversorgten Wohnsitze.
Unterversorgte Ausbau Neuversorgte Prozentuelle
BBA2020
Wohnsitze, Gemeinden, Wohnsitze, Verbesserung,
Reporting
Stand 2014 Stand 2017 Stand 2017 Stand 2017
Burgenland 41.700 39 11.500 27,6 %
Niederösterreich 475.900 237 179.100 37,6 %
Wien 99.600 42 21.100 21,2 %
Kärnten 216.300 90 99.900 46,2 %
Steiermark 457.300 179 101.300 22,2 %
Oberösterreich 318.800 257 135.000 42,3 %
Salzburg 32.800 66 4.300 13,1 %
Tirol 198.400 183 114.900 57,9 %
Vorarlberg 50.000 47 22.500 45,0 %
Summe 1.890.800 1.140 689.600 36,5 %
Tabelle 7: Entwicklung der versorgten Wohnsitze infolge des Förderungsprogramms BBA2020 (Quelle: BMVIT)
Durch die öffentlichen Investitionen wurden Berechnungen des Konsortium WIFO/WIK-Consult zufolge weitere
Investitionen in der zweieinhalbfachen Höhe der Förderungsmittel initialisiert. Die durch die Breitbandinitiative
ausgelöste Marktdynamik zeigt sich anhand der von den Betreibern zusätzlich zur BBA2020 gemeldeten
Ausbaudaten.
In mehr als 170 Gemeinden in denen mit Förderung ausgebaut wird, bauen Telekombetreiber auch ohne
Förderung zusätzlich aus. Zudem wird in über 160 Gemeinden ohne Förderung ausgebaut. Insgesamt werden
also in naher Zukunft Bürgerinnen und Bürger in mehr als 1.300 Gemeinden von einer verbesserten
Breitbandversorgung profitieren.
24Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
Abbildung 15: NGA-Ausbau auf Gemeindeebene - gefördert und nicht gefördert (Quelle: BMVIT)
Zur Analyse der flächendeckenden Versorgung von Breitbandanschlüssen hat das BMVIT Österreichs Fläche in
22
rund 8,4 Mio. 100x100 Meter große Rasterzellen unterteilt. Interessant ist die Betrachtung der Anteile der
Breitbandversorgung anhand von unterschiedlichen Wohnsitzdichten. Knapp 700.000 der rund 8,4 Mio. 100x100
Meter große Rasterzellen in Österreich gelten als bewohnt. Davon nimmt die Kategorie „bis zu 2 Wohnsitze“
mit etwas mehr als einem Viertel den höchsten Anteil ein. Mit den Rasterzellen „bis zu 10 Wohnsitze“ erreichen
die drei kleinsten Kategorien bereits einen Anteil von rund 70 Prozent aller Rasterzellen.
In dicht besiedeltem Gebiet (über 200 Wohnsitze pro Rasterzelle) werden bereits praktisch alle Wohnsitze mit
ultraschnellem Breitbandinternet versorgt. In Rasterzellen mit einer sehr niedrigen Dichte (bis 2 Wohnsitze)
werden hingegen erst rund ein Viertel der Wohnsitze mit mehr als 100 Mbit/s versorgt.
Wie der Abbildung 16 entnommen werden kann erfolgt bis zu einer Wohnsitzdichte von 20 Wohnsitzen der
Ausbau der Breitbandversorgung mehrheitlich im Zuge der Breitbandinitiative Breitband Austria 2020. In den
Kategorien darüber erfolgt der Ausbau mit mehr als 100 Mbit/s mehrheitlich privatwirtschaftlich.
22
Siehe auch: http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/regionalstatistische_rastereinheiten/index.html
25Breitband in Österreich – Evaluierungsbericht 2017
100%
90%
80% Zuwachs Ausbau
70% BBA2020
60%
Zuwachs Ausbau
50% Privatwirtschaftlich
40%
Ausgangssitutation
30% der Versorgung mit
mehr als 100 Mbit/s
20%
10%
0%
Abbildung 16: Zuwächse der Festnetz-Breitbandversorgung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als 100 Mbit/s in den jeweiligen Wohnsitze-Kategorien
(Datenquelle: BMVIT)
Im Verhältnis zur Anzahl der Wohnsitze in der jeweiligen Kategorie nahm die Versorgung der Rasterzellen mit
einer Wohnsitzdichte von elf bis 20 Wohnsitzen am stärksten zu. Es zeigt sich, dass der Lenkungseffekt der
Breitbandinitiative funktioniert und der Ausbau mit Förderungsmitteln tatsächlich dort stattfindet, wo er
aufgrund einer niedrigen Wohnsitzdichte marktwirtschaftlich nicht darstellbar ist.
99% 99% 99%
94%
88% 90%
80%
72% 73%
2015
58%
2016
50%
42% 2017
≥ 0 Mbit/s bis 10 Mbit/s ≥ 10 Mbit/s ≥ 30 Mbit/s ≥ 100 Mbit/s
Abbildung 17: Entwicklung der Versorgungsanteile an Wohnsitzen in den Geschwindigkeitskategorien (Quelle: BMVIT, Breitbandatlas)
26Sie können auch lesen