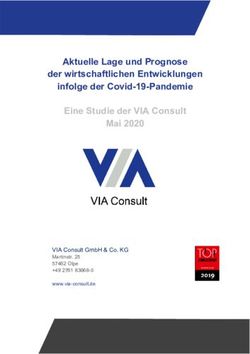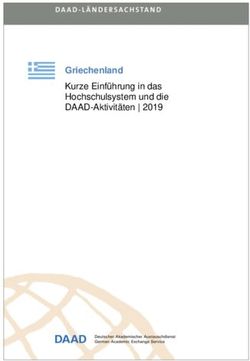Das Klima unter der Lupe - Beobachten - Modellieren - Beraten - Deutscher Wetterdienst
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Was ist Klima?
„Der Ausdruck Klima bezeichnet in seinem allgemeinsten Sinne alle Ver-
änderungen der Atmosphäre, die unsere Organe merklich afficieren…“
Alexander von Humboldt (1769 - 1859), deutscher Naturforscher
Für die Geschichte des Klimas sind alte Bäume leben-
de Zeugen. Die ältesten Linden und Eichen Deutsch-
lands haben in ihren Wachstumsringen tausend und
mehr Jahre archiviert. Mal hat die Witterung das
Pflanzenwachstum gefördert, mal behindert, auf
Warmperioden folgten „kleine Eiszeiten“.
Wetter, Witterung, Klima: Mit diesen drei Begriffen
beschreibt die Meteorologie und Klimatologie Vor-
gänge, die in der Atmosphäre in verschieden langen
Zeiträumen ablaufen. Das Wetter umfasst wenige
Tage, die Witterung bis zu einer Jahreszeit, das Klima
Jahre bis hin zu geologischen Zeitaltern. Die Weltor-
ganisation für Meteorologie (WMO) definiert „Klima“
wissenschaftlich präzise als „Synthese des Wetters
über einen Zeitraum, der lange genug ist, um dessen
statistische Eigenschaften bestimmen zu können“.
Die Natur steuert das Erdklima auf vielfältige Wei-
se, auch über die Konstellation unseres Planeten im
Sonnensystem: Die Neigung der Erdachse zur Son-
ne und ihr Abstand von der Sonne sorgt in unseren
Breitengraden für vier Jahreszeiten mit ausgeprägten
Witterungsunterschieden. Bereits antike Denker wie
Aristoteles (384–322 v. Chr.) erkannten diesen Zusam-
menhang, weshalb „Klima“ vom altgriechischen Wort
klĩma für „Neigung“ kommt.
Blick vom Wendelstein Foto Claudia Hinz
2▲D
er Hitzesommer 2003 brach alle Rekorde: Die rechte Karte zeigt die ▲ Die Wetter- und Klimabeobachtung des DWD unterstützt die Wind-
Temperaturabweichung im Sommer 2003 vom Temperaturmittel der kraftnutzung in Deutschland
Sommer der Referenzperiode 1961 bis 1990 (linke Karte)
Das Klima der Erde ändert sich permanent, die Kli- Der Deutsche Wetterdienst konnte durch wissen-
matologie nennt das natürliche „Klimavariabilität“. schaftliche Auswertung seiner Archive zeigen, wie sich
Dies geschieht auf kürzerer Zeitskala durch vielfältige das Klima in Deutschland geändert hat: Seit 1881 stieg
Wechselwirkungen im Klimasystem, längerfristig zum die Jahresmitteltemperatur um 1,2 Grad Celsius, also
Beispiel durch Vulkanausbrüche, Drift der Kontinente schneller als der weltweite Durchschnitt von etwa 0,8
und Veränderungen der Erdbahn. Doch seit Beginn Grad (seit 1900). Zudem nahmen im Winter die durch-
der Industrialisierung dreht auch der Mensch an der schnittlichen Niederschlagsmengen um fast zwanzig
Klimaschraube. Seitdem wird es wärmer. Ein un- Prozent zu, im Sommer blieben sie ungefähr gleich.
übersehbares Zeichen ist das rapide Abschmelzen
von Gletschereis und Meereis in der Arktis. Doch wie Auf den Klimawandel und seine Folgen für unser
stark ist der Mensch dafür verantwortlich? Welcher Land konzentriert sich der Deutsche Wetterdienst als
Anteil ist natürlich? Die Suche nach den Ursachen ist staatlicher Klimaberater. Der Bedarf an dieser Bera-
eine zentrale Aufgabe der Klimaforschung. tung wächst. Die Bundesregierung benötigt sie für
ihre 2008 gestartete „Deutsche Anpassungsstrategie
Der Klimawandel ist global, aber wird er auch unser an den Klimawandel“. Kommunen und Länder wol-
direktes Lebensumfeld in Deutschland beeinflussen? len etwa wissen, wie sie Hochwasserschutzanlagen,
Bei Fragen zu weltweiten und hiesigen, regionalen Deiche oder kommunale Abwassersysteme für die
Folgen des Klimawandels kommt der Deutsche Wet- kommenden Jahrzehnte auslegen müssen. Fehlent-
terdienst (DWD) ins Spiel. Er überwacht das Klima in scheidungen können schlimmstenfalls sogar Leben
Deutschland und nutzt Klimamodelle, um zukünftige von Menschen gefährden.
Klimaänderungen abschätzen zu können. Damit kön-
nen Aussagen über Auswirkungen des Klimawandels Ein Großteil der Naturkatastrophen in Deutschland
auf unsere Umwelt gemacht werden. Die Qualität der wird vom Wetter verursacht. Deshalb suchen Ent-
Klimamodelle lässt sich überprüfen, indem man die scheider aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Klimaveränderung der Vergangenheit mit dem Modell den Rat der Klimaexpertinnen und -experten des
nachberechnet und das Ergebnis mit der tatsäch- Deutschen Wetterdienstes. Andere Beispiele: Bei der
lichen Klimaveränderung in diesem Zeitraum ver- Planung einer Photovoltaikanlage können Daten des
gleicht. Hierfür sind die Klimaarchive des Deutschen Deutschen Wetterdienstes über die jährliche Sonnen-
Wetterdienstes besonders wertvoll. Bei einigen seiner einstrahlung in einzelnen Regionen genutzt werden.
Stationen reichen die „Zeitreihen“ an Wetterbeobach- Für die Planung von Windenergieanlagen bietet der
tungen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Seit Mitte des Deutsche Wetterdienst detaillierte Winddaten an. Alle
19. Jahrhunderts kamen mit dem wachsenden mete- Dienstleistungen basieren auf den technischen Res-
orologischen Messnetz immer mehr und genauere sourcen und internationalen Kooperationen, über die
Wetterdaten hinzu. nur ein großer nationaler Wetterdienst verfügt.
3Die Vermessung des Klimas
„Die Klimalehre wird… die Aufgabe haben, uns den mittleren Zuständen der
Atmosphäre über verschiedenen Teilen der Erdoberfläche bekannt zu machen.“
Julius Ferdinand von Hann (1839-1921), österreichischer Meteorologe
▲ Der DWD sammelt und analy- Besonders wichtige „Klimaparameter“ sind Tempe-
siert Niederschlagsdaten aus raturen und Niederschlagsmengen. Sie werden über
aller Welt: Die Grafik zeigt die
größere Zeiträume gemittelt. Ändern sie sich langfris-
Abweichung im Frühjahr 2013
tig, kann sich das direkt auf unsere Lebensumstände
vom langjährigen Frühjahrs-
mittel des Zeitraums 1961 auswirken, zum Beispiel weil die Winter milder werden
bis 1990 oder wir häufiger mit Hitzewellen rechnen müssen.
Hinzu kommen eine Reihe weiterer Parameter, die das
Klima beschreiben. Die Bodentemperatur Ende April
zum Beispiel stieg in Deutschland von 1962 bis 2012
von durchschnittlich 11 °C auf 16 °C, was sich auf das
Pflanzenwachstum und damit auf die Landwirtschaft
auswirkt. Dafür hat die Schneebedeckung hierzulande
im Winter im Mittel abgenommen, mit Folgen für den
Wintertourismus.
4Aus der Vielzahl unterschiedlicher meteorologischer
Messsysteme kommen weitere Daten hinzu. Um den
Klimawandel dingfest zu machen, muss man aller-
dings die heutigen Klimadaten verlässlich mit frühe-
ren Daten vergleichen können. Dazu hat die Weltorga- ◀ Der DWD erstellt im Auftrag der
nisation für Meteorologie (WMO) eine dreißigjährige Weltorganisation für Metorolo-
gie jährlich einen Bericht über
Zeitreihe aus der Vergangenheit als Vergleichsbasis
das Klima in Europa und dem
definiert. Diese Referenzperiode umfasst den Zeit-
Mittleren Osten
raum von 1961 bis 1990 und definiert den klimatolo-
gischen „Normalzustand“. Der Deutsche Wetterdienst
verwendet zusätzlich Klimadaten der jüngeren Perio-
de 1981-2010, da in diese viele der wärmsten Jahre
seit Aufzeichnungsbeginn fallen. Sie beschreibt
also unser heutiges Klima besser.
werden Klimadaten verarbeitet. Entsprechend im-
Bäume und allgemein Pflanzen sind gute mens ist der Aufwand, der zum Beispiel hinter dem
Klimabotschafter. Die langfristige Beob- schlichten ersten Satz des Bulletins von 2007 steckt:
achtung der jährlichen Vegetationsphasen „In vielen Orten unserer Region war es das wärmste
ausgewählter Pflanzen gibt verlässliche oder zweitwärmste Jahr seit Anfang der Messungen.“
Hinweise darüber, ob sich das örtliche Klima Der Deutsche Wetterdienst spielt als einer der welt-
verschiebt. Heute blühen zum Beispiel die weit größten nationalen Wetterdienste eine zentrale
Apfelbäume in Deutschland im Schnitt 14 Tage Rolle im internationalen Daten- und Informationsaus-
früher als vor fünfzig Jahren. Die Lehre von tausch. Nur solche Anstrengungen verschaffen den
den pflanzlichen Erscheinungen, die Phänologie, Klimatologen eine möglichst genaue Datenbasis, mit
leistet also einen bedeutenden Beitrag zur Klimato- der sie den globalen Klimawandel bis ins regionale
logie. Deshalb unterhält der Deutsche Wetterdienst in Detail verfolgen können. Die Analysen des Klimabulle-
Deutschland rund 1300 phänologische Beobachtungs- tins fließen wiederum in den jährlichen WMO-Bericht
stellen. zum Zustand des globalen Klimas ein.
Diese Beispiele zeigen die Vielfalt an Daten, die
Klimatologen des Deutschen Wetterdienstes zu einer
Gesamtschau verarbeiten. Sie prüfen diese auf ihre
Qualität und bringen sie in eine einheitliche Darstel- Klimawandel in Deutschland:
lungsform. Ein wichtiges Ergebnis ist der Deutsche •T
emperaturanstieg um 1,2 °C seit dem Jahr 1881
•A
nstieg der Niederschlagsmenge um fast 20 Prozent im Winter,
Klimaatlas. Dort können alle Online-Besucher das
im Sommer unverändert
Klima ihrer Region in der Vergangenheit, Gegenwart
•A
pfelblüte im Schnitt 14 Tage früher als vor fünfzig Jahren
und Zukunft ansehen, dargestellt in Karten und Dia- •S
chneebedeckung nimmt im Schnitt ab
grammen. Da die Vielzahl an Informationen schwer zu
Globaler Klimawandel:
überschauen ist, fasst der Deutsche Wetterdienst sie
•T
emperaturanstieg um 0,8 °C seit 1900
in speziellen Dokumenten zusammen. Diese vermit- •2
001-2010 im Schnitt wärmste Dekade seit Beginn der
teln Bürgerinnen und Bürgern sowie Nutzern aus regelmäßigen Wetteraufzeichnungen
Politik, Wirtschaft und Forschung ein Gesamtbild vom •R
ekordverlust an arktischem Meereis im Jahr 2012
Zustand des Klimas. Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen in der
Atmosphäre im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor 1750:
Das Klima kennt keine Landesgrenzen. Folgerichtig •K ohlendioxid: 2012 um 41 Prozent höher
nimmt der Deutsche Wetterdienst seine internationale •M ethan: 2012 um 161 Prozent höher
• L achgas: 2012 um 20 Prozent höher
Verantwortung sehr ernst. Er gibt jedes Jahr im Auf-
trag der WMO das Klimabulletin für die „Region VI“ Meeresspiegelanstieg:
der WMO heraus, die Europa und den Nahen Osten um durchschnittlich 3 mm pro Jahr durch abschmelzende
Gletscher und Wärmeausdehnung des Wassers
mit rund 50 Ländern umfasst. Aus diesen Ländern
5Das Klima gestern und heute
„Klima ist eine Funktion der Zeit. Es wechselt;
es ist Gegenstand von Fluktuationen; es hat eine Geschichte.“
Emmanuel Le Roy Ladurie (*1929), französischer Historiker
°C
Es wird wärmer in Deutschland: Die Grafik zeigt die Jahresmitteltemperaturen von 1881 bis 2012. Die schwarze Linie steht für den Mittelwert
der neueren Referenzperiode 1981 bis 2010. Die rote Linie stellt den langfristigen Trend als 30jähriges, gleitendes Mittel dar. Auf der rechten
Achse können die Jahresmitteltemperaturen auch als Abweichung von dem Mittelwert der Referenzperiode abgelesen werden.
Nicht nur alte Bäume sind lebende Archive der Klima- vor allem die Klimadaten aus Deutschland, aber auch
geschichte. Auch die Datenarchive des Deutschen Wet- umfangreiche Datenbestände aus Europa und der gan-
terdienstes „leben“ gewissermaßen, denn sie wachsen zen Welt. Basis der Daten sind konventionelle Beobach-
Jahr für Jahr. Gigantische hundert Milliarden Wetter- tungen über dem Land und Meer und zunehmend auch
beobachtungen aus dem Stationsnetz hat der Deutsche Fernerkundungsdaten von Satelliten und Wetterra-
Wetterdienst inzwischen angesammelt. daranlagen. Ein wichtiger Bestandteil des CDC ist ein
Datenkatalog mit einer standardisierten Beschreibung
Mit seinem Climate Data Center (CDC) (Kasten S. 19) aller vorhandenen Daten.
ermöglicht der Deutsche Wetterdienst den zentralen
Zugang auf alle historischen und aktuellen Klimada- Die wissenschaftlich aufgearbeiteten Klimadaten für
ten, die in seinem Archiv liegen. Das CDC wird künftig Deutschland reichen derzeit rund 130 Jahre zurück,
auch die projizierten Klimadaten enthalten. Das betrifft für einzelne Stationen sogar noch deutlich länger.
6Im Seewetteramt des DWD in ▶
Hamburg lagern rund 37000
Schiffstagebücher, die Schritt
für Schritt für die Klimafor-
schung erschlossen werden.
Besonders wertvoll sind die Wetteraufzeichnungen des
meteorologischen Observatoriums auf dem Hohenpei-
ßenberg seit 1781 und die Beobachtungen des Observa-
toriums Lindenberg, das unter anderem in der „Linden-
berger Säule“ einen 35 Kilometer hohen Ausschnitt der
Atmosphäre überwacht.
Allerdings muss man historische Aufzeichnungen
erst verwendbar machen. Die Klimatologen prüfen
sie dazu wissenschaftlich und bringen sie in eine mit
heutigen Daten vergleichbare Form. Dazu gehört ein
möglichst genaues Wissen über die Lage einer Station
und die dort eingesetzten Messinstrumente. Bei der
historischen Zeitreihe vom Hohenpeißenberg sind über monatliche Niederschlagsmessungen. So liegen
„Metadaten“, die zum Beispiel Informationen über die von fast 90 000 Klimastationen aus aller Welt Nieder-
alten Messgeräte enthalten, gut dokumentiert. Doch schlagsdaten vor. Inzwischen reicht das WZN-Archiv
bei vielen anderen Datenquellen, vor allem in abgele- bis etwa 1840 zurück. Derzeit arbeiten die Klimatolo-
genen Regionen der Erde, müssen die Klimatologen gen des DWD auch daran, die globalen Niederschlags-
mit detektivischem Spürsinn vorgehen. daten über Land mit den Niederschlagsdaten über
den Ozeanen zu verknüpfen, die die Wettersatelliten
Weltweit einzigartig sind die Klimadatensammlun- liefern. Diese Herausforderung ist komplex, wird aber
gen des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie ein wesentlich genaueres Bild der Niederschläge auf
(WZN) und des globalen Maritimen Klimaarchivs der Erde liefern.
(Global Collection Centre, GCC) in Hamburg. Beide
Einrichtungen sind beim DWD angesiedelt. Mit ihnen Im Maritimen Klimaarchiv des Deutschen Wetter-
übernimmt der Deutsche Wetterdienst zwei zentrale dienstes werden alle weltweit verfügbaren Daten zum
Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit in der Wetter auf den Ozeanen und in den Küstengewässern
WMO. Das WZN besitzt bislang von rund 90 Prozent gesammelt. Wie bei Landstationen ist auch hier das
aller Staaten der Erde aktuelle und historische Daten Archivieren der „Metadaten“ wichtig. Dazu zählt zum
Beispiel die Bauform des Schiffes, denn sie bestimmt,
wie hoch über der Meeresoberfläche ein Beobachter
mit seinen Instrumenten steht.
Die Klimaarchive des DWD
Nationale Klimadaten: Neben dem Sammeln der aktuellen Daten ist aus kli-
• c a. 100 Milliarden Beobachtungen aus Deutschland matologischer Sicht auch das Aufarbeiten historischer
• c a. 5000 Regalmeter historische Aufzeichnungen Informationen in alten maritimen Beobachtungsta-
Globale Niederschlagsdaten: gebüchern wichtig. 37 000 solcher meteorologischer
•N
iederschlagsdaten seit 1840 mit über 40 Millionen monatlichen Schiffsjournale liegen im Hamburger Archiv des Deut-
Niederschlagsmengen von knapp 90 000 Stationen aus aller Welt schen Wetterdienstes. Sie werden nach und nach elek-
Maritim-klimatologische Daten: tronisch erfasst. Das älteste Buch ist von 1829 und
•p ro Jahr über 1,5 Millionen Schiffswettermeldungen aus fast stammt von der Bark Henriette. Solche historischen
20 Ländern Quellen dokumentieren auch die damalige Häufigkeit
• insgesamt 300 Millionen Wettermeldungen von Schiffen,
extremer Wettereignisse wie Orkane oder tropische
Automaten und Bojen aus allen Seegebieten seit 1850
Wirbelstürme.
7Woher kommen die Daten?
„Die Atmosphäre bildet einen riesigen Ozean über uns,
aber einen wenig erforschten Ozean.“
Baden F. S. Baden-Powell (1860-1937), britischer Major und Flugpionier
8◀ Satellitenblick
auf die Erde
Der Wetterradarverbund des DWD zeigt die Nieder- Wichtig für Photovoltaik-Betreiber: Der DWD berechnet die Globalstrahlung, hier für
schlagsmengen einer Kaltfront am 14. Juli 2010 das Jahr 2012
Die Wetterdaten für die klimatologischen Archive Satelliten werden wichtiger
liefern die Wetter- und Klimastationen sowie das Wet- Die Klimaüberwachung per Satellit ist ein noch sehr
terradarsystem des Deutschen Wetterdienstes. Hinzu junges Gebiet. Satelliten haben den Vorteil, dass sie
kommen Meldungen von Schiffen, Driftbojen, Flug- die Erdatmosphäre großflächig von oben überwachen.
zeugen, Radiosonden an Wetterballons und Satelliten Einen besonders großen Abschnitt der Erdoberfläche
(Details beschreibt die DWD-Broschüre „Das Wetter überblicken geostationäre Wettersatelliten wie die
im Visier“). Inzwischen gewinnt der Blick per Satellit europäische Meteosat-Serie. Sie „parken“ in etwa
aus dem All auf die Erde auch in der Klimatologie an 36 000 Kilometern Höhe am Himmel und können so
Bedeutung. Bei der Wettervorhersage ist er längst ihr Gebiet rund um die Uhr beobachten. Polarumlau-
unverzichtbar. fende Satelliten wie die europäische Metop-Serie, die
nur rund 800 Kilometer hoch über die Pole hinweg zie-
International spielt ein weltweites Netz von rund hen, scannen dagegen die gesamte Erde schrittweise
2500 Landstationen eine besondere Rolle. Jede die- in schmalen Streifen ab.
ser Stationen meldet automatisch monatlich Daten in
einem standardisierten Format. Der Deutsche Wetter- Wettersatelliten liefern flächendeckend Informationen
dienst gehört zu den nationalen Wetterdiensten, die zum Beispiel über Temperatur, Wasserdampfgehalt,
diese Daten im Auftrag der WMO akribisch prüfen Niederschlag, Strahlung und Windverhältnisse. Satel-
und archivieren. liten erfassen zudem großflächig die Bedeckung mit
9Wolken oder Schnee. Helle Wolken und weiße Land- quellen ausgleichen lassen. Für die Klimatologen kann
flächen wirken wie Spiegel, die einen beachtlichen aber schon eine durchgehend um ein Zehntel Grad
Teil der Strahlung von der Sonne ins All reflektieren. zu hoch liegende Temperatur die Frage entscheiden,
Diese kühlende „Klimaanlage“ hat großen Einfluss auf ob sich das Klima ändert. Also müssen sie Messfehler
das Erdklima. akkurat herausrechnen.
Allerdings genügt es nicht, einfach die Daten der Wet- Satellitendaten liefern eine Fülle wichtiger Informati-
tersatelliten zu archivieren. Ihre Bahnen schwanken on, die den Klimatologen anders nicht zugänglich sind.
und ihre Instrumente altern mit den Jahren. Für die Da ihre Auswertung besonderes Fachwissen erfordert,
tägliche Wettervorhersage ist das kein Problem, da arbeiten Experten mehrerer europäischer Staaten
sich die Abweichungen anhand anderer Informations- unter dem Dach der Satellitengestützten Klimaüber-
wachung (Satellite Application Facility on Climate
Monitoring, CM SAF) zusammen. Unter der Federfüh-
rung des Deutschen Wetterdienstes unterstützt das
Das Messnetz des CM SAF seit 2007 die globale Klimaüberwachung.
Deutschen Wetterdienstes Inzwischen decken die Klimazeitreihen aus den Satel-
•k
napp 2 000 haupt- und nebenamtliche Wetterwarten, litendaten die vergangenen dreißig Jahre ab.
Wetter- und Niederschlagsstationen
• 17 Wetterradarstationen Auch der Ausbau erneuerbarer Energien profitiert
• knapp 1 300 phänologische Stationen zur Pflanzenbeobachtung von CM SAF, denn der Deutsche Wetterdienst erstellt
• 9 Radiosondenstationen mit jährlich 7500 Wetterballonaufstiegen daraus Karten mit Solarstrahlungsdaten für Europa
• Wetterdaten von etwa 300 Flugzeugen und die Welt. Damit kann man zuverlässig Photovol-
• Wettermeldungen von rund 650 Handelsschiffen
taik-Anlagen planen. Erste Smartphone-Apps helfen
bereits, damit den Jahresertrag der eigenen Anlage zu
• Daten von Wettersatelliten wie Meteosat und Metop
errechnen.
10a b
Foto: Jürgen Laufer
▶ Der Deutsche Klimaatlas: Klima-
daten von 1881 bis 2100 unter
www.deutscher-klimaatlas.de
a) Lufttemperatur
b) Heiße Tage
c d c) Vegetationsbeginn
d) Waldbrandindex
Wetterradar zur Klimaüberwachung
Die Klimaüberwachung per Wetterradar ist ein neues
Gebiet. Der Deutsche Wetterdienst arbeitet daran, seit
er sein Netz von Wetterradarsystemen betreibt. Heute
sind es 17 Stationen, die flächendeckende Informatio-
nen zum Niederschlag für ganz Deutschland liefern.
Diese Information ist wichtig für die Warnung vor
Unwettern und Überschwemmungen, denn kein an-
deres System liefert die Niederschlagsinformation in
so hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Nur das
Wetterradar kann kleinräumige, extreme und scha-
denträchtigen Niederschlagsereignisse erfassen.
Deshalb sind diese einzigartigen Daten, die seit An-
fang 2001 verfügbar sind, auch für die Klimatologie
hoch interessant. Allerdings müssen sie dazu sorgfäl-
tig aufbereitet werden. Sie können Fragen beantwor-
ten helfen wie zum Beispiel, ob sich schwere Gewitter
häufen und mehr Feuerwehreinsätze nötig machen. Foto: Susanne Stummvoll
11Foto: Fotolia
Wie wird das Klima der Zukunft?
„Wenn Kohlendioxid der wichtigste Faktor [im Erdklima] ist,
dann werden die Temperaturen in Langzeitaufzeichnungen
kontinuierlich steigen, solange der Mensch die irdischen Reserven
an fossilen Brennstoffen verbraucht.“
Gilbert Norman Plass (1921-2004), kanadischer Physiker, im Jahr 1959
12Forscher arbeiten an Vorhersagen und Projektionen von Wetter und Klima aus einem Guss: Die
Vorhersage des Wetters stützt sich fast ausschließlich auf den aktuellen Zustand der Atmosphä-
re. Je länger der Vorhersagezeitraum reicht, desto wichtiger werden andere Komponenten des
Klimasystems wie der Ozean und die Eisbedeckung. Bei den Klimaprojektionen, die heute bis zum
Ende des Jahrhunderts reichen, hängen die Ergebnisse der Projektionen nicht vom Anfangszu-
stand ab, sondern vor allem von der vermuteten Entwicklung der Treibhausgas-Konzentrationen.
Da besonders bei Zeiträumen, die kürzer als 10 Jahre sind, die natürlichen Einflüsse auf das
Klima und dessen systemeigene Variabilität den menschengemachten Treibhauseffekt zeitweise
überlagern können, sind Klimaprojektionen für das kommende Jahrzehnt bisher wenig aussage-
kräftig. Es besteht zwischen der Langfristvorhersage und den Klimaprojektionen noch erheblicher
Forschungsbedarf.
▲
Wenn die Klimaforschung den Blick in unsere Zukunft 21. Jahrhunderts und darüber hinaus. Die aktuellen
richtet, dann hat sie es mit drei Unbekannten zu tun. Szenarien dagegen folgen einer festgelegten Treibhaus-
Die größte Unbekannte ist die zukünftige Entwick- gaskonzentration, dem sogenannten repräsentativen
lung der Menschheit und damit ihre Produktion an Konzentrationspfad RCP (Representative Concentrati-
Treibhausgasen. Die zweite Ungewissheit steckt in on Pathway). Im Unterschied zum traditionellen Vorge-
den zwangsläufigen Vereinfachungen der Klimamodel- hen werden erst nachträglich die sozio-ökonomischen
le, denn kein Modell kann alle Vorgänge an allen Or- Entwicklungen an die zu erreichende Konzentration
ten in der Atmosphäre im Detail erfassen. Die dritte angepasst. Dieses Vorgehen erlaubt somit politische
Unbekannte sind Wechselwirkungen im Klimasystem, Vorgaben hinsichtlich der Emissionsminderung und
die noch weiter zu erforschen sind. Anpassungsmaßnahmen zu berücksichtigen.
Entscheidend für das Klima der Zukunft wird sein, Die verschiedenen Szenarien speist die Klimafor-
wie viele Menschen zukünftig die Erde bevölkern schung in ihre Klimamodelle ein. Die Modelle er-
und wie sie leben werden. Wie wird sich die Welt- rechnen dann auf Basis dieser Annahmen, wie sich
wirtschaft entwickeln? Werden unsere Technologien das Klima der Zukunft entwickeln könnte. Wegen
effizienter, so dass wir weniger Treibhausgase pro- der Ungewissheiten ist das Ergebnis natürlich keine
duzieren? Einfache Antworten auf diese Fragen gibt hundertprozentig sichere Vorschau in eine mögliche
es nicht. Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Zukunft, sondern eine Klimaprojektion. Diese besagt,
Panel on Climate Change) arbeitet deshalb mit ver- wie sich das Klima im angenommenen Szenario wahr-
schiedenen denkbaren Antworten auf diese Fragen. scheinlich entwickeln wird. Auch Expertinnen und
Experten des Deutschen Wetterdienstes arbeiten an
Die bisherigen Entwicklungsszenarien des IPCC erzähl- den IPCC-Berichten mit. Sie prüfen Teile des Berichts
ten mögliche „Zukunftsgeschichten“ der Menschheit als Regierungsgutachter, bringen aber auch eigene
und ihrer Treibhausgasemissionen bis zum Ende des Beiträge ein.
13Regionalisierung von Klimaprojektionen – Aussagen über zukünftige, kleinräumige Auswirkungen des Klimawandels stehen am Ende einer
komplexen Modellkette. Den Anfang geben Zukunftsszenarien zur weltweiten Entwicklung von Treibhausgas-Emissionen vor. Aus ihnen
errechnen globale Klimamodelle Zukunftsprojektionen, die wiederum feiner gerasterte Regionalmodelle antreiben. Wirkmodelle verfeinern
deren Ergebnisse schließlich zu speziellen lokalen Aussagen, zum Beispiel über die Veränderung eines Stadtklimas.
Was machen Klimamodelle?
„Klima ist das, was wir erwarten, Wetter das, was wir bekommen.“
Robert A. Heinlein (1907-1988), amerikanischer Schriftsteller
Wenn man verstehen will, was Klimamodelle simu- Kohlendioxid in der Luft, hebt so die Temperatur an
lieren, muss man sich die echte „Klimaküche“ an- der Erdoberfläche auf angenehme durchschnittliche
schauen. Unsere „Zentralheizung“ ist die Sonne. Ein 14 Grad Celsius. Ohne ihn wären es bittere minus 18
Teil ihrer Strahlung dringt durch die Erdatmosphäre Grad kalt. Solange der Anteil der Treibhausgase in der
bis zum Boden. Er heizt sich auf und erwärmt die Atmosphäre nicht zu groß wird, sind sie also gut für
Luft von unten. Ein anderer Teil wird bereits von der uns. Allerdings haben wir Menschen seit Beginn der
Atmosphäre aufgenommen. Am Ende strahlt die Erde Industrialisierung zum Beispiel den Kohlendioxidan-
zusammen mit der Atmosphäre die komplette Energie teil um rund 40 Prozent hochgetrieben. Der Mantel
des Sonnenlichts wieder ins Weltall zurück. Andern- um die Erde droht, zu warm zu werden.
falls würde sie sich immer mehr aufheizen.
Diese Strahlungsbilanz berechnen die Klimamodelle.
Doch die Erde „übersetzt“ dabei, grob gesagt, sicht- Ganz am Anfang stehen die Globalmodelle. Sie simu-
bares Sonnenlicht in langwellige Wärmestrahlung. lieren das Klima der gesamten Erde und müssen dabei
Dieser recht komplexe Übersetzungsprozess treibt komplexe Prozesse im „Erdsystem“ erfassen. Dazu
die Wetterküche an. Dabei kommen die Treibhausgase zählt auch der starke Einfluss der Ozeane auf das Kli-
ins Spiel. Sie wirken wie ein wärmender Mantel für ma. Sie transportieren Wasser, das die Sonne am Äqua-
die Erde, denn sie verzögern sozusagen die kühlen- tor erwärmt hat, in die Polarregionen und heizen diese
de Energieabgabe zurück ins Weltall. Der natürliche auf. Gäbe es den Golfstrom zum Beispiel nicht, dann
„Treibhauseffekt“, vor allem durch Wasserdampf und hätten wir in Deutschland ein deutlich kälteres Klima.
14Klimamodelle
Der DWD verfügt zurzeit über ein
Ensemble von mehr als 40 Klimaprojek-
tionen basierend auf 3 Klimaszenarien,
5 globalen Klimamodellen und 13
Vom Globalmodell zum Wirkmodell
Regionalmodellen.
Globalmodelle haben allerdings nur eine grobe Auflö-
sung. Ihr Rechengitter, mit dem sie den Globus wie ein
Strumpf überziehen, hat eine „Maschenweite“ von 200
bis 500 Kilometern. Feiner gestrickte Globalmodelle Land- und Forstwirtschaft, den Wasserhaushalt oder
würden die Rechenleistung heutiger Supercomputer die Gesundheit simulieren. Erst damit können Politik
überfordern. Um die Folgen des Klimawandels zum und Wirtschaft geeignete Anpassungsstrategien an
Beispiel für Deutschland zu simulieren, braucht man die Folgen des Klimawandels entwickeln.
daher Regionalmodelle, welche die Ergebnisse der
Globalmodelle verfeinern. Sie überdecken ein kleine- Klimamodelle simulieren wie die numerischen Mo-
res Gebiet, lösen dessen Strukturen aber viel genauer delle der Wettervorhersage die physikalischen Vor-
auf. So können sie den Einfluss von Gebirgen, Seen gänge in der Atmosphäre. Wegen der verschiedenen
oder der Landnutzung, zum Beispiel durch Landwirt- Zeitspannen, die sie umfassen, werden sie aber
schaft, besser einbeziehen. unterschiedlich „angetrieben“. Wettermodelle brau-
chen eine sehr präzise Eingabe des Ist-Zustands
Somit zeichnen Regionalmodelle ein detaillierte- der Atmosphäre, um das Wetter in den kommenden
res Bild über den wahrscheinlichen Klimawandel in Tagen vorherzusagen. Für Klimamodelle sind dagegen
Deutschland. Allerdings bleibt die Frage, wie dieser langfristige Veränderungen der Atmosphäre entschei-
sich konkret auf unser direktes Lebensumfeld aus- dend, etwa steigende Treibhausgas-Konzentrationen.
wirken wird. Die Antwort darauf liefern „Wirkmodel- Wegen dieser verschiedenen „Betriebsarten“ klafft
le“, die der Deutsche Wetterdienst für verschiedene derzeit zwischen den Wetter- und den Klimamodellen
Anwendungen entwickelt und betreibt. Stadtklima- eine „Vorhersage“-Lücke im Bereich eines Jahres und
modelle zum Beispiel zeigen, welche Auswirkung der eines Jahrzehnts. Der Deutsche Wetterdienst beteiligt
Klimawandel in einer Stadt haben kann. Es gibt auch sich an den Forschungsarbeiten zu einem Modellsys-
Wirkmodelle, die den Einfluss des Klimawandels auf tem, das diese Lücke schließen soll.
Blick auf die Wetterwarte Zugspitze
Foto Claudia Hinz
15Foto: Fotolia
Wie hart trifft der Klimawandel
Deutschland?
„Wir können also das Menschengeschlecht als Schar kühner,
aber kleiner Riesen betrachten, die… die Erde unterjochen und mit ihrer
schwachen Faust das Klima verändern. Wie weit sie es darinn gebracht
haben mögen, wird uns die Zukunft lehren.“
Johann Gottfried Herder (1744-1803), deutscher Theologe und Philosoph
Nicht nur alte Bäume müssen sich auf eine Klimaer-
wärmung einstellen, auch wir selbst. Der von uns Men-
schen verursachte Anstieg der Treibhausgaskonzent-
rationen in der Atmosphäre hat jedoch nicht zur Folge,
dass es automatisch Jahr für Jahr ein bisschen wärmer
wird. Die natürliche Klimavariabilität wird immer für
Schwankungen sorgen. Langfristig wird es aber bei
uns erheblich wärmer werden. Nach aktuellen Klima-
projektionen wird die Lufttemperatur im Jahresmittel
in der Bundesrepublik bis 2050 um 0,5 bis zwei Grad,
bis 2100 um insgesamt zwei bis vier Grad steigen. Vor
allem in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird sich
die Erwärmung beschleunigen, in Süddeutschland
wahrscheinlich stärker als in Norddeutschland. Die
Sommer werden trockener werden, während im Win-
ter die Niederschlagsmengen zunehmen.
16Hochwasser in Hamburg
▲
Besonders kritisch kann es im warmen Oberrhein-
graben werden. In Mannheim etwa gibt es bisher
durchschnittlich nur alle 25 Jahre einen Tag mit einer
Höchsttemperatur von 39 Grad Celsius oder mehr.
2100 werden wahrscheinlich im Mittel vier Tage im
Jahr so heiß werden. Besonders belastend ist das für
Senioren und Menschen mit Herzkreislauferkran-
kungen. Daher betreibt der Deutsche Wetterdienst
Foto Matthias Küttgen (PandaMedia.net)
ein Hitzewarnsystem. Auf dieser Basis können sich
Seniorenheime und Gesundheitsämter rechtzeitig auf
Hitzewellen vorbereiten.
Stadtplaner versuchen, die Überhitzung der Städte
Wir müssen uns also auf den Klimawandel in Deutsch- im Sommer zu entschärfen. Dabei können ihnen die
land einstellen. Entsprechend wächst der Bedarf Stadtklimatologen des Deutschen Wetterdienstes
an Klimaüberwachung und fundierter Beratung zur wirkungsvoll helfen. Sie simulieren dazu die Folgen
Unterstützung von Klimaanpassung. Letztere ist ohne des Klimawandels mit ihrem dreidimensionalen Stadt-
Klimaprojektionsrechnungen auf dem neuesten Stand klimamodell MUKLIMO_3. In einem Pilotprojekt mit
der Forschung nicht denkbar. Die Fragestellungen im der Stadt Frankfurt am Main ergaben solche Analy-
Kontext des Klimawandels sind vielfältig. Themen sind sen einen kräftigen Anstieg der Sommertage: Derzeit
– neben dem vorbeugenden Katastrophenschutz – die sind dort im Mittel 44 Tage pro Jahr wärmer als 25
Energiewende sowie die Nahrungsmittel- und Trink- Grad Celsius, bis 2050 könnten bis zu 31 Tage hinzu-
wassersicherheit. Die Klimaexpertinnen und -exper- kommen. Die Simulationsrechnungen des Deutschen
ten des Deutschen Wetterdienstes greifen auf einen Wetterdienstes zeigen auch die Lösungswege: so kann
langjährigen Erfahrungsschatz zurück. Sie fließt in zum Beispiel die Umwandlung bestimmter Areale in
die große Palette seiner Klimaservices ein. Einige Grünflächen lokal zu einer deutlichen Minderung der
drehen sich um unser direktes Lebensumfeld, das erwarteten Zunahme an Sommertagen beitragen. So
Wohnen und Arbeiten. bleibt die Stadt auch künftig lebenswert.
Klimawandel in der Stadt
Die meisten von uns verbringen einen großen Teil des
Lebens unter Dächern. Gebäude kann man bereits
heute für den zukünftigen Klimawandel fit machen,
inklusive Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Erwarteter Klimawandel
Die Basis hierfür liefern die „Testreferenzjahre“ des in Deutschland bis 2100
Deutschen Wetterdienstes als Klimaservice. Einige
• Temperaturanstieg bis zu 4°C
davon berücksichtigen bereits den zu erwartenden
Klimawandel bis 2050. • mehr Starkniederschläge im Winter
• doppelt so viele Sommertage wie heute
Die meisten Häuser stehen in Städten, in denen heute
rund Dreiviertel aller Deutschen leben. Wegen der
• bis zu 14 Tage früherer Vegetationsbeginn
dichten Bebauung können Städte bei bestimmten
Wetterlagen bis zu neun Grad wärmer als das Umland
werden. In Ballungsräumen kommt also die Bildung
Globaler Klimawandel bis 2100
solcher Wärmeinseln noch zum Klimawandel hinzu. • Temperaturanstieg von 2-4°C
17Mehr heiße Tage mit Höchst-
temperaturen von mindes-
tens 30 Grad Celsius
Der DWD wertet vorliegende
regionale Klimaprojektionen zur
Abschätzung der zukünftig zu
erwartenden Änderungen von
meteorologischen Größen wie
Lufttemperatur und Nieder-
schlag routinemäßig aus. Die
Grafik zeigt die Entwicklung der
Anzahl der heißen Tage im Jahr
mit einer Höchsttemperatur von
mindestens 30°C. Im Bild links
sind die aktuellen Verhältnisse
dargestellt, wie sie im klima-
tologischen Referenzzeitraum
1961-1990 gemessen wurden.
Die Bilder im rechten Teil der
Abbildung zeigen, mit wie vielen
zusätzlichen heißen Tagen pro
Jahr zukünftig gerechnet wer-
den muss - oben für den Zeit-
raum 2021-2050, unten für den
Zeitraum 2071-2100. Dargestellt
ist hierbei die obere Grenze
der im jeweiligen Zeitraum
wahrscheinlich zu erwartenden
Änderung. Eine noch deutlichere
Zunahme ist dementsprechend
unwahrscheinlich.
Häufigere Ernten, aber auch Trockenheit serwirtschaft) erforscht der Deutsche Wetterdienst
Pflanzen reagieren schon längst auf die Klimaerwär- gemeinsam mit Bayern, Baden-Württemberg und
mung. Bis Ende des Jahrhunderts könnte die Vegetation Rheinland-Pfalz, wie sich dort der Klimawandel auf
in Deutschland im Frühjahr zwei Wochen eher starten. den Wasserhaushalt in den einzelnen Regionen aus-
Für die Landwirtschaft birgt das Risiken und Chancen. wirkt. Seine Modellsimulationen zeigen, mit welchen
So könnte eine früher einsetzende Obstblüte stärker Hochwasserszenarien die Kommunen in Zukunft rech-
durch Nachtfröste bedroht sein. In manchen Regionen nen müssen. Bayern und Baden-Württemberg verstär-
könnten künftig aber auch zwei Ernten im Jahr möglich ken bereits Hochwasserschutzanlagen und schaffen
sein. Allerdings drohen auch verstärkt Trockenperioden überflutbare Ausgleichsflächen an Flüssen.
im Frühjahr und im Sommer, die die Ernten gefährden.
Die Agrarklimatologen des Deutschen Wetterdienstes Für solche Anpassungsstrategien ist der Deutsche
helfen Landwirten, sich auf diesen Klimawandel ein- Wetterdienst ein wichtiger Berater. Das gilt auch für
zustellen. Ihre Erkenntnisse fließen in eine praxisnahe die Folgen anderer extremer Wetterereignisse. Neben
Beratung, die zum Beispiel Ertragsschwankungen in Hochwassern verursachen vor allem Stürme große
der Landwirtschaft verringern kann. Schäden. 2007 forderte der Orkan Kyrill zum Beispiel
13 Todesopfer und verursachte Schäden von 2,4
Milliarden Euro.
Extreme Wetterereignisse
Besonders wichtig für den Bevölkerungsschutz ist Deshalb arbeitet der Deutschen Wetterdienst eng mit
die Frage, ob mit dem Klimawandel die Anzahl extre- dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katas-
mer Wetterereignisse in Deutschland steigen könnte. trophenhilfe (BBK) zusammen. Zum Beispiel werden
Tatsächlich deuten die Klimaprojektionen darauf hin, detaillierte Statistiken über extreme Wetterereignisse
dass etwa Starkniederschläge vermehrt auftreten der Vergangenheit erstellt, um stärker gefährdete
könnten – besonders im Winter. Im Projekt KLIWA Regionen auszumachen und sich auf dort zukünftig
(Klimaveränderungen und Konsequenzen für die Was- häufigere Bevölkerungsschutzeinsätze vorzubereiten.
18Foto Fotolia
▲ In ganz Deutschland lässt der DWD seit Jahr-
zehnten ausgesuchte Pflanzen beobachten. Eine
Erkenntnis: Aufgrund des Klimawandels blühen
viele Pflanzen heute früher als vor 50 Jahren.
◀D
er Klimawandel wird die Landwirtschaft welt-
Foto Fotolia weit verändern
Damit Feuerwehren, Polizei und das Technische Hilfs- einzustellen. Der Deutsche Wetterdienst deckt mit
werk schnell auf heraufziehende Unwetter reagieren seinen Klimaservices bereits alle Komponenten des
können, hat der Deutsche Wetterdienst automatische GFCS ab und bringt sein Expertenwissen in nationa-
Frühwarnsysteme aufgebaut. len und internationalen Gremien ein.
Verantwortung für die Welt
Der Klimawandel kennt keine Grenzen. Deshalb ist es für Klimainformationen
den Deutschen Wetterdienst wichtig, international aktiv des Deutschen Wetterdienstes im Internet
zu sein. Als nationaler Wetterdienst ist er innerhalb der • Portal „Klima und Umwelt“: www.dwd.de/klima
Weltorganisation für Meteorologie, der WMO, perfekt • Ausführliches zum Klimawandel: www.dwd.de/klimawandel
vernetzt. Die WMO will nun die Entwicklung und opera- •K
limadaten ausgewählter deutscher Stationen:
tionelle Bereitstellung von wissenschaftlich fundierten www.dwd.de/klimadaten
Klimaserviceleistungen international koordinieren. • Climate Data Center des DWD: www.dwd.de/cdc
•D
aten und Informationen des Weltzentrums für Niederschlags-
Diese Serviceleistungen sollen in vergleichbarer Qua- klimatologie: www.dwd.de/wzn
lität in allen Ländern der Erde zugänglich sein. Von •W
MO-Bericht zum Zustand des globalen Klimas:
zentraler Bedeutung ist dabei das Globale Rahmen- www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/statement.php
werk für Klimaservices (Global Framework for Clima- • Klimafaktoren für den Energiepass: www.dwd.de/klimafaktoren
te Services GFCS). Es soll weltweit eine verbesserte • Klimaauskünfte des DWD: www.dwd.de/klimaauskunft
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels • Informationen zum Klima in der Zukunft:
ermöglichen. Besonders wichtig ist diese Aktivität www.dwd.de/klimaforschung
für Entwicklungs- und Schwellenländer: Sie brauchen • Deutscher Klimaatlas: www.deutscher-klimaatlas.de
fundierte Hilfe, um sich mit ihrer Landwirtschaft und • Internationale Aktivitäten des DWD: www.dwd.de/international
ihren wachsenden Megastädten auf den Klimawandel
19Impressum
Text: Roland Wengenmayr, www.roland-wengenmayr.de
Redaktion: Uwe Kirsche, DWD
Fotos und Abbildungen: DWD (wenn nicht anders gekennzeichnet)
Gestaltung: monista Mediendesign, www.monista.de
Druck: Druckerei der BMVBS
Papier: Dieses Produkt stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
Titelfoto: Claudia Hinz
DWD 2. Auflage 10.000 / 02.14
Deutscher Wetterdienst (DWD)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frankfurter Straße 135 Über www.dwd.de gelangen Sie
63067 Offenbach auch zu unseren Auftritten in:
Tel: +49 (0) 69 / 8062 - 0
E-Mail: info@dwd.de, www.dwd.deSie können auch lesen