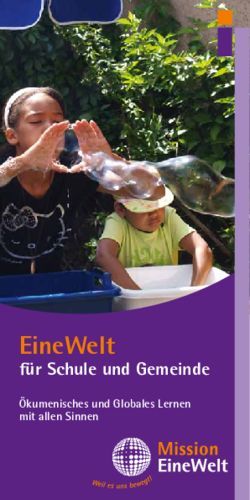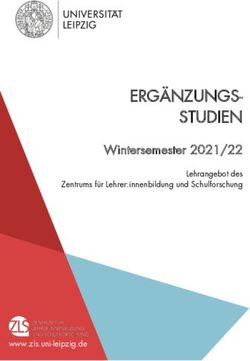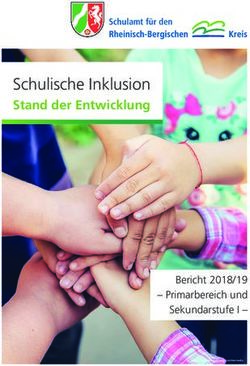DER ÜBERGANG VON DER KITA IN DIE GRUNDSCHULE - BRÜCKEN schaffen EIN RAHMENKONZEPT MIT DEM FOKUS AUF SPRACHBILDUNG - Kreis Lippe
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DER ÜBERGANG VON DER KITA IN
DIE GRUNDSCHULE
BRÜCKEN schaffen
EIN RAHMENKONZEPT MIT DEM
FOKUS AUF SPRACHBILDUNG
Stand: Oktober 2019An der Ausarbeitung beteiligte Institutionen Familienzentrum Kita FiBs Blomberg Ev. Familienzentrum Augustdorf Von Laer Stiftung, Fachberatung Kindertagesstätten AWO Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe, Fachberatung Kindertagesstätten DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe, OGS, Fachberatung Kindertageseinrichtungen Fachbereich 5, Kreis Lippe, Fachberatung Kindertagesstätten Grundschule Asemissen, Leopoldshöhe Grundschule in der Senne, Augustdorf Grundschule am Schloss, Lemgo Grundschule am Weinberg, Blomberg Hasselbachschule, Detmold Grundschule Wüsten, Bad Salzuflen Sozialpädagogen Schulen, Kreis Lippe Bildungsbüro Kreis Lippe, Handlungsfeld Sprachbildung Jugendamt Lemgo, Abteilungsleitung Kinder-, Jugend- und Familienbildung Fachgruppe Jugend, Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder, Stadt Lage Jugendamtselternbeirat Kreis Lippe Fachdienst Bildung, Team Regionales Bildungsnetzwerk Koordinierungsstelle „Kommunale Präventionsketten“ Kommunales Integrationszentrum Kreis Lippe Fachdienst Bildung, Weiterbildung und Bildungsberatung, Kreis Lippe VHS Lippe-Ost Regionales Bildungsnetzwerk (RBN) Kreis Lippe Schulaufsicht Grundschulen Kreis Lippe
Inhalt
Vorwort
Einleitung .....................................................................................................................................................................................7
1. Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule ............................................ 11
1.1. Zusammenarbeit zwischen Kita, Grundschule und Familie ....................................................................... 11
1.2. Für den Übergang relevante Kompetenzen des Kindes – beobachten, dokumentieren,
kommunizieren ....................................................................................................................................................... 15
1.3. Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung ............................................................................................... 20
2. Gemeinsame Fortbildung und Inhalte der Kooperation .......................................................................... 23
3. Netzwerkpartner und weitere Akteure ........................................................................................................ 25
4. Literatur und Quellen ...................................................................................................................................... 26
5. Mitwirkende....................................................................................................................................................... 28
6. Glossar ............................................................................................................................................................... 30
Anhang I: Gesetzliche Grundlagen für den Übergang ................................................................................................32
Anhang II: Praxismaterialien ................................................................................................................................................36Vorwort
Mit der Schultüte beginnt für alle Kinder in Lippe ein
neuer Abschnitt in ihrem Leben. Wer erinnert sich nicht
an diesen großen Tag? Vor dem Start in der Grund-
schule haben die Kinder schon vielfältige Bildungser-
fahrungen gemacht. Viele Personen waren und sind
künftig an ihrem Entwicklungsprozess beteiligt: Die El-
tern, Erzieherinnen, Lehrkräfte und die pädagogischen
Fachkräfte aus der Ganztagsbetreuung spielen bei der
Entwicklung der jungen Menschen und ihrer sprachli-
chen Entfaltung eine wichtige Rolle. Im Mittelpunkt steht dabei immer das Kind.
Je besser es uns gelingt, Kinder auf den Übergang von der Kita in die Grundschule vorzubereiten, desto
größer sind deren Chancen für den weiteren Bildungsweg.
Um das in Lippe gemeinsam zu gewährleisten, haben sich Vertreter aus allen mit dem Übergang be-
fassten Bereichen verabredet, dem Ganzen einen Rahmen zu geben. In vielen Stunden des Nachden-
kens und Diskutierens ist ein Rahmenkonzept erarbeitet worden, das für alle Beteiligten Mindestanfor-
derungen sowie Empfehlungen enthält, an denen sich Kita und Schule orientieren können, um den
Übergang erfolgreich zu gestalten.
Wir freuen uns, dass wir vom Regionalen Bildungsnetzwerk Lippe das Vorhaben unterstützen und viele
weitere qualifizierte Stellen und Fachkräfte für den Planungsprozess gewinnen konnten. Wir danken
allen Beteiligten für die gemeinsame konstruktive Arbeit.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass für alle Kinder in Lippe der Schritt von der Kita in die
Grundschule zu einem Erfolgserlebnis wird!
Ihr
Dr. Axel Lehmann
Landrat
4BRÜCKEN schaffen – Der Übergang von der Kita in die Grundschule
Einleitung
Bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder in Lippe
„Lippe profiliert sich als innovative Bildungsregion für alle“ – so lautet das vierte Leitziel in dem vom Kreis-
tag beschlossenen Zukunftskonzept Lippe 2025. Ein lebenslanger Zugang zu Bildung ist eine entschei-
dende Voraussetzung für den persönlichen Erfolg und die gesellschaftliche Teilhabe aller Lipperinnen und
Lipper.
Bereits 2008 hat der Kreis Lippe mit der Bezirksregierung Detmold und den 16 Städten und Gemeinden
eine Kooperationsvereinbarung zur Gestaltung der Bildungsregion Lippe geschlossen und in kommunal-
staatlicher Verantwortungsgemeinschaft 2009 die Entwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks
Lippe mit dem Land Nordrhein-Westfalen vertraglich vereinbart. Durch die Vernetzung und systematische
Kooperation aller Bildungseinrichtungen im Kreis Lippe sollen die Bildungs- und Lebenschancen der Bür-
gerinnen und Bürger verbessert werden. Gerade im ländlichen Raum stellt Bildung einen wichtigen Stand-
ortfaktor dar. Die strategische Steuerung des Regionalen Bildungsnetzwerks erfolgt über einen Lenkungs-
kreis unter Leitung des Landrats und des Abteilungsleiters Schulen der Bezirksregierung sowie unter Be-
teiligung von Bürgermeistern und Schulaufsicht. Themenbereiche des Regionalen Bildungsnetzwerks
sind unter anderem die Sprachbildung und die Bildungsübergänge.
Bei den vom Gesundheitsamt durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen sind 2016 bei 26 Prozent
der Jungen und 21 Prozent der Mädchen Sprach- und Sprechstörungen festgestellt worden. Um diese 1
Zahlen langfristig zu senken, hat der Lenkungskreis das Regionale Bildungsnetzwerk beauftragt, ein Rah-
menkonzept für den Übergang von der Kita in die Grundschule mit dem Fokus auf Sprachbildung zu erar-
beiten. Ziel ist es, dass alle Kinder in Lippe an jedem Ort die bestmöglichen Bildungschancen erhalten.
Übergänge ohne Brüche
Um das Ziel einer bestmöglichen Bildung von Kindern zu erreichen, gilt es, den Übergang von der Kita in
die Grundschule ohne Brüche zu gestalten. So sind beispielsweise Formen der Diagnostik und Förderung
der kindlichen Kompetenzen aufeinander abzustimmen und Informationen und Daten über das einzelne
Kind – unter Einhaltung des Datenschutzes und mit Einverständnis der Eltern – weiterzugeben und sinn-
voll zu nutzen. Ebenso ist dafür Sorge zu tragen, dass in der Schuleingangsphase Bekanntes, wie z.B Ri-
tuale, sowie neue Alltagselemente und Herausforderungen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.
Dieses ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Kind Übergänge als positiv erlebt. Die Herstellung dieser
2
Kontinuität ist eine gemeinsame Aufgabe der am Übergang beteiligten Fach- und Lehrkräfte, kann also
nur in einer guten Kooperation gelingen. Ebenso einzubeziehen sind die Eltern, die das Kind in dieser
wichtigen Phase des Übergangs begleiten.
1
Vgl. Kreis Lippe 2018, S. 39.
2
Vgl. MKFFI/ MSB 2018, S. 54.
7BRÜCKEN schaffen – Der Übergang von der Kita in die Grundschule
Gemeinsame Verantwortung für eine kontinuierliche Bildung des Kindes
Die Familie bildet den wichtigsten Bezugspunkt für die kindliche Entwicklung und hat den größten Einfluss
auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Die Kita als außerfamiliärer Lebensraum ergänzt und un-
1
terstützt die Familie bei der frühkindlichen Bildung. Bedeutsam ist hierbei, das Kind individuell, ganzheit-
lich und ressourcenorientiert zu fordern und zu fördern. Die Grundschule setzt diese Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit fort und erweitert sie um einen „fachbezogenen und kompetenzorientierten Blick auf das ein-
zelne Kind“ . Mit dem Eintritt in die Schule als erste verpflichtende staatliche Bildungsinstitution treten das
2
systematische Erlernen kognitiver Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen und damit formelle
Bildungsprozesse hinzu.
Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung des pädagogischen Auftrags von Kita und Grundschule sind
beide gemeinsam verantwortlich für eine beständige Bildungsentwicklung des Kindes.
Entwicklung eines Rahmenkonzeptes
Für die Entwicklung eines Rahmenkonzepts für den Übergang von der Kita in die Grundschule wurde eine
Projektgruppe gebildet, die dieses von Januar bis Mai 2019 in mehreren ganztägigen Arbeitssitzungen
erarbeitete. Vorausgegangen waren einige Sitzungen des „Fachausschuss Sprache und Entwicklung“ so-
wie eine Fachtagung, auf der neben fachlichem Hintergrund bereits bestehende Übergangskonzepte ver-
schiedener Kommunen im Kreis Lippe vorgestellt wurden.
Um die jeweiligen Interessen und Belange der in den Übergang involvierten Fachgruppen und Personen
berücksichtigen zu können, wurde die aus 24 Personen bestehende Projektgruppe zur Entwicklung des
Rahmenkonzeptes interdisziplinär zusammengesetzt. Vertreten waren u.a. Leitungen aus Kitas und
3
Grundschulen aus verschiedenen Kommunen des Kreisgebietes, Kita-Träger, Jugendämter, Mitarbeite-
rinnen des Kreises Lippe sowie kreisangehöriger Städte, das Kommunale Integrationszentrum, die Schul-
aufsicht, die Volkshochschule sowie der Jugendamtselternbeirat.
Die inhaltliche Planung und Durchführung der Arbeitsgruppensitzungen übernahm ein neunköpfiges
Kernteam in enger Abstimmung mit einer externen Moderatorin aus dem Bildungsmanagement. Die or-
ganisatorische Steuerung und Koordination erfolgte dabei durch das Regionale Bildungsbüro des Kreises
Lippe.
1
Vgl. MKFFI/ MSB 2018, S. 11.
2
Vgl. MKFFI/ MSB 2018, S. 11.
3
Eine Auflistung sämtlicher in den Prozess involvierter Personen findet sich in Kap. 5.
8BRÜCKEN schaffen – Der Übergang von der Kita in die Grundschule
Das Rahmenkonzept als Arbeits- und Orientierungshilfe
Das Rahmenkonzept liefert wichtige Informationen für die Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwor-
tung und eine gelingende Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen. Angesprochen sind alle päda-
gogischen Fach-, Lehr- und Leitungskräfte dieser Einrichtungen. Von besonderem Interesse dürfte das
Rahmenkonzept hier für die jeweiligen Leitungskräfte sowie jene Pädagoginnen sein, die schwerpunkt-
mäßig mit dem Übergang betraut sind, wie die Klassenlehrerinnen in der Schuleingangsphase und die
Erzieherinnen der Vorschulkinder, eventuell beauftragte Übergangskoordinatorinnen, Sprachförderkräfte
und sozialpädagogische Fachkräfte.
Dabei ist die Kooperation zwischen Kita und Grundschule als Prozess zu sehen, der Zeit benötigt und nie
abgeschlossen ist. Sie kann stets justiert und optimiert werden. Kitas und Grundschulen sollten sich zu-
versichtlich gemeinsam auf den Weg machen. Auch kleine Schritte führen zum Ziel.
Das Rahmenkonzept bietet auf diesem Weg Hilfe und Orientierung. Um die Zusammenarbeit zwischen
Kitas und Grundschulen aktiv zu unterstützen und den Fokus speziell auf das wichtige Thema der Sprach-
bildung und Sprachförderung zu richten, werden alle wichtigen gesetzlichen Bestimmungen in diesem
Rahmenkonzept aufgeführt und um wünschenswerte Standards sowie Beispiele aus lippischen Kommu-
nen ergänzt.
Sofern bei der Formulierung der Begriff „Eltern“ gewählt wurde, sind damit die primären Bezugspersonen
des Kindes und damit in der Regel die Erziehungsberechtigten gemeint. Unter der Bezeichnung „Familie“
verstehen wir jegliche Formen des Zusammenlebens von Eltern mit ihren Kindern, also auch beispiels-
weise ein Elternteil mit Kind. Der Begriff „Schule“ umfasst nach dem Verständnis der Projektgruppe alle
Formen der Betreuung an Schulen, z.B. die „OGS“. Letztere ist nur dann gesondert genannt, wenn explizit
Aufgaben der Ganztagsbetreuung angesprochen sind.
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Werk auf eine geschlechterneutrale Sprache verzich-
tet. Da in den Einrichtungen Kita und Grundschule überwiegend weibliche Fachkräfte arbeiten, wird in
diesem Rahmenkonzept in der Regel die feminine Form gewählt. Sowohl im Falle der Verwendung der
weiblichen als auch der männlichen Form sind selbstverständlich beide Geschlechter gemeint.
9BRÜCKEN schaffen – Der Übergang von der Kita in die Grundschule
RAHMENKONZEPT
FÜR DEN ÜBERGANG
KITA - GRUNDSCHULE
MIT DEM FOKUS AUF SPRACHBILDUNG
10Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
1. Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von
Kita und Grundschule
1.1. Zusammenarbeit zwischen Kita, Grundschule und Familie
Wie gut Kinder den Übergang von der Kita in die Grundschule meistern, hängt von vielen Faktoren ab.
Eine besondere Rolle kommt zunächst ihrer Familie zu, die sie in dieser wichtigen Phase begleitet und
den Übergang selbst als Herausforderung erleben mag. Maßgeblich ist zudem die Qualität der Koopera-
tion von Kita, Grundschule und Familie.
Unabdingbar für eine gute Zusammenarbeit ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Aus diesem Grund ste-
hen das Kennenlernen und der Austausch der beteiligten Akteure an erster Stelle eines Übergangsmana-
gements. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit sollten sich verlässliche Strukturen und verbindliche
Kooperationsformen herausbilden. Dabei sollten nicht nur die pädagogischen Fachkräfte beider Einrich-
tungen, sondern auch die Eltern der einzuschulenden Kinder als Experten einbezogen werden. Eltern sind
in der Regel die ersten und wichtigsten Bezugspersonen für ihre Kinder und mit deren Persönlichkeit sehr
vertraut. Sie sind damit „wesentliche Bildungspartner“ und sollten stets über die Bildungsangebote und -
1
prozesse informiert und möglichst aktiv beteiligt werden.
Kitas und Schulen sehen sich mit unterschiedlichsten familiären, kulturellen und sozialen Hintergründen
der Kinder konfrontiert. Auch die Einstellungen zu Bildung und Erziehung mögen innerhalb der Eltern-
schaft weit auseinandergehen. Eine besondere Aufgabe ist es, mit allen Eltern in den Dialog zu treten und
sie ggf. in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. (Angebote zu pädagogischen Themen, wie z.B. thema-
tisch gebundene Elternabende oder Vorträge, können hier gewinnbringend sein.) In ihrer Erziehungshal-
tung gefestigte Eltern sind für eine erfolgreiche Bildungsbiografie ihrer Kinder von besonderer Bedeutung.
In den Schulen nehmen sowohl die Lehrkräfte der Eingangsphase als auch die pädagogischen Fachkräfte
der Ganztagsbetreuung eine relevante Rolle ein. Viele Kinder verbringen einen nicht unerheblichen Teil
ihres Tages in der Einrichtung und profitieren von einer guten Absprache und Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Fach- und Lehrkräfte. Die Mitarbeiterinnen der Betreuungseinrichtung sollten in die Koopera-
tion mit den Kitas und den Familien einbezogen werden. Alle Beteiligten sollten sich auf Augenhöhe mit-
einander austauschen.
1
Vgl. MKFFI/ MSB 2018, S. 61.
11Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Gesetzliche Mindeststandards
In den Gesetztestexten finden sich folgende, für die Kooperation in den Verbünden relevante Vorgaben:
§ 14b KiBiz - Zusammenarbeit mit der Grundschule
(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung für die bestän-
dige Förderung des Kindes und seinen Übergang in die Grundschule zusammen.
(2) Zur Sicherung gelingender Zusammenarbeit und zur Gestaltung des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich
gehören insbesondere
1. eine kontinuierliche gegenseitige Information über die Bildungsinhalte, -methoden und -konzepte,
2. die Kontinuität bei der Förderung der Entwicklung der Kinder,
3. regelmäßige gegenseitige Hospitationen,
4. die für alle Beteiligten erkennbare Benennung fester Ansprechpersonen in beiden Institutionen,
5. gemeinsame (Informations-) Veranstaltungen für die Eltern und Familien der Kinder,
6. gemeinsame Konferenzen zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule und
7. gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fach- und Lehrkräfte.
(3) Der Schulträger lädt gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der Tageseinrichtungen für Kinder und der Grundschu-
len die Eltern, deren Kinder in zwei Jahren eingeschult werden, zu einer Informationsveranstaltung ein, in der die Eltern über
Fördermöglichkeiten im Elementarbereich und Primarbereich, insbesondere auch über die Bedeutung kontinuierlich aufei-
nander aufbauender Bildungsprozesse, beraten werden.
§14b (3) findet sich mit demselben Wortlaut auch im Schulgesetz 1
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Eltern heißt es im Schulgesetz unter § 2 (Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule), Abs. 3: „Die Schule achtet das Erziehungsrecht der Eltern. Schule und Eltern wirken bei der Verwirklichung der
Bildungs- und Erziehungsziele partnerschaftlich zusammen.“
Im KiBiz wird außerdem die Information über den Entwicklungsstand des Kindes und die Beratung und Unter-
stützung der Eltern angesprochen:
§ 9 (Fn11) KiBiz - Zusammenarbeit mit den Eltern
(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen arbeiten mit den Eltern bei der Förderung der
Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen. Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Infor-
mation über den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den Eltern mindestens einmal
im Kindergartenjahr ein Gespräch über die Entwicklung ihres Kindes, seine besonderen Interessen und Fähigkeiten
sowie geplante Maßnahmen zur gezielten Förderung des Kindes anzubieten. Eltern, die Kommunikationsunterstüt-
zung benötigen und deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden, ha-
ben die Rechte aus § 8 Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. De-
zember 2003 (GV. NRW. S. 766) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Kommunikationsunterstüt-
zungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336) in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Das pädagogische Personal berät und unterstützt die Eltern und Familien im Rahmen seiner Kompetenzen zu wichti-
gen Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.
1
Vgl. SchulG §36 (1).
12Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Stets zu beachten ist der Datenschutz . In den Bildungsgrundsätzen wird diesbezüglich festgehalten:
1
Ohne ausdrückliche Einwilligung der Eltern dürfen [diese] Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die
Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sowie die Lehrkräfte können Einblick in die bisherige Bildungsbiografie
des Kindes erhalten, vorausgesetzt, die Eltern haben der Informationsweitergabe in nahem zeitlichem Rahmen zuge-
stimmt.
Anzustrebende Standards und Empfehlungen für die Zusammenarbeit von
Kita und Grundschule
Die Akteure tragen gemeinsam die Verantwortung für die Gestaltung des Übergangsprozesses.
Die Kooperation einer Grundschule mit einer Kita wird in Form einer festen Kooperationsvereinba-
rung verschriftlicht.2
Die Verantwortlichen aus Grundschule und Kita erarbeiten gemeinsam Kooperationsziele, die von
allen vertreten werden. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten:
o Die Kommunikation zwischen Kita, Grundschule und Familie wird auf Augenhöhe etabliert.
o Die Kontinuität des kindlichen Bildungsprozesses ist gewährleistet.
o Kita und Grundschule stimmen sich über unterstützende Bildungsmaßnahmen für die im letzten
Kita-Jahr befindlichen Kinder ab.
Die kooperierenden Einrichtungen führen einen Kooperationskalender mit festen Vereinbarungen
3
und Terminen, der Möglichkeiten der Begegnung an verschiedenen Orten (Schule/Ganztag/Kita)
berücksichtigt. Auf diese Weise wird für alle Beteiligten die Möglichkeit geschaffen, die verschiede-
nen Orte kennenzulernen und die zukünftigen Schulkinder erhalten Einblicke in die Schule und die
schulische Betreuungseinrichtung.
Die Schulen und Kitas kennen die Instrumente und Verfahren der Bildungsdokumentation der jewei-
ligen Verbundpartner und stimmen sich diesbezüglich ab.
Inhalte und Termine der Kooperation werden auch Eltern transparent gemacht.
1
Hinweise zum Datenschutz finden sich außerdem in KiBiz §13b (2) sowie im SchulG NRW §120. Vgl. Kap. 1.2 bzw. An-
hang I.
2
Beispiele für Kooperationsvereinbarungen finden sich auf der Homepage des Bildungsbüros des Kreises Lippe
(https://www.kreis-lippe.de/Bildung-und-Kultur/Fachdienst-Bildung/Bildungsb%C3%BCro/Rahmenkonzept/) sowie unter
dem Link des Kreises Höxter: https://bildungsregion.kreis-hoexter.de/aktuelles/downloads/index.html. Im Internet finden
sich zahlreiche weitere Muster für Kooperationsvereinbarungen.
3
Ein Beispiel für einen Kooperationskalender findet sich im Anhang II.
13Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Alle pädagogischen Fach- und Lehrkräfte aus Kita, Grundschule und Ganztagsbetreuung nehmen
gemeinsame Fortbildungen u.a. zur Förderung der sprachlichen Entwicklung von Kindern wahr.
Diese Fortbildungen werden in den Kooperationskalender aufgenommen.
Anzustrebende Standards und Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit
Eltern
Eltern werden in ihrer Erziehungsarbeit gestärkt.
Die Eltern werden an der Beobachtung und Einschätzung ihrer Kinder beteiligt. Diese Beteiligung
erfolgt z.B. durch
o Beratungsgespräche mit Eltern
o Nutzung eines entsprechenden Einschätzungsbogens, der den Eltern durch die Kooperations-
partner ausgehändigt wird
Die Erzieherinnen beraten die Eltern dahingehend, dass sie in die Dokumentation der Entwicklung
ihrer Kinder und die Weitergabe dieser Dokumentation an die Grundschule einwilligen.
Es finden Angebote und Aktionen für Eltern statt wie z.B. Elterncafés oder Themenabende.
Bei Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes im Hinblick auf die Einschulung werden den Eltern
Empfehlungen zur Unterstützung an die Hand gegeben. Hierbei stimmen sich Schulen und Kitas ab. 1
Die Informationsveranstaltungen für Eltern, deren Kinder in zwei Jahren eingeschult werden, werden 2
gemeinsam von dem Schulträger, den Schulen und Kitas konzeptionell gestaltet und inhaltlich auf die
Bedarfe vor Ort abgestimmt. Empfohlen werden praxisnahe Anregungen für die alltagsintegrierte Be-
gleitung von Bildungsprozessen des Kindes durch die Eltern. 3
Um alle Eltern zu erreichen, werden Elternbriefe in vereinfachter Sprache verfasst. 4
1
Vgl. hierzu die Materialien auf der Internetseite des Bildungsbüros des Kreises Lippe (https://www.kreis-lippe.de/Bildung-
und-Kultur/Fachdienst-Bildung/Bildungsb%C3%BCro/Rahmenkonzept/).
2
Vgl. SchulG NRW §36.
3
Auf der Internetseite des Bildungsbüros des Kreises Lippe finden Sie das Konzept eines Informationsabends, wie er in
Lemgo durchgeführt wird. Vgl. https://www.kreis-lippe.de/Bildung-und-Kultur/Fachdienst-Bildung/Bil-
dungsb%C3%BCro/Rahmenkonzept/
4
Informationen und Regeln zu sog. Leichter bzw. Einfacher Sprache finden sich auf https://www.kita.nrw.de/fachkraefte-
fachberatung/sprachliche-bildung. Kontaktstelle in Detmold ist das „Büro leichte Sprache“ der Lebenshilfe. (https://www.le-
benshilfe-detmold.de/buero-leichte-sprache/)
14Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
1.2. Für den Übergang relevante Kompetenzen des Kindes – beobachten, do-
kumentieren, kommunizieren
Für einen gelungenen Übergang von der Kita in die Grundschule benötigen Kinder Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten (Selbstkompetenz) und Sozialkompetenzen wie Konflikt- und Kooperationsfähigkeit so-
wie die Fähigkeit, Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und Empathie zu entwickeln. Sie brauchen die
Sach- und Methodenkompetenz, sich Wissen selbst anzueignen sowie die Fähigkeit, sich über einen län-
geren Zeitraum konzentriert und aufmerksam mit einer Sache zu beschäftigen. 1
Eine wichtige Voraussetzung für die sprachliche Entwicklung eines Kindes ist die gesunde Entwicklung
des Sprechens und der Sprechwerkzeuge. Um in diesem Bereich mögliche Entwicklungsverzögerungen
abklären zu können, ist die Beobachtung der Basiskompetenzen wie der auditiven Wahrnehmung, der
Mundmotorik, der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung sowie der emotionalen und sozialen Kompetenzen
bedeutsam. Für eine weiterführende Beratung und Diagnostik im Bereich der Sprach- und Sprechstörun-
gen sind Kinderärzte, Logopäden bzw. Sprachheiltherapeuten wesentliche Ansprechpartner für Eltern und
Kinder. Erste Kontaktstelle für pädagogische Fachkräfte sind die Sprachheilberaterinnen des Kreises
Lippe. 2
Für die sprachliche Bildung im Übergang zwischen Kita und Grundschule benötigen Kinder Kenntnisse in
folgenden Sprachbereichen:
Sprachverständnis
Semantisch-lexikalische Kompetenzen (Wortbedeutung/Wortschatz)
Phonetisch-phonologische Kompetenzen (Artikulation, Produktion von Lauten)
Prosodische Kompetenzen (Sprachmelodie, Sprachrhythmus)
Morphologisch-syntaktische Kompetenzen (Mehrzahlbildung, Verbstellung, Satzmuster, Zeiten, etc.)
Pragmatische Kompetenzen (Sprechen, Verstehen und Zuhören)
Literacy (Erfahrung mit Büchern und Texten)
Sprachliche und mathematische Bildung werden in einem engen Zusammenhang gesehen und bedingen
sich wechselseitig. Kinder ordnen, klassifizieren, vergleichen, messen und zählen, erkennen geometrische
Formen. Das hier früh erworbene mathematische Sprachverständnis gilt als eine weitere wesentliche Vor-
läuferfähigkeit für einen gelingenden Schulstart.
Nach § 13b KiBiz ist die regelmäßige, alltagsintegrierte wahrnehmende Beobachtung eine wichtige
Grundlage zur Einschätzung der Fähigkeiten und Fertigkeiten des einzelnen Kindes.
1
Zur Selbst-, Sozial-, Sach- und Methodenkompetenz vgl. MKFFI/ MSB 2018, S. 71ff. In den Bildungsgrundsätzen finden
sich auch weiterführende Informationen zu den verschiedenen Kompetenzen und Bildungsbereichen. Vgl. insbesondere Kap.
C3 [Sprache und Kommunikation] sowie C4 [Soziale und (inter-)kulturelle Bildung].
2
Kontaktdaten finden sich im Anhang II.
15Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Ziel ist es, das Kind kontinuierlich, individuell und optimal zu begleiten und zu fördern. Die Beobachtung
und Dokumentation des kindlichen Bildungsprozesses hilft, den Selbstbildungsprozess des Kindes ganz-
heitlich zu betrachten und die Schritte, in denen sich die individuelle Entwicklung vollzieht, zu erkennen
und unter Einbeziehung folgender Fragen besser zu verstehen:
1
Was tut das Kind?
Was bringt es an Handlungsweisen und Ideen mit?
Welche Fähigkeiten setzt das Kind ein?
Welche Materialien interessieren es besonders?
Wie nimmt es Beziehungen zu anderen (zu Kindern, zu Erwachsenen, zu Dingen) auf?
Welche Bedeutung könnte die Situation für das Kind haben?
Für den unvoreingenommenen und differenzierten Blick auf das Kind ist es bei der Beobachtung und Do-
kumentation wichtig, dass Fachkräfte ihre eigene Haltung wahrnehmen und reflektieren. Die Weiterent-
2
wicklung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit trägt auch dazu bei, zu prüfen, ob eigene Erwartungen oder
jene der Umwelt die Beobachtung und Dokumentation beeinflussen.
Die prozesshafte Darstellung der individuellen Bildungsgeschichte z.B. durch Portfolios sollte immer unter
der partizipativen Mitgestaltung des Kindes stattfinden. Die oft über Jahre entstehende Bildungsdokumen-
tation ist Teil seiner Biografie.
Die Erstellung von Bildungsdokumentationen setzt die schriftliche Einwilligung der Eltern voraus. Im Rah-
men der Bildungspartnerschaft und im Sinne einer gemeinsamen Entwicklungsbegleitung sind die Eltern
bei Entwicklungsgesprächen (in der Kita) und bei Planungen, die die Lernentwicklung und die Lernförde-
rung ihres Kindes (in der Grundschule) betreffen, mit einzubeziehen. Im Übergang zur Grundschule sind
Dokumentationen über den bisherigen Bildungsprozess des Kindes wertvoll für die folgenden Lern- und
Entwicklungsschritte. Die Eltern müssen der Informationsweitergabe schriftlich zustimmen. Die Bildungs-
dokumentationen sind Eigentum der Kinder und ihrer Eltern und nach Beendigung der Kindertagesbe-
treuung auszuhändigen.
In der Grundschule bietet die kontinuierliche Bildungsdokumentation eine Grundlage für eine ressourcen-
orientierte Förderdiagnostik und Förderplanung. Dabei wird das Kind mit seinen individuellen Kompeten-
zen gesehen und als Bildungspartner ernst genommen.
1
MKFFI/ MSB 2018, S. 35.
2
Vgl. hierzu MKFFI/ MSB 2018, S. 36.
16Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Gesetzliche Mindeststandards
Hinsichtlich der Beobachtung und Dokumentation des Entwicklungsstandes des Kindes sowie des Um-
gangs mit diesen Daten führt das KiBiz Folgendes aus:
§ 13b KiBiz - Beobachtung und Dokumentation
(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere der individuellen stärkenorientier-
ten ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes ist eine regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende Beobach-
tung des Kindes. […] Nach einem umfassenden Aufnahmegespräch mit den Eltern und einer Eingewöhnungs-
phase, spätestens aber sechs Monate nach Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung, erfolgt eine erste
Dokumentation. Entsprechendes ist für die Förderung in Kindertagespflege anzustreben. Die Bildungsdokumen-
tation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus.
(2) Die Bildungsdokumentation ist auch Gegenstand von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern. Wenn die Eltern in
zeitlicher Nähe zur Informationsweitergabe schriftlich zugestimmt haben, wird sie den Grundschulen zur Einsicht-
nahme zur Verfügung gestellt und von den Lehrkräften des Primarbereichs in die weitere individuelle Förderung
einbezogen.
Die Eltern sind dabei auf ihre Widerspruchsmöglichkeit hinzuweisen. Endet die Betreuung des Kindes in der Ta-
geseinrichtung, wird die Bildungsdokumentation den Eltern ausgehändigt.
Aussagen zur sprachlichen Bildung sowie zur Unterstützung der Sprachentwicklung finden sich in
§ 13c des Kinderbildungsgesetzes:
§ 13c KiBiz - Sprachliche Bildung
(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung der sprachlichen Ent-
wicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Sprache
ist schon in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug. Die Mehrsprachigkeit
von Kindern ist anzuerkennen und zu fördern. Sie kann auch durch die Förderung in bilingualen Kindertagesein-
richtungen oder bilingualer Kindertagespflege unterstützt werden.
(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses regelmäßig und beginnend mit der
Beobachtung nach § 13b Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung geeigneter Verfahren zu beobachten und zu doku-
mentieren. Die Sprachentwicklung soll im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten auch in anderen Mutterspra-
chen beobachtet und gefördert werden.
(3) Die pädagogische Konzeption nach § 13a muss Ausführungen zur alltagsintegrierten kontinuierlichen Begleitung
und Förderung der sprachlichen Bildung der Kinder und zur gezielten individuellen Sprachförderung enthalten.
(4) Für jedes Kind, das eine besondere Unterstützung in der deutschen Sprache benötigt, ist eine gezielte Sprachför-
derung nach dem individuellen Bedarf zu gewährleisten.
17Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Welche Verfahren zur Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung als geeignet gel-
ten, wird vom zuständigen Ministerium festgelegt. Zurzeit gelten die untenstehenden Beobachtungsver-
fahren als geeignet. Aus diesen ist unter Berücksichtigung der Altersstufe des Kindes ein Verfahren ver-
bindlich im pädagogischen Alltag einzusetzen, und zwar regelmäßig im Abstand von maximal einem Jahr. 1
Die Auswahl des Verfahrens obliegt den Trägern der Kitas.
Entwicklungs- und prozessbegleitende Beobachtungsverfahren zur Sprachentwicklung 2
Verfahren für Kinder unter 3 Jahren Verfahren für Kinder von 3 bis 6 Jahren
Liseb 1 und 2: „Literacy- und Sprachentwicklung be- Sismik: Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei
obachten (bei Kleinkindern)“ Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen
oder und
BaSiK: Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwick- Seldak: Sprachentwicklung und Literacy bei deutsch-
lungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen sprachig aufwachsenden Kindern
oder oder
DJI-Beobachtungsleitfaden: DJI – Die Sprache der BaSiK: Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwick-
Jüngsten entdecken & begleiten lungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen
Anzustrebende Standards und Empfehlungen
Die pädagogischen Fachkräfte aus Kita und Grundschule tauschen sich auf Grundlage der Bildungs-
grundsätze und ihrer eigenen Erfahrungen über die für den Übergang in die Schule relevanten Kom-
petenzen des Kindes aus. Sie einigen sich darauf, welche Kompetenzen in der kindlichen Entwicklung
im Brückenjahr besonders zu unterstützen sind.
Die Schulen und die Kitas kennen die Instrumente und Verfahren der Bildungsdokumentation der
jeweiligen Verbundpartner und stimmen sich diesbezüglich ab. Die Kitas informieren die Schulen dar-
über, welche Maßnahmen zur Unterstützung bzw. Förderung des Kindes im sprachlichen Bereich
stattfinden bzw. stattgefunden haben. (Hinweis: Hierbei ist unbedingt der Datenschutz zu gewährleis-
ten.)3
Die Erzieherinnen beraten die Eltern dahingehend, dass sie in die Dokumentation der Entwicklung
ihrer Kinder und die Weitergabe dieser Dokumentation an die Grundschule einwilligen.
1
Vgl. MFKJKS 2014, S. 13.
2
Übersicht entnommen aus MFKJKS 2014, S. 13.
3
Vgl. Anhang I.
18Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Den Grundschulen sollten bis zu dem Zeitpunkt der Schulanmeldungen die bis dahin geführten Bil-
dungsdokumentationen vorliegen.
Den Grundschulen wird empfohlen, für das Einschulungsgespräch den von einem Arbeitskreis im
Kreis Lippe entwickelten Auswertungsbogen Sprache und den Auswertungsbogen Mathematik zu
nutzen. 1
Die Grundschule informiert die Kitas darüber, wie nach dem Übergang die Anfangsphase gestaltet
wird. Die Grundschule nutzt dabei nach Möglichkeit die Vorerfahrungen aus den Kitas für die Zusam-
mensetzung der Klassen und die Einrichtung eigener Fördergruppen.
Die Kitas tauschen sich mit den Eltern über die Entwicklung der Kinder aus. Dabei erhalten die Eltern
konkrete Informationen und Anregungen, wie sie ihr Kind bis zum Schuleintritt in der Ausbildung hier-
für relevanter Kompetenzen unterstützen können. 2
1
Vgl. den im Anhang II abgebildeten Durchführungs-, Beobachtungs- und Auswertungsbogen Deutsch des „Arbeitskreis Kom-
petenzstärkung von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe in den Kernfächern Deutsch und Mathematik“. Der Durchfüh-
rungs-, Beobachtungs- und Auswertungsbogen Mathematik ist über die Internetseite des Bildungsbüros des Kreises Lippe
abrufbar (Link siehe unten).
2
Förderideen für die Hand der Eltern sind abrufbar über die Internetseite des Bildungsbüros des Kreises Lippe, vgl.
https://www.kreis-lippe.de/Bildung-und-Kultur/Fachdienst-Bildung/Bildungsb%C3%BCro/Rahmenkonzept/
19Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
1.3. Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung
Das Integrationskonzept des Kreises Lippe (2013) sieht vor, dass die „Herkunftssprachen der Kinder und
Jugendlichen […] als Mehrwert entlang der Bildungskette erkannt und gefördert werden [sollten]“ . Fami- 1
liensprachen sind wichtig für die Identität des Kindes und tragen zu einer guten Eltern-Kind-Beziehung
bei. Mehrsprachige Menschen entwickeln zudem ein besseres Verständnis von Sprache (metasprachliche
Fähigkeiten), was auch für den Lese- und Schreiberwerb von Vorteil ist. Langfristig eröffnet Mehrsprachig-
keit damit breitere berufliche Perspektiven.
Weitere, in dem Integrationskonzept des Kreises aufgelistete Ziele sind: 2
Eine durchgängige bedarfsangepasste Sprachbildung, die in den einzelnen Einrichtungen konzeptionell ver-
ankert ist.
Die Sprachförderung beginnt so früh wie möglich, bereits im Elternhaus.
Die Kita- und Einschulungserkenntnisse werden für die weitere Sprachförderung genutzt.
Die Seiteneinsteiger werden individuell, zeitnah und intensiv gefördert.
Aufgrund ihres zentralen Einflusses gilt es, Eltern in ihrer Erziehungs- und Bildungsverantwortung zu stär-
ken. Voraussetzung für Chancengleichheit ist eine von Beginn an passgenaue, individuelle Förderung der
Kinder und ihres Umfelds. Eine gezielte Sprachförderung in der Herkunfts- und Zweitsprache spielt dabei
eine wichtige Rolle. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises Lippe bietet den Bildungsein-
3
richtungen kostenfreie Unterstützung durch die Beraterinnen für interkulturelle Unterrichts- und Schulent-
wicklung an. Zusätzlich können in Kooperation mit dem KI verschiedene Programme/Projekte, unter an-
derem zur Förderung der Mehrsprachigkeit, durchgeführt werden.
Gesetzliche Mindeststandards
Hinsichtlich der (mehr)sprachlichen Bildung des Kindes führt das KiBiz Folgendes aus:
§ 13c KiBiz - Sprachliche Bildung
(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung der sprachlichen Ent-
wicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Sprache
ist schon in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug. Die Mehrsprachigkeit
von Kindern ist anzuerkennen und zu fördern. Sie kann auch durch die Förderung in bilingualen Kindertagesein-
richtungen oder bilingualer Kindertagespflege unterstützt werden.
(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses regelmäßig und beginnend mit der
Beobachtung nach § 13b Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung geeigneter Verfahren zu beobachten und zu doku-
mentieren. Die Sprachentwicklung soll im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten auch in anderen Mutterspra-
chen beobachtet und gefördert werden.
1
Kreis Lippe 2013, S.26.
2
Zur Formulierung der Ziele s. Kreis Lippe 2013, S. 26.
3
Kreis Lippe 2013, S. 24.
20Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
(3) Die pädagogische Konzeption nach § 13a muss Ausführungen zur alltagsintegrierten kontinuierlichen Begleitung
und Förderung der sprachlichen Bildung der Kinder und zur gezielten individuellen Sprachförderung enthalten.
(4) Für jedes Kind, das eine besondere Unterstützung in der deutschen Sprache benötigt, ist eine gezielte Sprach-
förderung nach dem individuellen Bedarf zu gewährleisten.
Im Referenzrahmen Schulqualität NRW wird bezüglich Mehrsprachigkeit und interkultureller Bildung
Folgendes festgehalten:
Referenzrahmen Schulqualität NRW
Die Schule wertschätzt kulturelle Hintergründe und die Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und
Schülern und ermöglicht, dass sie ihre spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ein-
bringen können . 1
Die Schule fördert eine durchgängige Sprachbildung .2
Es herrscht ein bewusster und förderlicher Umgang mit Sprache in allen Fächern und schulischen
Handlungsbereichen . 3
Anzustrebende Standards und Empfehlungen
Kitas und Grundschulen tauschen sich über den Umgang mit Sprach- und Bildungsbarrieren aus
und entwickeln einen gemeinsamen Handlungsfahrplan. Dabei werden die örtlichen Besonderhei-
ten, wie zum Beispiel Familienstrukturen, Migration und sozioökonomisches Umfeld, berücksich-
tigt. Entsprechende Termine und Veranstaltungen werden in den Kooperationskalender aufge-
nommen.
Die Eltern erhalten vor der Schulanmeldung grundsätzliche Informationen über das deutsche
Schulsystem . 4
Kitas und Grundschulen arbeiten mit Fachkräften aus dem Bereich der interkulturellen Arbeit in
multiprofessionellen Teams zusammen.
Schulentwicklungsberater können bei Bedarf die Übergangsprozesse unterstützen.
1
MSW 2015, S. 31.
2
MSW 2015, S. 33.
3
MSW 2015, S. 33.
4
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat Broschüren zur Information über das Schulsystem in NRW
veröffentlicht, die über das „Bildungsportal des Landes NRW“ in verschiedenen Sprachen gratis erhältlich sind: „Das Schulsys-
tem in NRW. Einfach und schnell erklärt.“ Download oder Bestellung unter: https://broschueren.nordrheinwestfalendi-
rekt.de/broschuerenservice/msb
21Standards der gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita und Grundschule
Durch die Vernetzung mit Projekten und Programmangeboten in der Kommune finden eine inter-
kulturelle Öffnung der Einrichtungen und eine Förderung der Mehrsprachigkeit statt. 1
Kitas und Schulen realisieren und kommunizieren Konzepte einer durchgängigen Sprachbildung,
die auch im Übergang von der Kita zur Grundschule zum Tragen kommen.
Kitas und Schulen setzen Infobriefe zur Mehrsprachigkeit sowie Elternbriefe in verschiedenen
Sprachen ein. 2
1
Anregungen für die Umsetzung finden sich im Anhang II.
2
Das Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung an Kitas in Sachsen (LakoS) hat Elternbriefe entwickelt und in bisher
14 Sprachen veröffentlicht. Download unter https://www.lakossachsen.de/elterninfobriefe-mehrsprachigkeit
22Gemeinsame Fortbildung und Inhalte der Kooperation
2. Gemeinsame Fortbildung und Inhalte der Koopera-
tion
Um die Kontinuität der Bildungsprozesse von Kindern zu gewährleisten, sind institutions- und trägerüber-
greifende Fortbildungen notwendig, in denen verbindende Elemente des Elementar- und Primarbereichs
herausgearbeitet und weiterentwickelt werden. Gemeinsame Fortbildungen sind auch gesetzlich vorge-
1
schrieben: So heißt es im Kinderbildungsgesetz: „Zur Sicherung gelingender Zusammenarbeit und zur
Gestaltung des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich gehören insbesondere […] gemeinsame
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fach- und Lehrkräfte.“ 2
In gemeinsamen Fortbildungen können sich die Fachkräfte aus Kita und Grundschule zunächst über ihr
jeweiliges Bildungsverständnis austauschen und Gemeinsamkeiten herausstellen. Auf dieser Basis las-
3
sen sich Einschätzungen und Erwartungen z.B. bzgl. der Vorläuferfähigkeiten der Kinder klären: Was leis-
tet die Kita? Was erwartet die Grundschule?
Aufbauend auf einem gemeinsamen Bildungsverständnis könnten die folgenden praxisnahen Themen in-
nerhalb des Kooperationsverbunds im Fokus stehen:
Zusammenarbeit und Kommunikation mit Eltern
Zugang zu Eltern mit Migrationshintergrund
Gemeinsame Planung und Durchführung von Elterninformationsabenden
Elternarbeit im letzten Kita-Jahr
Gestaltung der Schuleingangsphase
Auch die folgenden Themenfelder gilt es so aufzubereiten, dass sie auf die alltägliche Praxis Bezug neh-
men und den Kita- und Grundschulalltag unterstützen: 4
Kindeswohl, Partizipation und Kinderrechte
Umgang mit traumatisierten Kindern
Inklusion in Kita und Grundschule
Interkulturelle Kompetenzen
Auch wenn nicht unmittelbar an gemeinsamen Konzepten oder Veranstaltungen gearbeitet wird, tragen
einrichtungsübergreifende Fortbildungen neben der Vertiefung von Sach- und Methodenkenntnissen
1
MKFFI/ MSB 2018, S. 65.
2
KiBiz NRW §14b.
3
Anregungen hierzu bietet der „Bildungskoffer“. Vgl. MKFFI 2018, S. 17ff.
4
Carle und Samuel führen diesbezüglich aus: „Fortbildung und Weiterbildungen müssen […] theoretisch fundiert und den-
noch nah am aktuellen Praxisproblem liegen. Bereits in den Fortbildungen und Weiterbildungen muss die Erprobung des
Erlernten angelegt sein.“ (Carle/ Samuel 2008, S. 232.)
23Gemeinsame Fortbildung und Inhalte der Kooperation
dazu bei, sich gegenseitig kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und Verbindendes zu erkennen. Aus
diesem Grunde sollten Kitas und Schulen häufiger in Erwägung ziehen, ursprünglich intern angedachte
Fortbildungen einrichtungsübergreifend auszurichten bzw. für die weiteren Einrichtungen im Verbund zu
öffnen.
Um die Qualität der Kooperation zu verbessern, kann die Unterstützung durch eine Prozessmoderation
sinnvoll sein.
Unterstützung bei der Realisierung von Fortbildungen bieten u.a.
die Fachberatungen der Kitas
die Familienzentren
das Kommunale Integrationszentrum
die Volkshochschulen
das Regionale Bildungsbüro
Beratung bei allen Fragen rund um die Weiterbildung, Unterstützung bei der Recherche nach passenden
Angeboten und Informationen über finanzielle Fördermöglichkeiten bieten die Bildungsberatung der
Volkshochschulen und die Bildungsberatung des Kreises Lippe. 1
1
Vgl. z.B. die Bildungsberatung der VHS Detmold-Lemgo: https://www.vhs-detmold-lemgo.de/service/bildungsberatung/
24Netzwerkpartner
3. Netzwerkpartner und weitere Akteure
Welche Netzwerkpartner für die Kooperationsverbünde bedeutsam sind, ist abhängig vom Standort und
den Gegebenheiten vor Ort. In erster Linie bestimmen die Bedarfslagen der Kinder die Entscheidung, mit
welchen Einrichtungen und Diensten zusammengearbeitet wird.
Im Falle einer langfristigen Zusammenarbeit können Kooperationsverträge geschlossen oder bereits in-
nerhalb des Verbunds vorhandene (z.B. eines Familienzentrums) auf eine andere Einrichtung (z.B. die
Schule) ausgeweitert werden.
Im Hinblick auf die sprachliche Unterstützung der Kinder bietet sich insbesondere der Austausch mit Lo-
gopäden, Pädaudiologen, Kinderärzten und Sprachheilberaterinnen des Kreises Lippe an. Dabei ist der
Datenschutz unbedingt zu berücksichtigen.
Im Folgenden sind einige Netzwerkpartner aufgeführt, die für eine Kooperation in Frage kommen:
Kinderärzte
jugendärztlicher Dienst der Gesundheitsämter
Logopäden, Sprachheilkundler
Sprachheilberaterinnen (Kreis Lippe)
Ergotherapeuten
Frühförderung
Erziehungsberatung
Jugendhilfe
Landesjugendamt
schulpsychologische Beratungsstelle
Kinderschutzbund
Schulträger
Förderschulen
Volkshochschulen
Weiterbildungsträger
Wohlfahrtsverbände wie AWO, DRK
Kommunales Integrationszentrum
Regionales Bildungsbüro
Kirchen
Vereine
Polizei, Feuerwehr, Verkehrswacht
Stadtbüchereien
Museen
Musikschulen
25Literatur und Quellen
4. Literatur und Quellen
Literatur
Carle, Ursula/ Samuel, Annette. Frühes Lernen – Kindergarten und Grundschule kooperieren: Kinder-
garten und Grundschule gestalten den Schulanfang. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren,
2008.
DKJS (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH, Hrsg.). Sprachbildung gemeinsam
gestalten: Ein Leitfaden zur Qualitätsentwicklung für Kitas und den Übergang in die Grundschule. Berlin,
2016.
(Download unter: https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/180312_Ab-
schlussbroschu__re_Bildung-braucht-Sprache.pdf; Zugriff am 17.07.2019)
KiBiz (Kinderbildungsgesetz). Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern. Viertes Gesetz zur
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – Landesrecht Nordrhein-Westfalen. Vom
30. Oktober 2007. (Fassung seit dem 01.08.2017.) (Download unter: https://www.mkffi.nrw/revision-
des-kinderbildungsgesetzes; Zugriff am 17.06.2019)
Kreis Lippe (Hrsg.) Integration im Kreis Lippe 2013: Konzept zur gesellschaftlichen Partizipation von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Detmold: Kommunales Integrationszentrum, 2013.
Kreis Lippe (Hrsg.). Gesundheit und Entwicklung von Kindern im Einschulungsalter im Kreis Lippe: Er-
gebnisse der Schuleingangsuntersuchungen für die Einschulungsjahrgänge 2010/2011 bis
2017/2018. Band I (Gesundheitsbericht). Lemgo, 2018.
(Download unter: https://www.kreis-lippe.de/Gesundheitsregion-Lippe/Gesundheitsamt/in-
dex.php?object=tx,2001.495.1; Zugriff am 16.07.2019)
MFKJKS (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen,
Hrsg.). Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich – Grundlagen für Nord-
rhein-Westfalen. Düsseldorf 2014. (Download unter https://www.kita.nrw.de/fachkraefte-fachbera-
tung/sprachliche-bildung; Zugriff am 18.07.2019)
MKFFI (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen).
Die Bildungsgrundsätze auf einen Blick: Das Begleitheft zum Bildungskoffer. Freiburg im Breisgau: Her-
der, 2018.
MKFFI/ MSB (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-West-
falen)/ Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen). Bildungsgrundsätze:
Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an: Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10
26Literatur und Quellen
Jahren in Kindertagesbetreuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen. Freiburg im
Breisgau: 2. korrigierte Aufl., Herder, 2018.
(Download unter: https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/bildungsgrundsaetze_ja-
nuar_2016.pdf; Zugriff am 17.06.2019)
MSW (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen). Referenzrahmen
Schulqualität NRW. Schule in NRW Heft Nr. 9051. 1. Aufl. 2015.
SchulG NRW (Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) vom 15.02.2005 (GV.NRW.S.102), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 21.07.2018 (SGV.NRW.223). Ritterbach Verlag.
(Download unter: http://bass.schul-welt.de/6043.htm; Zugriff am 16.07.2019)
Linktipps
Bildungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen:
www.bildungsportal.nrw.de
www.learn-line.nrw.de
Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung an Kitas in Sachsen:
https://www.lakossachsen.de
Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung:
https://www.nifbe.de/
Portal KiTa.NRW (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen)
https://www.kita.nrw.de
27Mitwirkende
5. Mitwirkende
An der Entwicklung des Rahmenkonzepts haben folgende Personen mitgewirkt:
Projektleitung:
Dr. Elisabeth Pries-Kümmel (Bildungsbüro, Handlungsfeld Sprachbildung)
Kernteam:
Sigrun Düe (Jugendamt Lemgo, Abteilungsleitung Kinder-, Jugend- und Familienbildung)
Saskia Frei-Klages (Fachdienst Bildung, Teamleitung Regionales Bildungsnetzwerk)
Margit Monika Hahn (Koordinierungsstelle „Kommunale Präventionsketten“)
Linda Heidenreich (Kommunales Integrationszentrum Kreis Lippe)
Ute Küstermann (Teamleitung Familienfreundlicher Kreis/ Kinderschutz)
Andrea Lemm (VHS Lippe-Ost, stv. Leitung)
Dr. Anja Mai (Fachdienst Bildung, Weiterbildung und Bildungsberatung)
Dr. Elisabeth Pries-Kümmel (Bildungsbüro, Handlungsfeld Sprachbildung)
Dagmar Wietheger-Claes (Fachberatung Kindertageseinrichtungen)
Projektgruppe:
Sandra Beckmann (DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe, Fachberatung Kindertageseinrich-
tungen)
Sigrun Düe (Jugendamt Lemgo, Abteilungsleitung Kinder-, Jugend- und Familienbildung)
Yvonne Düstersiek (Jugendamtselternbeirat Kreis Lippe)
Diana Fleer (Schulleitung Grundschule Asemissen, Leopoldshöhe)
Saskia Frei-Klages (Fachdienst Bildung, Teamleitung Regionales Bildungsnetzwerk)
Margit Monika Hahn (Koordinierungsstelle „Kommunale Präventionsketten)
Linda Heidenreich (Kommunales Integrationszentrum Kreis Lippe)
Martina Klein (DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe/ OGS-Bereichsleitung)
Ute Krause (Schulleitung Grundschule in der Senne, Augustdorf)
Anke Kuhn (Leitung Familienzentrum Kita FiBs Blomberg)
Andrea Lemm (stellv. Leitung VHS Lippe-Ost)
Dr. Anja Mai (Fachdienst Bildung, Weiterbildung und Bildungsberatung)
Mirjam Mann (stellv. Leitung Kommunales Integrationszentrum Kreis Lippe)
Tanja Marschner (stellv. Schulleitung Grundschule am Schloss, Lemgo)
Torsten Mewes (Schulleitung Grundschule am Weinberg, Blomberg)
Cathrin Möbius (stellv. Schulleitung Hasselbachschule, Detmold)
Dr. Elisabeth Pries-Kümmel (Bildungsbüro Kreis Lippe, Handlungsfeld Sprachbildung)
Dana Reisenberger (Grundschule in der Senne, sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangs-
phase/ Vertretung Sozialpädagogen Schulen Kreis Lippe)
Martina Ritzenhoff (Von Laer Stiftung, Fachberatung Kindertagesstätten)
28Sie können auch lesen