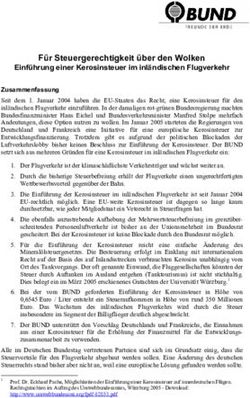Der Dreikampf ums Kanzleramt - Erste Ergebnisse einer Studie zum TV-Triell in ARD und ZDF am 12. September 2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Essay Von Uwe Wagschal, Thomas Waldvogel, Samuel Weishaupt und Linus Feiten Der Dreikampf ums Kanzleramt – Erste Ergebnisse einer Studie zum TV-Triell in ARD und ZDF am 12. September 2021 27. September 2021
Redaktion/ Wissenschaftliche Koordination Kristina Weissenbach Tel. +49 (0) 203 / 379 - 3742 Sekretariat Lina-Marie Zirwes Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2018 lina-marie.zirwes@uni-due.de Herausgeber (V.i.S.d.P.) Univ. Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte Redaktionsanschrift Redaktion Regierungsforschung.de NRW School of Governance Institut für Politikwissenschaft Lotharstraße 53 47057 Duisburg redaktion@regierungsforschung.de Zitationshinweis Wagschal, Uwe et al. (2021): Der Dreikampf ums Kanzleramt – Erste Ergebnisse einer Studie zum TV-Triell in ARD und ZDF am 12. September 2021, Essay, Erschienen auf: regierungsforschung.de
Regierungsforschung.de
Der Dreikampf ums Kanzleramt
Erste Ergebnisse einer Studie zum TV-Triell in ARD und ZDF am 12.
September 2021
Von Uwe Wagschal1, Thomas Waldvogel2, Samuel Weishaupt3 und Linus Feiten4
Wie wurde das zweite TV-Triell zwischen Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und
Olaf Scholz (SPD) von den Zuschauer:innen wahrgenommen? Welche Wirkungen gingen von die-
sem audio-visuellen Schlagabtausch auf die Zuseher:innen aus? Und welche:r Kandidat:in konnte
mit seinen bzw. ihren Aussagen überzeugen? Antworten auf diese Fragen bietet die Instant-Analyse
des TV-Triells in ARD/ZDF am 12. September 2021. Sie basiert auf Daten des sogenannten Debat-
O-Meters5, einer Online-Anwendung, mit der Nutzer:innen ihre unmittelbaren Eindrücke über eine
Debatte in Echtzeit wiedergeben können.
TV-Debatten zwischen politischen Spitzenkandidat:innen vor Wahlen gelten als Kulminations-
punkte politische Kommunikation (Waldvogel 2020a). Sie werden dabei gemeinhin als Win-Win-
Win-Win-Situation beschrieben (Maier und Faas 2019: 6-13): Medien bietet sich die Möglichkeit,
ein unterhaltsames und informatives Format zu konzipieren, das eine Reichweite erzeugt, wie sie
für gewöhnlich nur für große Sportereignisse bekannt sind. Den Kandidat:innen eröffnet sich die
Chance, die eigenen Standpunkte einem heterogenen Publikum zu präsentieren und für die eigenen
Positionen zu werben. Den Wähler:innen bieten TV-Debatten die Möglichkeit, Personen, Pro-
gramme und Parteien mit einem überschaubaren (Zeit-)Aufwand direkt miteinander zu verglei-
chen. Der Forschung bieten diese audio-visuellen Kompaktwahlkämpfe einen klar abgrenzbaren
1
Uwe Wagschal ist seit 2003 Professor für Vergleichende Regierungslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Zuvor war er Professor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Neben den Forschungen zu politischen Debatten und Voting Advice Applications liegen seine Schwerpunkte auf
der Policy-Analyse von Staatsfinanzen und der Direkten Demokratie.
2 Thomas Waldvogel ist seit 2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Vergleichende Regierungslehre
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und seit 2013 Fachreferent der Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre zählen die Wahl- und Parteienforschung, politische
Kommunikation sowie die Methodik und Didaktik der politischen Bildung.
3 Samuel Weishaupt ist seit 2015 Mitarbeiter im Projekt Debat-O-Meter der Professuren für Vergleichende Regierungs-
lehre und für Rechnerarchitektur der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er forscht an Algorithmen und Applikatio-
nen zur Analyse politikwissenschaftlicher Studien.
4 Linus Feiten leistete seinen Hauptbeitrag zum Debat-O-Meter als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Becker an
der Uni Freiburg. Inzwischen ist er als Informatiker in der Wirtschaft tätig und begleitet das Projekt ehrenamtlich wei-
ter.
5 Das Debat-O-Meter ist ein interdisziplinäres Projekt von Informatikern und Politikwissenschaftlern der Universität
Freiburg. Für die hier vorliegende Auswertung wurden die Daten mit den Variablen Geschlecht, Alter und Parteineigung
gewichtet, um die aktuelle Situation zu berücksichtigen.
3Regierungsforschung.de
Stimulus, dessen Wahrnehmungen und Wirkungen exemplarisch untersucht werden können, aber
über die Rezeption eines einzelnen Politik-Events hinausreichen (Vögele et al. 2013).
Als besonders erkenntnisbringend haben sich in der politik- und kommunikationswissenschaftli-
chen Forschung dabei Ansätze erwiesen, die die Befragung der Zuschauer:innen nicht nur in einem
Prä- und Posttest umsetzen, sondern auch deren Echtzeitreaktionen (sogenannte Real-Time-
Response-Messung; kurz: RTR) auf die Kandidat:innenaussagen erheben (Waldvogel und Metz
2017).
Seit der Etablierung von TV-Duellen in bundesdeutschen Wahlkämpfen hat sich eine ausgedehnte
Forschungslandschaft entwickelt (Maier et. al. 2014), die sich einerseits mit methodologischen Fra-
gestellung der Echtzeitmessung von Zuschauer:innen-Reaktionen zu diesen Fernsehevents (z.B.
Maier et al. 2009; Reinemann et al. 2005; Waldvogel und Metz 2020), deren Inhalte (z.B. Bachl et al.
2013; Jansen und Glogger 2017; Maier und Faas 2019: 39-57) und Wahrnehmung durch die Zuse-
her:innen (z.B. Bachl 2013a; Maier und Faas 2019: 71-85; Belok und Heinrich 2017) ebenso be-
schäftigt, wie mit den Wirkungen (Maier und Faas 2019: 87-129) beispielsweise auf das politische
Wissen und Effektivitätsüberzeugungen (z.B. Maier und Faas 2011; Maier 2007a; Range 2017), mo-
tivationale und verhaltensrelevante Aspekte (Maier und Faas und Maier 2011; Faas und Maier
2004, Maier et. al. 2013; Range 2017, Maier 2007c; Maier 2017) oder auf debatteninduzierten Ein-
stellungsänderungen gegenüber Kandidat:innen (Maier 2007b; Bachl 2013b; Waldvogel 2019;
Maurer und Reinemann 2007). Während die Forschung zu den Kanzler:innen-Duellen in Deutsch-
land also sehr ausdifferenziert ist, liegen kaum Erkenntnisse zu TV-Debatten mit Mehrpersonen-
Podien wie beispielsweise einem Triell vor (für Ausnahmen siehe beispielsweise Faas und Maier
2017; Waldvogel 2020b).
Der hier vorgelegte Beitrag stößt in diese Lücke und präsentiert erste Ergebnisse der Blitzanalyse
über die Wahrnehmungen und Wirkungen des TV-Triells zwischen Annalena Baerbock (Grüne),
Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD). Die zugrunde liegenden Echtzeit- und Umfragedaten
wurden mit dem Debat-O-Meter (www.debatometer.com) generiert, einem Online-Tool, mit dessen
Hilfe die Nutzer:innen über das Internet ihre Wahrnehmung der Debatte unmittelbar sekundenge-
nau mit plus (+ und ++) und minus (- und --) mitteilen können. Das Debat-O-Meter sammelt diese
Eingaben auf einem Server und stellt die Daten für die grafische und statistische Auswertung zur
Verfügung (für weitere Informationen siehe auch Metz et al. 2016). Mehr als 12200 Teilnehmer:in-
nen nutzten dabei das Debat-O-Meter, welches zudem mit einer Vor- und Nachbefragungen gekop-
pelt war. Von über 9000 Nutzer:innen liegen zudem Daten der Vor- und/oder Nachbefragung vor.
Insgesamt wurden dabei rund 650.000 Bewertungen von den TV-Zuschauer:innen abgegeben.
Scholz liegt hauchdünn vorne, Baerbock verbessert sich am stärksten
Auf die „entscheidende Frage“ nach dem Sieger bzw. der Siegerin des Triells („Alles in allem, wer
hat Ihrer Meinung nach in der Diskussion am besten abgeschnitten?“) gab es keine eindeutige Ant-
wort von Seiten der Nutzer:innen des Debat-O-Meters. So sahen 32,2 Prozent der Teilnehmer:innen
4Regierungsforschung.de
Olaf Scholz als Sieger, Annalena Baerbock 32,0 Prozent und 27,6 Prozent Armin Laschet. Ein Unent-
schieden sahen 8,3 Prozent der Befragten.
Abbildung 1: Nachbefragung – Sieger des Triells
Vor der Debatte wurden die Teilnehmer:innen gefragt: „Wer, glauben Sie, wird in der Diskussion
am besten abschneiden?“ Hier lag Olaf Scholz noch deutlich mit 41,2 Prozent vorne. Insgesamt hat
er damit bei einer Betrachtung der Vor- und Nachbefragung etwas verloren. Die Zahl der Unent-
schiedenen ging jedoch deutlich zurück. Gaben vor der Debatte 20,2 Prozent ein Unentschieden als
erwarteten Ausgang an, so reduzierte sich dieser Wert deutlich (auf 8,3%). Annalena Baerbock ver-
besserte sich am deutlichsten. Vor Beginn der Debatte erwarteten sie nur 17,2 Prozent als Siegerin.
Aber auch Armin Laschet konnte gegenüber der Ausgangserwartung zulegen. Sein Anstieg betrug
7,4 Prozentpunkte.
5Regierungsforschung.de
Abbildung 2: Vorbefragung – Wer wird Sieger
Lässt man die Anhänger:innen von Union, SPD und Grüne bei der Analyse außer Betracht, dann kam
bei den Unentschlossenen, den Wählerinnen anderer Parteien und den Nichtwählerinnen Annalena
Baerbock am besten an, gefolgt von Armin Laschet und Olaf Scholz. Letzterer kam zwar bei den
Grünen-Anhänger:innen gut an, offensichtlich aber weniger in anderen politischen Lagern. Bemer-
kenswert ist der Befund, wenn man sich innerhalb dieser Gruppe die Altersverteilung ansieht: bei
den Jungen (unter 40) lag hier Baerbock vorne, in der Alterskohorte 40-59 Jahre Armin Laschet und
bei den über 60-jährigen Olaf Scholz.
Abbildung 3: Sieger des Triells: Alle Anderen (nur Anhänger anderer Parteien, Unentschlossene,
Nichtwähler)
Deutliche Unterschiede nach Alter und Geschlecht
Wertet man die Befragung jeweils nach Alterskohorten und Geschlecht aus, dann liegt bei den jun-
gen Debat-O-Meter-Teilnehmer:innen unter 40 Jahren Annalena Baerbock (42,8%) deutlich vor
Olaf Scholz (25,4%) und Armin Laschet (24,5%). Bei der mittleren Alterskategorie dreht sich das
Bild beachtlich. Hier liegt Armin Laschet mit 35,1% vor Olaf Scholz (30,4%) und Annalena Baerbock
(27,5%). Deutlicher Sieger bei den Senioren ist Olaf Scholz mit 40,6% gefolgt Laschet und Baerbock.
Damit zeigt sich ein doch erstaunlicher Befund: In den drei Altersklassen (jung, mittel, alt) gibt es
drei verschiedene Sieger:innen.
Wenig überraschend liegt Annalena Baerbock bei den Frauen an der Spitze (39,0%) vor Scholz
(29,9%) und Laschet (21,5%). Dagegen liegt Baerbock bei den Männern auf dem dritten Platz, wäh-
rend Scholz mit 34 Prozent Zustimmung in dieser Gruppe gewinnt, knapp vor Laschet (32,5%).
6Regierungsforschung.de
Scholz wirkt am kompetentesten und am führungsstärksten
Wie kamen die drei Diskussionsteilnehmer:innen beim Publikum an, wenn man nach bestimmten
wichtigen Eigenschaften fragt? Die Zuschauer:innen hatten dabei die Möglichkeit Baerbock, Laschet
und Scholz auf einer Skala von -2 bis +2 zu bewerten. Tabelle 1 stellt vier Eigenschaften für die drei
Debattenteilnehmer:innen dar.
Die größte Führungsstärkte wurde – mit deutlichem Abstand – Olaf Scholz (Durchschnitt 0,6 auf
der Skala von –2 bis +2), vor Baerbock (-0,05) und Laschet (-0,32) zugesprochen. Am sympathischs-
ten fanden die Zuschauer:innen Annalena Baerbock (0,57 im Mittel), vor Scholz (0,49) und Laschet
(-0,50). Auch bei der Frage „…ist fähig, politische Probleme zu lösen“ sieht man die gleiche Reihen-
folge Scholz (0,63) vor Baerbock (0,00) und Laschet (-0,24). Jedoch liegt Scholz wieder deutlich vor
seinen Konkurrent:innen. Bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit liegt dagegen Baerbock (+0,42)
knapp vor Scholz (+0,39) und deutlich vor Laschet (-0,37).
In der Gesamtschau polarisiert besonders Laschet, der von Anhänger:innen des linken politischen
Lagers schlechte Noten erhält. Die guten Glaubwürdigkeitsbewertungen für Annalena Baerbock
überraschen angesichts der Diskussion um Plagiate, geschönte Lebenslaufen und nicht ordnungs-
gemäß gemeldete Einnahmen. Olaf Scholz wird dagegen durchgehend positiv gesehen.
Tabelle 1: Eigenschaften der Kandidaten im Vergleich
Baerbock Laschet Scholz
Er / Sie ist führungsstark -0,05 -0,32 0,60
Er / Sie ist mir als Mensch sympathisch. 0,57 -0,50 0,49
Er / Sie ist fähig, politische Probleme zu lösen. 0,00 -0,24 0,63
Er / Sie ist politisch glaubwürdig. 0,42 -0,37 0,38
Anmerkungen: Dargestellt sind die Durchschnittsbewertungen auf einer Skala von -2 bis +2. Auswer-
tung der Nachbefragung, Antworten auf die Frage: „Und in welchem Maße treffen die verschiedenen
Aussagen Ihrer Meinung nach auf… zu“; n = rund 5100 (je nach Frage)
Bei den rhetorischen Fähigkeiten sahen die Zuschauer:innen wieder Scholz deutlich vor Baerbock
und Laschet. Hier wurde gefragt wer die beste Rhetorik in der Debatte hatte, wobei Scholz mit
knapp 48 Prozent knapp 20 Prozentpunkte vor Baerbock lag und diese wiederum knapp vor La-
schet. Bei insgesamt 9 abgefragten Items zur Debattenleistung lag Scholz 6 Mal an der Spitze, gefolgt
von Baerbock (3 Mal).
7Regierungsforschung.de
Die Tops und Flops der Aussagen der Spitzenkandidaten
Was waren die Tops und Flops während der Debatte? Das Debat-O-Meter kann genau anzeigen, bei
welchen Aussagen die Zuschauer:innen besonders zustimmten oder Ablehnung zeigten.
Am meisten Zustimmung erhielt Annalena Baerbock für Ihre Aussage, dass „zuallererst Abgeord-
nete, Minister, Leute wie wir“ in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten, um diese zu
stabilisieren. Den deutlichsten Widerspruch erfuhr die grüne Spitzenkandidatin mit Ihrem State-
ment, dass Sie den Soli nicht abschaffen wolle.
Die Forderung von Union-Kanzlerkandidat Laschet, „das Wohnen im ländlichen Raum attraktiv [zu]
halten, damit nicht jeder glaubt, für gleichwertige Lebensverhältnisse in die Stadt ziehen [zu müs-
sen]“ fand große Zustimmung unter den Zuschauerinnen. Hingegen wird Armin Laschet für seine
Spitze im Schlussstatement gegen die Grünen – dass er nicht gängele, die Menschen machen lasse
und ihnen nicht vorschreibe, wie sie zu denken, zu reden oder zu leben habe – mit negativen Be-
wertungen abgestraft.
Olaf Scholz erhielt für seine zentrale Lehre aus der Corona-Pandemie, wonach der öffentliche Ge-
sundheitsdienst auf den modernsten Stand zu bringen sei, ein Bestreben, das auch nach der Krise
nicht aufhören dürfe, den größten digitalen Beifall. Starken Widerspruch erfuhr der SPD-Spitzen-
mann hingegen als er sich gegen eine Testpflicht für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Ar-
beitsplatz aussprach.
Abbildung 4: Das Triell in der Echtzeit-Bewertung
8Regierungsforschung.de
In Abbildung 4 sind die gemittelten RTR-Kurven (RTR= Real Time Response) also die Echtzeitbe-
wertungen der Kandidatenaussagen für 7700 Teilnehmer am Debat-O-Meter dargestellt. Die ver-
ringerte Zahl liegt daran, dass nur Teilnehmer betrachtet werden, die sich mindestens 50% der Zeit
am Debat-O-Meter beteiligt haben. Zudem sind die Daten noch ungewichtet, was die Darstellung in
den Amplituden-Ausschlägen etwas verzerrt, aber am Niveauvergleich nur wenig ändert.
Konflikt am Anfang - inhaltliche Schwächen bei Baerbock
Während Armin Laschet nur zu Beginn des Triells bei der Koalitionsfrage besonders angriffslustig
war, erlahmte doch im Laufe des Abends seine Streit- und Kampfeslust. Ob sein Ziel „Kanzler des
Vertrauens“ zu werden erfolgreich sein wird, darf angesichts des wohl eher erfolglosen Kampfes
bezweifelt werden.
Annalena Baerbock war, wie die Daten zeigen, durchaus sympathisch und glaubwürdig, doch in
manchen Punkten zeigte sie inhaltliche Schwächen. So sprach sie von „Deutscher Wende“ statt
Deutsche Einheit. Dann behauptete Baerbock es gäbe ein „Bundesfinanzamt“, was es natürlich nicht
gibt, da die Steuererhebung in Deutschland Ländersache ist. Schließlich behauptete Baerbock, dass
eine Einkommensteuererhöhung ab Einkommen von 100.000 Euro nicht die Unternehmen treffen
würde. Auch das ist nicht korrekt, da es in Deutschland über 2,1 Millionen einkommensteuerpflich-
tige Einzelunternehmer:innen (67% aller Unternehmer) gibt und auch Gesellschafter:innen von Ka-
pitalgesellschaften mit ihren Gewinnen der Einkommensteuer unterliegen. Auch eine – selbst kor-
rigierte – Verwechslung von rechtsextremen Anschlägen in Hanau und Halle zeugte von einer ge-
wissen Fahrigkeit bei Baerbock in der Diskussion. Olaf Scholz verfolgte mitunter eine bei Angela
Merkel abgeschaute Strategie des „sie wissen wer ich bin“. Inhaltlich weitgehend souverän,
schwamm er kurz bei der Diskussion um den Wirecard-Skandal und der jüngsten Durchsuchung im
Finanzministerium. Ansonsten spulte er ruhig und souverän seine Antworten ab und streute – we-
nig hanseatisch – sogar einige witzige Bemerkungen ein. Große Übereinstimmung gab es aber auch:
Insbesondere bei den Maßnahmen zur Corona-Politik waren die Parteidifferenzen eher gering.
Scholz wird als Kanzler gewünscht, Baerbock nicht
Am Ende wurden die Teilnehmer auch nach dem gewünschten Bundeskanzler bzw. der gewünsch-
ten Kanzlerin gefragt: „Wenn man die Bundeskanzlerin/den Bundeskanzler direkt wählen könnte,
für wen würden Sie sich entscheiden?“ Die Ergebnisse sind doch sehr überraschend, angesichts ho-
her Sympathie und zahlreichen positiven Bewertungen bei der Echtzeitmessung der Debatte, liegt
Annalena Baerbock nur auf dem dritten Platz mit 26,8 Prozent der Befragten. Knapp 30 Prozent
wünschen sich Armin Laschet als Kanzler. Deutlicher Sieger hier ist Olaf Scholz, den 43,3 Prozent
aller Befragten sich als Kanzler wünschen.
Bei den drei Schlussstatement des Triells haben sowohl Laschet als auch Scholz von Baerbock ab-
geschaut, die beim ersten Triell auf RTL offensiv vor das Redepult getreten war. Laschet betonte
dabei sowohl das Soziale als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands und das Ziel,
die Menschen „machen zu lassen“. Annalena Baerbock verwies auf die Notwendigkeit eines
9Regierungsforschung.de
sofortigen Politikwechsels in der Klimapolitik. Sie forderte einen „echten Aufbruch“ im Gegensatz
zu einem „weiter so“. Scholz verwies auf die Solidarität während der Corona- und Flutkrise – getreu
dem SPD-Motto mehr Respekt. So forderte er einen Mindestlohn von 12 Euro, eine starke Sozialpo-
litik, aber auch die Stärkung der Wirtschaft.
Bemerkenswert auch welche Themen nicht angesprochen wurden. So wurden die Außen- und Ver-
teidigungspolitik, die Innere Sicherheit und Europa nicht behandelt. Und nur am Rande wurde das
Migrationsthema verhandelt, aber nur unter dem Aspekt des Arbeitskräftemangels. Bei der Bun-
destagswahl 2017 hat letzteres Thema knapp die Hälfte der Sendezeit eingenommen.
Fazit
Die Bundestagswahl 2021 hat unter dem Aspekt politischer Kommunikation und Debattenhäufig-
keit deutlich mehr zu bieten als die Bundestagswahl 2017, wo es nur ein Duell zwischen Merkel und
Scholz gab. Mit drei Triellen und mehreren anderen Debattenformaten trägt dies der zunehmenden
Personalisierung der Politik Rechnung. Zudem hat sich die Öffentlichkeit der Wahlkämpfe durch
die Corona-Pandemie verändert. Straßenwahlkämpfe oder große Versammlungen sind nicht op-
portun. Insofern kommt den Triellen herausragende Bedeutung zu. Mit rund 11 Millionen Zu-
schauer:innen war das Triell das zentrale mediale Ereignis des Wahlkampfes, welches in der Ge-
samtschau der Befunde an Olaf Scholz ging. Aber auch Annalena Baerbock schlug sich gut und selbst
Armin Laschet konnte gegenüber den Erwartungen zulegen. Da die Personalisierung der Politik in
den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat, dürfte auch der zweite Sieg bei einem Triell eher
bei der SPD einzahlen als bei den Mitbewerber:innen.
Literatur
Bachl, Marko (2013a). Die Wahrnehmung des TV-Duells. In: Bachl, Marko;/ Brettschneider, Frank
& Ottler, Simon (Hrsg.), Das TV-Duell in Baden-Württemberg 2011. Wiesbaden: Springer VS. S. 135-
169. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00792-8_7
Bachl, Marko (2013b). Die Wirkung des TV-Duells auf die Bewertung der Kandidaten und die Wahl-
absicht. In: Bachl, Marko;/ Brettschneider, Frank & Ottler, Simon (Hrsg.), Das TV-Duell in Baden-
Württemberg 2011. Inhalte, Wahrnehmungen und Wirkungen. Wiesbaden: Springer VS. S. 171–
198.
Bachl, Marko;/ Käfferlein, Katharina & Spieker, Arne (2013). Die Inhalte des TV-Duells. In: Bachl,
Marko;/ Brettschneider, Frank & Ottler, Simon (Hrsg.), Das TV-Duell in Baden-Württemberg 2011.
Wiesbaden: Springer VS. S. 57-86. https://doi.org/10.1007/978-3-658-00792-8_4
Belok, Felicitas & Heinrich, Tassilo (2017). Alles nur Show? Effekt des TV-Duells auf Performanz-
und Positionssachfragen. In: Faas, Thorsten;/ Maier, Jürgen & Maier, Michaela (Hrsg.), Merkel gegen
Steinbrück. Wiesbaden: Springer VS. S. 125-138. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05432-8_8
10Regierungsforschung.de
Faas, Thorsten & Maier, Jürgen (2004). Chancellor-Candidates in the 2002 Televised Debates. In:
German Politics, 13 (2). S. 300–316.
Faas, Thorsten & Maier, Jürgen (2011). Medienwahlkampf. Sind TV-Duelle nur Show und damit
nutzlos? In: Bytzek, Evelyn & Roßteutscher, Sigrid (Hrsg.), Der unbekannte Wähler? Mythen und
Fakten über das Wahlverhalten der Deutschen. Frankfurt am Main: Campus. S. 99–114.
Faas, Thorsten & Maier Jürgen (2017). TV-Duell und TV-Dreikampf im Vergleich: Wahrnehmungen
und Wirkungen. In: Faas, Thorsten;/ Maier, Jürgen & Maier, Michaela (Hrsg.) Merkel gegen Stein-
brück. Wiesbaden: Springer VS. S. 207-2017. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05432-8_13
Jansen, Carolin & Glogger Isabella (2017). Von Schachteln im Schaufenster, Kreisverkehren und
(keiner) PKW-Maut. Kandidatenagenda, -strategien und ihre Effekte. In: Faas, Thorsten;/ Maier,
Jürgen & Maier, Michaela (Hrsg.), Merkel gegen Steinbrück. Wiesbaden: Springer VS. S. 31-58.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-05432-8_3
Maier, Jürgen (2017). Der Einfluss des TV-Duells auf die Wahlabsicht. In: Faas, Thorsten;/ Maier,
Jürgen & Maier, Michaela (Hrsg.), Merkel gegen Steinbrück. Wiesbaden: Springer VS. S. 139-155.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-05432-8_9
Maier, Jürgen (2007a). Eine Basis für rationale Wahlentscheidungen? Die Wirkungen des TV-Duells
auf politische Kenntnisse. In: Maurer, Marcus;/ Reinemann, Carsten;/ Maier, Jürgen u. a. (Hrsg.),
Schröder gegen Merkel. Wahrnehmung und Wirkung des TV-Duells 2005 im Ost-West-Vergleich.
Wiesbaden: Springer VS. S. 129–143.
Maier, Jürgen (2007b). Erfolgreiche Überzeugungsarbeit. Urteile über den Debattensieger und die
Veränderung der Kanzlerpräferenz. In: Maurer, Marcus;/ Reinemann, Carsten;/ Maier, Jürgen;/ u.
a. (Hrsg.), Schröder gegen Merkel. Wahrnehmung und Wirkung des TV-Duells 2005 im Ost-West-
Vergleich. Wiesbaden: Springer VS. S. 91–109.
Maier, Michaela (2007c). Verstärkung, Mobilisierung, Konversion. Wirkungen des TV-Duells auf die
Wahlabsicht. In: Maurer, Marcus;/ Reinemann, Carsten;/ Maier, Jürgen u. a. (Hrsg.), Schröder gegen
Merkel. Wahrnehmung und Wirkung des TV-Duells 2005 im Ost-West-Vergleich. Wiesbaden: Sprin-
ger VS. S. 145–165.
Maier, Jürgen & Faas, Thorsten (2011). Das TV-Duell 2009. Langweilig, wirkungslos, nutzlos? Er-
gebnisse eines Experiments zur Wirkung der Fernsehdebatte zwischen Angela Merkel und Frank-
Walter Steinmeier. In: Oberreuter, Heinrich (Hrsg.), Am Ende der Gewissheiten: Wähler, Parteien
und Koalitionen in Bewegung. München: Olzog. S. 147–166.
Maier, Jürgen & Faas, Thorsten (2019). TV-Duelle. Grundwissen Politische Kommunikation. Wies-
baden: Springer VS.
11Regierungsforschung.de
Maier, Jürgen;/ Faas, Thorsten & Maier, Michaela (2013). Mobilisierung durch Fernsehdebatten.
Zum Einfluss des TV-Duells 2009 auf die politische Involvierung und die Partizipationsbereitschaft.
In: Weßels, Bernhard;/ Schoen, Harald;/ Gabriel, Oscar W. (Hrsg.), Wahlen und Wähler. Wiesbaden:
Springer VS. S. 79–96.
Maier, Jürgen;/ Faas, Thorsten & Maier, Michaela (2014). Aufgeholt, aber nicht aufgeschlossen. Aus-
gewählte Befunde zur Wahrnehmung und Wirkung des TV-Duells 2013 zwischen Angela Merkel
und Peer Steinbrück. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 45. S. 38–54.
Maier, Jürgen;/ Maier, Michaela;/ Maurer, Marcus;/ Reinemann, Carsten & Meyer, Vincent (Hrsg.)
(2009). Real-time response measurement in the social sciences. Methodological perspectives and
applications. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Maurer, Marcus & Reinemann, Carsten (2007). Personalisierung durch Priming. Die Wirkungen des
TV-Duells auf die Urteilskriterien der Wähler. In: Maurer, Marcus;/ Reinemann, Carsten;/ Maier,
Jürgen u. a. (Hrsg.), Schröder gegen Merkel. Wahrnehmung und Wirkung des TV-Duells 2005 im
Ost-West-Vergleich. Wiesbaden: Springer VS. S. 111–128.
Metz, Thomas;/ Wagschal, Uwe;/ Waldvogel, Thomas;/ Bachl, Marko;/ Feiten, Linus & Becker,
Bernd (2016). Das Debat-O-Meter. Ein neues Instrument zur Analyse von TV-Duellen. In: ZSE Zeit-
schrift für Staats- und Europawissenschaften. Journal for Comparative Government and European
Policy, 14. S. 124–149.
Range, Julia (2017). Wissens-und Partizipations-Gaps. Führte das TV-Duell 2013 zu einer politi-
schen und kognitiven Mobilisierung? In: Faas, Thorsten;/ Maier, Jürgen;/ Maier, Michaela (Hrsg.),
Merkel gegen Steinbrück. Analysen zum TV-Duell vor der Bundestagswahl 2013. Wiesbaden: Sprin-
ger VS. S. 75–86.
Reinemann, Carsten;/ Maier, Jürgen;/ Faas, Thorsten & Maurer, Marcus. (2005). Reliabilität und
Validität von RTR-Messungen. In: Publizistik, 50. S. 56–73.
Waldvogel, Thomas (2019). Das TV-Duell Timmermans gegen Weber. Wahrnehmung und Wirkun-
gen von TV Debatten am Beispiel der Europawahl 2019. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl),
50 (4), 736-753. https://doi.org/10.5771/0340-1758-2019-4-736.
Waldvogel, Thomas (2020a). TV-Duelle und Landtagswahlen. Ein wirkungsvolles Instrument der
Wahlkampfkommunikation? In: Zeitschrift für Politik, 67. S. 335–368.
Waldvogel, Thomas (2020b). Applying virtualized real-time response measurement on TV-discus-
sions with multi-person panels. In: Statistics Politics and Policy, 11. S. 23–58.
Waldvogel, Thomas & Metz, Thomas (2020). Measuring real-time responses in real-life settings. In:
International Journal of Public Opinion Research, 32. S. 659–675.
12Regierungsforschung.de
13Sie können auch lesen