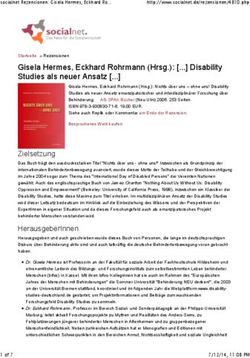In der Kritik: Gender Studies und ihre Diskreditierung in der scientific com-munity - DVPW
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
In der Kritik: Gender Studies und ihre Diskreditierung in der scientific com-
munity
(unveröffentlichter Vortragstext, DVPW-Kongress 2018, Frankfurt am Main)
Marion Näser-Lather, Armin Sauermann
1. Einführung
In den letzten Jahren haben die Gender Studies in Deutschland Kritik aus der scientific com-
munity erfahren. In unserem Beitrag möchten wir die diesbezüglichen Diskurse nachzeichnen,
ihre Wirkung in verschiedenen gesellschaftspolitischen Feldern darstellen und die Verschrän-
kung der Argumentationen genderkritischer Wissenschaftler_innen mit aktuellen wie histori-
schen antifeministischen Diskursen untersuchen.
Unsere Ausführungen basieren auf einer Diskursanalyse (angelehnt an Jäger 2009) von 24
Texten von Wissenschaftler*innen, die Gender Studies kritisieren, einer Untersuchung ihrer
Rezeption in online- und offline-Medien, themenzentrierten Interviews (Witzel 2000, Schorn
2000) mit Vertreter_innen von Fachgesellschaften, angegriffenen Genderwissenschaftlerinnen
und Kritiker_innen von Gender Studies, sowie einer teilnehmenden Beobachtung bei der Be-
wegung „Demo für Alle“. Unsere Analyse stellt erste Ergebnisse des „Anti-‚genderistische‘ Ar-
gumentationen in akademischen Kontexten“ im Rahmen der BMBF-Verbundstudie „Krise der
Geschlechterverhältnisse? Anti-Feminismus als Krisenphänomen mit gesellschaftsspaltendem
Potenzial“ (Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung Marburg) vor.
2. Diskurse
Wer sind nun die Kritiker_innen? Anhand ihrer Publikationstätigkeit (etwa in Sachbüchern, auf
Internetblogs und -plattformen) und ihrer Äußerungen (z.B. in Interviews) haben wir 17 Wis-
senschaftler_innen identifiziert, die im Zeitraum zwischen 2006 und 2017 Kritik an Gender
Studies und Gender Mainstreaming formuliert haben. Von diesen wurden anhand einer Impact-
Analyse und anhand des Kriteriums der kontinuierlichen Präsenz im Wissenschaftsbetrieb 10
für die Analyse ausgewählt (siehe Tabelle 1).
Nur ein Drittel kommt aus naturwissenschaftlichen, die anderen aus geistes- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächern. Unter den genderkritischen Wissenschaftler_innen befinden sich
zahlreiche (ehemalige) Hochschullehrer_innen.
Welche Kritik formulieren sie? Zunächst muss angemerkt werden, dass sie die Gender Studies
ebenso wie andere rechte und konservative Akteur*innen häufig gemeinsam mit dem Pro-
gramm des Gender Mainstreaming und Phänomenen der Liberalisierung der Geschlechterver-
hältnisse unter die pejorativen Begriffe Genderismus oder Gender-Ideologie subsummieren,
wodurch die Analyse wesentlich erschwert wird – eine Entdifferenzierungsstrategie, durch die
über den leeren Signifikant „Gender“ den Gender Studies allerhand konträre Eigenschaften
und Ziele zugeschrieben werden können (vgl. Mayer et al. 2018).
1Name Fachgebiet h-index
Prof. em. Dr. Gerhard Amendt Soziologie 10
Prof. em. Dr. Günter Buchholz Betriebswirtschaftslehre 17
Dr. habil. Heike Diefenbach Soziologie, Ethnologie 23
Prof. em. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz Philosophie, Politikwissenschaft 5
Prof. Dr. Ulrich Kutschera Evolutions- und Pflanzenbiologie 39
Prof. Dr. Axel Meyer Evolutionsbiologie 107
Prof. Dr. Harald Seubert Christliche Philosophie 4
Prof. em. Dr. Manfred Spieker Christliche Sozialwissenschaften 9
Prof. em. Dr. Manfred Spreng Neurophysiologie 10
Dr. Alexander Ulfig Philosophie 7
Tabelle 1: genderkritische Wissenschaftler_innen
Der erste Diskursstrang stellt die Gender Studies mittels falscher Behauptungen und tenden-
ziöser Darstellungen als unwissenschaftlich dar.
Eine wesentliche Argumentationsfigur in diesem Zusammenhang ist der Vorwurf des radikalen
Dekonstruktivismus: Gender Studies fassten Geschlecht als vollständig sozial konstruiert auf
und ließen den Körper außer Acht. Beispielhaft sei eine Äußerung des Evolutionsbiologen Ulrich
Kutschera zitiert: „Menschen [werden] angeblich als geschlechtsneutrale Säuger geboren und
danach von der Gesellschaft entweder männlich oder weiblich geprägt“ (Kutschera 2016: 55).
Diese Unterstellung wird flankiert von dem Diskursfragment der mangelnden wissenschaftli-
chen Integrität. Beispielsweise wird Genderforscher*innen Korruption vorgeworfen – sie hät-
ten sich ihre Lehrstühle erschlichen, Gender Studies sei als Lobbying für Wissenschaftler_innen
zu verstehen, die sich auf diese Art und Weise selbst alimentieren wollten (z.B. Diefenbach
2017), eine wissenschaftlichen Kriterien genügende Evaluation der Gender Studies fände nicht
statt (so z.B. Buchholz 2014). Zudem wählen einige der genderkritischen Wissenschaftler_in-
nen das Stilmittel der ad-hominem-Argumentation, indem sie Genderforscher_innen als „kin-
derlose Lesben“ angreifen (Kutschera 2016: 398) oder ihnen Neid auf die privilegierte Stellung
der Männer als Leitmotiv unterstellen (etwa Amendt 2016).
Zudem werden Gender Studies als gegenstands- und nutzlos gekennzeichnet, indem, z.T. ver-
bunden mit männerrechtlichen Argumentationen, Gegenstände des Faches als inexistent ent-
realisiert werden, nämlich das Patriarchat und mangelnde Gleichberechtigung (Amendt 2016,
Diefenbach 2012).
Weiterhin wird den Gender Studies eine politische Motivation als primärer Antrieb ihrer For-
schungstätigkeit unterstellt (Amendt 2016). Aus der Entwicklung der Gender Studies aus fe-
ministischen Bewegungen wird ein Machtwille abgeleitet. Gender Studies dienen dazu, Männer
zu unterdrücken (Buchholz 2014) und die „Gender-Ideologie“ global durchzusetzen. Diese Be-
hauptung wird in eine verschwörungstheoretische Argumentation eingebettet. Auf der Welt-
frauenkonferenz in Peking sei von Feministinnen ein Plan zur Beförderung der Homosexualität
und zur Abschaffung der Geschlechter beschlossen worden. Die Umsetzung sollte mit Hilfe von
Gender Mainstreaming und Gender Studies erfolgen (Kutschera 2016: 44-47). Als Endziel wird
eine totalitäre Gesellschaft imaginiert (z.B. Amendt 2016, Buchholz 2014).
2Im Zusammenhang mit dieser Defamierung der Gender Studies als unwissenschaftliche, poli-
tische motivierte „Ideologie“ wird das Fach im zweiten Diskursstrang dämonisiert, indem das
verschwörungstheoretische Bedrohungszenario um konkrete Gefahren erweitert wird, die von
den Gender Studies ausgehen.
Zum einen widerspricht „Gender“ der evolutionsbiologisch beziehungsweise durch die Schöp-
fungsordnung vorgegebenen Charakteristika und Bedürfnisse von Männern, Frauen und Kin-
dern (Kutschera 2016: 307; Seubert 2014; Gerl-Falkovitz 2009). Als Folgen werden Depressi-
onen bei Frauen, Bindungsunfähigkeit bei Männern, und eine beeinträchtigte Hirnentwicklung
bei Kindern (durch Fremdbetreuung) imaginiert (Spreng 2015); zudem münde der Sexualkun-
deunterricht der Vielfalt, der als direkter Ausfluss der „genderideologisch“ beeinflussten In-
doktrination in den Schulen gesehen wird, in Frühsexualisierung und Pädophilie, ebenso wie
die Ehe für alle (Kutschera 2016: 388, Spieker 2015). Insbesondere das Kindeswohl fungiert
hier als wirkungsmächtige Chiffre, wie es auch Imke Schmincke für neurechte Diskurse gezeigt
hat (vgl. Schmincke 2015).
Gender Studies werden darüber hinaus als Gefahr für die Gesellschaft konfiguriert. Angeführt
werden im Fragment des Degenerationsdiskurses folgende Argumente: Gender Studies
komme ein gesellschaftsspaltendes Potential zu, da sie Männer als Täter und Frauen als Opfer
darstellten (Amendt 2016), die deutsche Sprache werde durch Sternchen, Binnen-I und Un-
terstrich zerstört (Gerl-Falkovitz 2009: 173), die Gender Studies führten zu einer politisch kor-
rekten Meinungsdiktatur (Amendt 2016, Meyer pos. 5512) und zur Zerstörung der heterose-
xuellen Familie (z.B. Spieker 2015), die häufig als unverzichtbare Keimzelle der Gesellschaft
imaginiert wird – hier zeigt sich eine Verbindung zu nationalistischen Diskursen.
Zudem wird eine Gefahr für die Wissenschaft konstatiert: Alle Kritiker_innen lehnen Dekon-
struktivismus und postmodernes Denken ab, da sie kein gesichertes Wissen und keine Tren-
nung von Politik und Wissenschaft zuließen. Dies führe zu Willkür und Beliebigkeit. Dabei ar-
gumentierten die einen von einem strukturalistisch-positivistischen Wissenschaftsverständnis
aus (Amendt, Kutschera, Meyer, Buchholz, Diefenbach, z.T. Ulfig), die anderen christlich fun-
diert (Gerl-Falkovitz, Seubert, Spieker; bei Spreng sind beide Elemente vertreten).
3. Wirkung und Rezeption
Anhand von Interviews mit Vertreter_innen von Fachgesellschaften und Professor_innen aus
verschiedenen Fachbereichen lassen sich folgende Beobachtungen feststellen:
Die selbsternannten Kritiker_innen sind in ihren jeweiligen Fachbereichen zwar oft bekannt,
werden aber nur fachbezogen rezipiert, ihre Beschäftigung mit Gender-Studies wird als eine
Art „Privatvergnügen“ gesehen und hat keine Bedeutung fürs Feld. Auffällig ist, dass die meis-
ten Kritiker_innen ausschließlich im eigenen Feld bekannt sind, während sie in anderen Fach-
bereichen gar keine Relevanz finden. Die Ausnahme stellt hierbei Kutschera da, der eine grö-
ßere Reichweite hat.
Die fachinterne Beschäftigung der Kritiker_innen weist inhaltlich keine Überschneidungen mit
ihrer Kritik an Gender-Thematik auf. Ausnahmen sind hier teilweise die Soziologen und Sprach-
wissenschaftler, die in ihrer Kritik zumindest auf eigene Forschung verweisen können.
3Trotz der relativ schwachen Rezeption der Kritiker_innen innerhalb der Wissenschaft ist fest-
zustellen, dass sie in verschiedenen Medien durchaus Gehör finden. Wir haben ‚Mainstream-
Medien‘ und eine Vielzahl an Blogs und alternativen (sprich rechten) Nachrichtenplattformen
systematisch auf Erwähnungen der Kritiker_innen hin durchsucht. Dabei war festzustellen,
dass die Kritiker_innen in den ‚Mainstream-Medien‘ meist im Zuge einer Buchveröffentlichung
und der daraus resultierenden Diskussion auftreten, während sie v.a. in rechten Milieus regulär
und oft als Experten für Gender-Thematiken zitiert, interviewt und zu Veranstaltungen als
Redner eingeladen werden, so z.B. bei der Demo für Alle oder der Konrad Adenauer-Stiftung,
die im Februar eine Veranstaltung mit dem Titel „Gender, Instrument der Umerziehung?“ ab-
hielt.
Insbesondere auf Online-Plattformen und rechten Blogs werden die Argumentationen der Kri-
tiker_innen genutzt, um anti-feministische und anti-Gender-Studies Positionen den Schein von
wissenschaftlicher Autorität zu verleihen und damit diese Positionen zu legitimieren. Darüber
hinaus publizieren die Kritiker_innen auch selbst in rechten Medien (siehe Tabelle 2).
ef-maga-
freiewelt.net Pi.news.net achgut.com Sezession.de
zin.de
Zi- Zi- Zi-
Name Autor Autor Autor Autor Zitate Autor Zitate
tate tate tate
Amendt 3 19 1 12 2 1 2
Buchholz 30 2 1
Diefenbach 1 8 3 4 1
Gerl-Falkovitz 1 5 1 1 1 1
Kutschera 3 8 1 1 3
Meyer 5 1 1
Seubert 2 2 16 7
Spieker 3 9 2 1
Spreng 1 2
Ulfig 156 11 19 4 1
Tabelle 2: Präsenz genderkritischer Wissenschaftler_innen in rechten Medien
Einige der Kritiker_innen sind in rechten Milieus durch ihre eigenen Blogs und durch aktives
Engagement in der rechten Szene stark vernetzt. So z.B. der Ökonomie Professor Gerhard
Amendt, der Gründungsmitglied von agens.ev ist, einem Verein, der heteronormative und es-
sentialistische Ansichten über Geschlecht und Geschlechterrollen verbreitet und Gender, Gen-
der Mainstreaming und die Gender Studies kritisiert. Amendt ist gleichzeitig eine der Schlüs-
selfiguren der Männerrechtsbewegung.
Eine Anzahl von Studien wiesen schon darauf hin, dass antifeministische Positionen als Binde-
glied und „symbolischer Kitt“ fungieren, die Allianzen zwischen der Neuen Rechten, konserva-
tiven Milieus und fundamentalistischen religiösen Gruppen ermöglichen. Weitere Brückendis-
kurse, die auch von den Kritiker*innen bedient werden und sich auf den entsprechenden Platt-
formen finden, sind Homo- und Transphobie sowie rassistische und migrationskritische Positi-
onen.
44. Kontextualisierung
Die genderkritischen Argumentationen von Wissenschaftler_innen sind im Kontext des Erstar-
kens neokonservativer und populistischer Akteur_innen zu sehen. Gender Studies und Gender
Mainstreaming werden in ganz Europa durch neurechte Bewegungen und Parteien sowie
christliche Gruppierungen problematisiert (s. Kuhar/Paternotte 2018).
In Deutschland kamen entsprechende Angriffe von neurechten Gruppen und Parteien wie der
AFD, männerrechtlichen Gruppierungen (s. Kemper 2014), konservativ- religiösen Bewegun-
gen wie der „Demo für Alle“ oder Publizist*innen (z.B. Gabriele Kuby, Birgit Kelle oder Akif
Pirinçci).
Die Diskursstränge und Argumentationsfiguren gleichen sich: Sehr häufig werden Gender Stu-
dies als totalitäre Ideologie der Umerziehung konfiguriert, die von staatlichen Institutionen
oktroyiert werde, verbunden mit antietatistischen, nationalistischen und anti-europäischen
Haltungen. In der Neuen Rechten, beispielsweise bei der Demo für alle, werden heterosexuelle
Familien als soziale beziehungsweise kulturelle „Keimzelle“ identifiziert, die durch Gender im
Dienste des Kapitalismus bedroht werde, verbunden mit Diskursen um Mutterschaft (vgl.
Hark/Villa 2015).
Die genderkritischen Wissenschaftler*innen gehen in ihrer erkenntnistheoretischen Kritik je-
doch über die Diskursivierungen in den anderen Feldern hinaus und vermögen diesen durch
biologistische wie christlich-hermeneutische Argumentationen detaillierte Begründungen zu
liefern.
Die Kritik an den Gender Studies kann als Reaktion auf Liberalisierungsmaßnahmen wie die
Sexualpädagogik der Vielfalt gesehen werden, aber auch als Reaktion auf gesellschaftliche
Phänomene wie Komplexitätssteigerung, die Zunahme von Unsicherheit und die ökonomische
Krise. So werden Gleichstellungspolitik und Geschlechterforschung etwa für Prekarisierungs-
prozesse verantwortlich gemacht (s. Wimbauer et al. 2015).
Historische Parallelen lassen sich zu antifeministischen Bewegungen zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts feststellen. Während des Kaiserreichs emergierten antifeministische Aktivitäten als
Reaktion auf die Liberalisierung der Geschlechterverhältnisse und die Frauenbewegung (s.
Planert 1998). Damals wie heute fungiert die wissenschaftliche Diskursebene als Letztbegrün-
dung – ein Beispiel stellt die Abhandlung von Paul Möbius über den physiologischen Schwach-
sinn des Weibes dar (Möbius 1901).
In der Konstruktion einer weiblichen Natur vollzieht sich noch immer eine Doppelfigur von
Idealisierung und Othering. Misogyne Konfigurationen der Frau durch Philosophen als in der
Immanenz verhaftetes Naturwesen haben eine lange Tradition (vgl. Stopczyk 1997). Eine Ge-
meinsamkeit kann zudem in der diskursiven Anlagerung strukturell antisemitischer Argumen-
tationsfiguren an antifeministische Diskurse gesehen werden.
Im Unterschied zu damals hat eine diskursive Verschiebung stattgefunden von der Kritik an
geforderter Gleichberechtigung hin zum so genannten Speerspitzendiskurs, das heißt dass die
genderkritischen Wissenschaftler*innen sich häufig als Verfechter gleicher Rechte inszenieren,
sich aber gleichzeitig gegen Dekonstruktion und die Infragestellung der Zweigeschlechtlichkeit
positionieren.
5Literatur
Amendt, Gerhard (2016), Neid und Missgunst – der schwankende Unterbau der Gender Stu-
dies, https://www.cuncti.net/geschlechterdebatte/936-neid-und-missgunst-der-schwan-
kende-unterbau-der-gender-studies (01.11.2017).
Buchholz, Günter (2014), Gender Studies – Die Niedersächsische Forschungsevaluation und
ihre offenen Fragen, https://serwiss.bib.hs-hannover.de/files/405/Gender_Studies_-_Die_Nie-
ders%C3%A4chsische_Forschungsevaluation_und_ihre_offenen_Fragen.pdf (23.10.2017).
Diefenbach, Heike (2012), Unsinn der Woche: Ute Scheub klärt uns über das Patriarchat auf,
https://sciencefiles.org/2012/09/08/unsinn-der-woche-ute-scheub-klart-uns-uber-das-patriar-
chat-auf/ (12.06.2018).
Diefenbach, Heike (2017), Basenwirtschaft: Gender-Korruption an der Philipps-Universität
Marburg, https://sciencefiles.org/2017/12/04/basenwirtschaft-gender-korruption-an-der-phi-
lipps-universitat-marburg/ (12.06.2018).
Gehrmann, Anne/Klose, Lisa-Marie/Kula, Elisabeth/Schäder, Lisa (2015), Familie, Ehe, Sexu-
alität und Abtreibung – ein Hegemonieprojekt von rechts? Studentisches Forschungsprojekt
(Betreuung: Prof. Ursula Birsl), Institut für Politikwissenschaft, Philipps-Universität Marburg
(unveröff. Manuskript).
Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara (2009), Frau – Männin – Menschin. Zwischen Feminismus und
Gender, Kevelaer: Butzon & Bercker.
Hark, Sabine/Villa, Paula Irene (2015), „Anti-Genderismus“ – Warum dieses Buch? In: Dies.
(Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Aus-
einandersetzungen. Bielefeld: transcript Verlag, S. 7-14.
Jäger, Siegfried (2009), Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung, 5. Auflage, Münster: Un-
rast-Verlag.
Kemper, Andreas (2014), Keimzelle der Nation? Familien- und geschlechterpolitische Positi-o-
nen der AfD – eine Expertise, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Kováts, Eszter/ Põim, Maari (eds.) (2015), Gender as symbolic glue. The position and role of
conservative and far right parties in the anti-gender mobilizations in Europe. Budapest: Foun-
dation for European Progressive Studies/Friedrich-Ebert-Stiftung, http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/budapest/11382.pdf (03.05.2018).
Kuhar, Roman/Paternotte, David (Hg.) (2018), Anti-gender campaigns in Europe : mobilizing
against equality. Lanham und New York: Rowman & Littlefield International.
Kutschera, Ulrich (2016), Das Gender-Paradoxon. Mann und Frau als evolvierte Menschenty-
pen, Berlin: LIT.
Mayer, Stefanie/Ajanovic, Edma/ Sauer, Birgit (2018), Kampfbegriff ‚Gender-Ideologie’. Zur
Anatomie eines diskursiven Knotens. In: Lang, Juliane/Peters, Ulrich (Hg.): Antifeminismus in
Bewegung. Aktuelle Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt. Hamburg: Marta Press, S.
37-59.
6Meyer, Axel (2015), Adams Apfel und Evas Erbe: Wie die Gene unser Leben bestimmen und
warum Frauen anders sind als Männer, München: Bertelsmann.
Möbius, Paul Julius (1901), Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, 2. Auflage.
Halle a.d. Saale: Marhold.
Planert, Ute (1998), Antifeminismus im Kaiserreich: Diskurs, soziale Formation und politische
Mentalität. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht.
Schmincke, Imke (2015), Das Kind als Chiffre politischer Auseinandersetzung am Beispiel
neuer konservativer Protestbewegungen in Frankreich und Deutschland. In: Hark, Sabine/Villa,
Paula-Irene (Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller po-
litischer Auseinandersetzungen. Bielefeld: transcript Verlag, S. 93-108.
Schorn, Ariane (2000), ‘Das „themenzentrierte Interview“. Ein Verfahren zur Entschlüsselung
manifester und latenter Aspekte subjektiver Wirklichkeit’, Forum Qualitative Sozialfor-schung,
1 (2), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002236 (5.02.2011).
Seubert, Harald (2014), ‘Zuhause sein im Leib? Überlegungen zu Gender und Sexualität’, in
Klose, Joachim (Ed.) Heimatschichten, Wiesbaden: Springer VS, 257-289.
Spieker, Manfred (2015), Gender Mainstreaming aus sozialethischer Sicht. In: Kath.net vom
26.01.2016, http://www.kath.net/news/53733 (02.04.2018).
Spreng, Manfred (2015), ‘Kinder – die Gefährdung ihrer normalen (Gehirn-) Entwicklung durch
Gender Mainstreaming’, in Späth, Andreas/Spreng, Manfred (Hg.): Vergewaltigung der
menschlichen Identität: Über die Irrtümer der Gender-Ideologie, Ansbach: Verlag Logos Editi-
ons, 99–122.
Stopczyk, Annegret (1997), Muse, Mutter, Megäre. Was Philosophen über Frauen denken Ber-
lin: Aufbau-Taschenbuch-Verlag
Ulfig, Alexander (2016), Wege aus der Beliebigkeit: Alternativen zu Nihilismus, Postmodere
und Gender-Mainstreaming, Baden-Baden: Deutscher Wissenschaftsverlag.
Wimbauer, Christine/Motakef, Mona/Teschlade, Julia (2015), Prekäre Selbstverständlichkeiten.
Neun prekarisierungstheoretische Thesen zu Diskursen gegen Gleichstellungspolitik und Ge-
schlechterforschung. In: Hark, Sabina/Villa, Paula Irene (Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität
und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Bielefeld:
transcript Verlag, S. 41-58.
Witzel, Andreas (2000), ‘Das Problemzentrierte Interview’, Forum Qualitative Sozialfor-schung,
1 (1), http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-00witzel-d.htm (6.02.2011).
7Sie können auch lesen