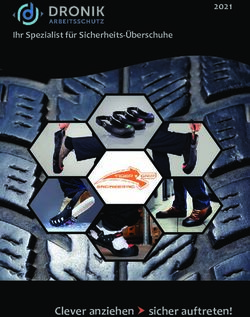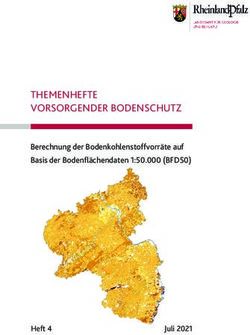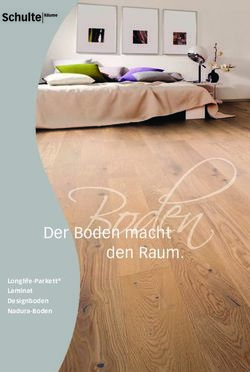Die Weinbergsböden von Hessen - Umwelt und Geologie Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 7 2. überarbeitete Auflage - Hessisches Landesamt ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Umwelt und Geologie Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 7 2. überarbeitete Auflage Die Weinbergsböden von Hessen
Umwelt und Geologie Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 7, 2. überarbeitete Ausgabe Die Weinbergsböden von Hessen Wiesbaden, 2022 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Impressum
Umwelt und Geologie
Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 7, 2. überarbeitete Auflage
ISSN 1610-5931
ISBN 978-3-89531-618-0
Die Weinbergsböden von Hessen
Bearbeiter: Dr. Peter Böhm
Dr. Klaus Friedrich Umweltamt Wiesbaden
Katrin Lügger HLNUG, Dez. G3
Prof. Dr. Karl-Josef Sabel
Titelbild: Weinberg an der Flörsheimer Warte
(Foto: Nico Schuhmacher)
Herausgeber, © und Vertrieb:
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Rheingaustraße 186
65203 Wiesbaden
Telefon: 0611/69 39-111
Telefax: 0611/69 39-113
E-Mail: vertrieb@hlnug.hessen.de
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Herausgebers.Vorwort
Böden sind wert- Arbeit der Winzerin oder des Winzers beschreiben.
voll und lebens- Von Bedeutung sind dabei neben der Kunst des Kel-
notwendig. Nicht terns die Expertise im Winzerhandwerk, das Klima
allein, weil sie die und vor allem die Böden und ihr Ausgangsgestein.
L eb en sg r u nd l a g e Der Bedeutung des Bodens im Weinbau trug auch
für Flora und Fauna das Kuratorium des “Boden des Jahres” Rechnung.
und den Menschen Im Jahr 2014 wurde der Weinbergsboden als Boden
sind, weil wir auf des Jahres gekürt.
ihnen unsere Nah-
rung produzieren, Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt
sondern auch, weil und Geologie (HLNUG) möchte mit dieser Broschüre
sie Schadstoffe spei- Winzerinnen, Winzer und Weinbegeisterte in Hes-
chern und abbauen sen anregen, sich die „Bodenwelt“ ihrer Weine zu
und so Sickerwasser erschließen.
und Grundwasser schützen. Sie haben auch interes-
sante Geschichten zu erzählen, und sie können ei- Mit der zweiten überarbeiteten Auflage wurde eine
ner Landschaft und ihren typischen Produkten, z. B. Vielzahl von Aspekten aktualisiert. Ein Beispiel sei
dem Wein, einen unverwechselbaren Charakter ver- der Weinbaustandortviewer, der mittlerweile in der
leihen. zweiten Auflage mit aktuellen Daten und erweiterter
Funkt ionalität vorliegt.
Dieser unverwechselbare Charakter stellt ein Qua-
litätsmerkmal der Weine dar und wird gemäß eines
in Frankreich entstandenen Konzeptes als Terroir be- Dr. Thomas Schmid
zeichnet.
Terroir kann sinngemäß als „Herkunft“ oder „Hei-
mat“ des Weines übersetzt werden und soll die Cha-
Präsident
rakteristika einzelner Weinbaugebiete, das Zusam- des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und
menspiel der natürlichen Standortfaktoren mit der Geologie
3Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 Boden und Wein, geowissenschaftliche Aspekte des Terroirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Entstehung der heutigen Weinbergsböden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Gesteine, Böden und Bodenzustand der Weinbaugebiete Hessens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Oberer Rheingau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Unterer Rheingau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3 Hessische Bergstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Kleine Bergstraße (Odenwälder Weininsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5 Überprägung der natürlichen Böden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.1 Rigolen der Böden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.2 Bodenerosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.5.3 Stofflicher Bodenzustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5.4 Flurneuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5.5 Maßnahmen bei der Neuanlage von Weinbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6 Weinbergslage und Bodenheterogenität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Verfügbare Daten zu Standortfaktoren der hessischen Weinbaugebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.1 Weinbergsbodenkartierung und erste Bodenmanuskriptkarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2 Der Weinbaustandortatlas als mittelmaßstäbige Betrachtungsebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3 Die großmaßstäbige Weinbaustandortkarte für die Weinbaupraxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.4 Weinbaustandortinformation 1: 5 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.4.1 Das Kartenwerk BFD5W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.4.2 Der Weinbaustandortviewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5 Schriftenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Abkürzungen
B(a)P Benzo(a)pyren
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz
BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
DDT Dichlor-Diphenyl-Trichlorethan
dl-PCB dioxinähnliche Polychlorierte Biphenyle
HCB Hexachlorbenzol
HCH Hexachlorcyclohexan
HLNUG Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, bis 2016 Hessisches Landesamt für Umwelt
und Geologie (HLUG)
nFK nutzbare Feldkapazität
PAK Polyzyklische Kohlenwasserstoffe
PCB Polychlorierte Biphenyle
PCDD/F Polychlorierte Dibenzodioxine und -furane
TM Trockenmasse
TOC gesamter organischer Kohlenstoff (total organic carbon)
WeinG Deutsches Weingesetz
WHO-TEq Toxizitätsäquivalent nach WHO (2005)Die Weinbergsböden von Hessen
1 Boden und Wein, geowissenschaftliche Aspekte des Terroirs
Unter dem Begriff Terroir werden neben der Arbeit Reben nutzen den Boden nicht nur zur Verankerung,
der Winzerin und des Winzers die natürlichen Fak- sondern in erster Linie zur Wasser- und Nährstoff-
toren zusammengefasst, die einen Weinberg kenn- aufnahme. Die pflanzenphysiologisch relevanten
zeichnen und Einfluss auf die Qualität und den Ge- Eigenschaften des Bodensubstrates sind seine Mi-
schmack des Weines nehmen (Abb. 1). Die Kombina- neralogie, der Kalk- und Säuregehalt, aber auch die
tion der Faktoren verleiht jeder Lage ihr bestimmtes „Bodenart“ genannte Korngrößenzusammenset-
Terroir, das sich in ihren Weinen über die Jahre mehr zung, d. h. der Feinboden und der Steingehalt. Ge-
oder weniger einheitlich ausdrückt (Gladstones & rade die Bodenart gewinnt entscheidenden Einfluss
Smart 2003, Hoppmann et al. 2017). Unabhängig von auf den Wasser- und Lufthaushalt, z. B. auf die Men-
den Bewirtschaftungsmethoden und der Weinberei- ge an pflanzenverfügbarem Bodenwasser, das gegen
tung wird dem Boden, synonym dem Gestein, zuge- die Schwerkraft im Wurzelraum gespeichert werden
schrieben, den speziellen Charakter eines Weines zu kann und nicht versickert. Daneben spielen auch
prägen. Bodeneigenschaften bestimmen nicht allein Grund- und Stauwassereinflüsse eine Rolle. Gestein
das Wachstum der Reben, sondern beeinflussen auch und Boden beeinflussen auch das für Rebenwachs-
den Charakter der Trauben, die Mineralität ihres tum und Traubenreife bedeutende Mikroklima. So
Saftes und folglich auch den Geschmack des Weines. hängt z. B. die Erwärmbarkeit des Bodens eng mit
Natürliche
Gegebenheiten
Gestein, Boden,
Klima, Topographie
Weinbauliche Kellerwirtschaftliche
Maßnahmen Maßnahmen
Qualitätsstrategie,
Anschnitt, Bodenpflege,
Terroir Ausbauweise
Düngung, Bewässerung
Regionaler Einfluss
Geschichte, Kultur,
Weinbaugemeinden
Abb. 1: Einflussaspekte der Terroir-Bewertung (nach: Königer et al. 2002).
5Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
dem Bodenwasserhaushalt, der Luftzirkulation im Bodeneigenschaften wie Sand-, Ton- und Kalkge-
Boden und der Bodenfarbe an der Oberfläche zu- halt bzw. Basenhaushalt beeinflussen Lebendigkeit,
sammen. Deswegen bevorzugen Pflanzen bestimmte Säureempfinden und Körper der ausgebauten Weiß-
Standorte, andere dagegen meiden sie. weine (hier Riesling), sofern in der Kellerwirtschaft
keine maßgebliche Überprägung im Ausbau her-
Die Winzerinnen und Winzer berücksichtigen die vorgerufen wird. Im Projekt Terroir Hessen (Böhm
heterogenen Bodeneigenschaften bei der Wahl des et al. 2008) konnten darüber hinaus auch standort
Edelreises oder der Unterlage, beim Anschnitt und charakteristische Aromendiagramme herausgearbei-
der Pflege der Reben. Darüber hinaus verändern sie tet werden.
durch tiefgründiges Umwenden und Durchmischen
(das Rigolen) den Boden, um einen einheitlichen, Die Bewertung des Bodeneinflusses auf den Ge-
für die Rebe gut durchwurzelbaren Bodenraum zu schmack des Weines wird zwar hinsichtlich der
schaffen. Bedeutung des Klimas kontrovers diskutiert, doch
wird zunehmend die Authentizität des Standor-
Über den Einfluss auf die Menge und die Qualität tes für die geschmackliche Ausrichtung des Weines
des Ertrags hinaus wird dem Boden auch zugeschrie- hervorgehoben (Schenk zu Tautenburg 1999, Rhein
ben, dass er die Geschmacksrichtung eines Weines hessenwein e.V. 2005, Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V.
prägt und ihm eine individuelle, persönliche Note 2007, Fischer et al. 2007). Grundsätzlich wird den
verleihen kann. Dieser Zusammenhang zwischen Standortfaktoren und damit auch dem Boden ein
Eigenschaften der Böden und der Geschmacksrich- Einfluss auf die Weintypizität eingeräumt. Der Bo-
tung bzw. der Grundtypizität eines Weines wurde den wird daher in Zukunft stärker in die Praxis der
von Sittler (1995) beschrieben. Abbildung 2 zeigt Weinerzeugung einfließen, sei es durch neue La-
Bodeneigenschaften und Grundtypizitäten für unter- genabgrenzungen zur Hervorhebung bestimmter
schiedliche Standorttypen des Rheingaus. Geschmacksbilder oder zur Erzeugung standort
typischer Weine.
gepufferte Säure
basenreich
Tonmergel
Löss
Ton
Quarzit
säurebetont
basenarm
körperreich körperarm
feinkörnig (hohe nFK) grobkörnig (geringe nFK)
Abb. 2: Grundtypizität von Riesling auf unterschiedlichen Standorttypen im Rheingau.
6Die Weinbergsböden von Hessen
2 Entstehung der heutigen Weinbergsböden
Weinbergsböden sind Archive der Landschaftsge- dungsphasen wie Entkalkung, Oxidation, Tonmine-
nese der Kalt- und Warmzeiten sowie Zeugen einer ral- und Humusbildung. In Wasser gelöste Kohlen-
maßgeblichen Überprägung durch den Menschen. säure (H2CO3) greift die Minerale an und bewirkt
Abgesehen von den wenigen Flächen in Auenlage chemische Veränderungen. So führt z. B. Sickerwas-
(z. B. Mariannenaue), sind die meisten Substrate ser Calciumcarbonat (CaCO3) und andere Boden
dieser Böden zunächst durch Frostprozesse im ober- inhaltsstoffe ab und eisenhaltige Minerale können
flächlich auftauenden Permafrost der letzten Eiszeit oxidiert werden, was den Böden in Mitteleuropa
entstanden. Frostsprengung und Verlagerung der die typische bräunliche, selten auch rötliche Farbe
oberflächennah auftauenden Bodenzone prägen die verleiht. Neben der chemischen und physikalischen
eiszeitlichen, fast vegetationsfreien Hänge. Aufbe- Verwitterung tragen die Aktivitäten von Pflanzen,
reitet wurde dabei das Untergrundgestein, das ein Tieren und Mikroorganismen, z. B. durch die Bil-
Festgestein sein kann, aber auch aus einem kaltzeit- dung von Huminsäuren, erheblich zur Entwicklung
lichen „Staubsediment“, dem sogenannten Löss, oder der Böden bei. In einem Gramm Boden können bis
tertiären Meeressedimenten bestehen kann (Abb. 3). zu einer Milliarde lebender Organismen (Pilzge-
flechte, Mik roben, Bakterien u. a.) enthalten sein.
Mit dem Einsetzen der jetzigen Warmzeit vor etwas Die Lebewesen zersetzen das organische Material,
mehr als 10 000 Jahren durchliefen die in der Eis- wie die jährlich anfallende Streu (Mineralisierung),
zeit gebildeten Substrate unterschiedliche Bodenbil- oder sie bilden organische Abbauprodukte (Humifi-
Eintrag von Löss
in der Bodenmatrix „schwimmende“
Per Steine und Grus hangaufwärts
ig
wa lazia anstehender Gesteine
sse les
rge Bo
sät den
tig
ten fließe
Au n in
ftau
zon der
Ton e
sch
iefe
r
Ges
tein
em Qu
it P arz
erm it
afro
st
Abb. 3: Periglaziales Bodenfließen und die
Einmischung von Stäuben (Löss) verändern
das Ausgangsgestein der Bodenbildung.
7Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
zierung). Aus den Produkten des Zersetzungsprozes- nahmen und Drainage die ursprünglichen Bodenver-
ses abgestorbener pflanzlicher und auch tierischer hältnisse z. T. erheblich verändert oder völlig über-
Organismen entsteht schließlich der Humus, der die prägt wurden.
Bodenoberfläche, beispielsweise die Ackerkrume,
dunkel färbt. Die meisten Weinbergsböden werden daher in den
Bodenwissenschaften als sogenannte Treposole (ein-
Die Bodenbildung beinhaltet aber nicht nur Abbau- maliges Umgraben mit gut erkennbarem originärem
und Verlagerungsprozesse, sondern auch den Aufbau Bodengefüge) und Rigosole (mehrfaches Umgraben,
neuer Substanzen. Bedeutsame Neubildungen sind meist mit Beimengung von Fremdmaterial) typisiert
Tonminerale, Oxide, Hydroxide, Huminstoffe und und der Klasse der terrestrischen Kultosole (terres
Ton-Humus-Komplexe. Letztere entstehen z. B. im trische anthropogene Böden) zugeordnet (Ad-hoc-
Verdauungstrakt der Regenwürmer. Sie werden als AG Boden 2005). Dabei wird ein Teil der originären
Wurmlosung ausgeschieden, verleihen dem Humus Bodenhorizontierung und das Bodengefüge zerstört
seine günstige, schwammartige Struktur und steigern und alles miteinander vermischt. Erhalten bleiben
die Gefügestabilität des Bodens. Vor allem für den dagegen die mineralische Matrix und teilweise auch
umgangssprachlich als „Mutterboden“ bezeichneten Bruchstücke mit der originären Gefügestruktur, die
Oberboden spielen sie eine sehr wichtige Rolle. ihre Eigenschaften und Merkmale weitgehend an
den Rigosol weitergeben. Je nach Mächtigkeit der
Die dargestellten bodenbildenden Prozesse verän- Bodendecke ist der ursprüngliche Boden unter dem
dern das Ausgangsgestein in charakteristischer Wei- Rigolhorizont noch erkennbar oder im Mischhori-
se und führen zur Entwicklung der Bodenhorizonte, zont diagnostizierbar. Bodentypologisch werden die
die durch bestimmte Merkmale (wie Gefüge, Bo- Rigosole dann meist als Übergangssubtyp in Kombi-
denart, Farbe, Fleckung u. a.) gekennzeichnet sind. nation mit dem Ursprungstyp ausgedrückt: Der Para-
Als Ergebnis entsteht eine ganz individuelle Erschei- braunerde-Rigosol ist beispielsweise ein Rigosol aus
nungsform - ein standortspezifischer Boden. dem Bodensubstrat einer Parabraunerde (Abb. 7).
Um Böden hinsichtlich ihrer Eigenschaften beur- Viele Standorte in den hessischen Weinbergslagen
teilen zu können, werden physikalische, chemische sind aber deutlich stärker überprägt. Vor der Um-
und biologische Merkmale bewertet und als Kenn- stellung des europäischen Weinbaues auf reblaus
werte definiert. Zu den wesentlichen physikalischen resistente Unterlagssorten im 20. Jahrhundert erfolg-
Merkmalen des Bodens zählen die Korngrößen- te das Rigolen im Zusammenhang mit Bodenbeauf-
zusammensetzung und die Lagerungsdichte. Zu- schlagungen in einem Turnus von 30 bis 80 Jahren,
sammen mit dem Humusgehalt lassen sich u. a. der selten über 100 Jahre. Seither sind Neuanlagen so-
Wasser- und Lufthaushalt (Versorgung mit pflan- gar alle 20 bis 40 Jahre durchgeführt worden. Da
zenverfügbarem Wasser, Staunässe, Erwärmung im ein Teil der hessischen Weinbaufläche im Rheingau
Frühjahr) sowie die Erodierbarkeit (Neigung zum schon zu karolingischer Zeit angelegt wurde, ist für
Bodenabtrag) eines Bodens beurteilen. Pflanzen- diese Weinberge mindestens ein 15- bis 20-facher
baulich relevant ist auch seine Gründigkeit, die den Rigolvorgang anzunehmen (vgl. hierzu Kap. 3.5).
Wurzelraum bemisst. Wichtige chemische Merk-
male sind auch der Kalkgehalt, die Basensättigung Zur Bodenverbesserung waren darüber hinaus be-
sowie die Bodenreaktion (pH-Wert). Sie bestimmen sonders vor der „Kunstdüngerzeit“ Überschieferung
den Nährstoffhaushalt und indirekt auch die biologi- und Mergelung oder Lössüberdeckung üblich. Dabei
sche Aktivität des Bodens. wurden z. T. wiederholt große Mengen Fremdmate-
rial aufgebracht. Sehr häufig sind auch Weinbergs-
Seit Beginn der Ackerkultur greift der Mensch in den böden zu finden, bei denen der natürliche Boden
Naturraum ein, indem er die Bodeneigenschaften teilweise oder völlig erodiert ist. Über den Bodenaus-
und -merkmale zur Nutzbarmachung zu optimieren gangsgesteinen des Untergrundes wurde vielfach zur
versucht. Allgegenwärtig dokumentiert sich dies im erneuten Bodenverbesserung standortfremdes Bo-
Umbruch der Ackerkrume und der Düngung. Solche denmaterial zwischen 50 cm und mehreren Metern
Maßnahmen werden auch im Weinbau angewandt, Mächtigkeit aufgetragen.
wo durch Tiefumbruch, Substratauftrag, Düngemaß-
8Die Weinbergsböden von Hessen
Auch heute wird noch Boden- und Gesteinsmate- Um dem Standortcharakter einer Lage im Hinblick
rial aus „Erdaushub“ in die Weinberge eingebracht, auf das Standort-Terroir treu zu bleiben, sollte bei der
vermischt mit Trester, Schlamm, Kompost u. a. Man Neuanlage von Weinparzellen unter dem Gesichts-
spricht dann von Böden aus Kippsubstraten, die punkt der „Bodenverbesserungsmaßnahmen“ in Zu-
meist als Rohböden (Regosole) bodengenetisch aus- kunft stärker standortgerechtes Material verwandt
geprägt sind. Dieses Einbringen von Fremdmateriali- und sachgerecht eingebaut werden, wie dies auch in
en hat auch Auswirkungen auf den Stoffbestand der der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
Weinbergsböden (vgl. Kap. 3.5.3) (BBodSchV) gefordert wird.
3 Gesteine, Böden und Bodenzustand der Weinbaugebiete Hessens
Mit ca. 3 199 ha bzw. ca. 462 ha bestockter Reb Wicker, auch „Maingau“ genannt), Hessische Berg
fläche (Regierungspräsidium Darmstadt 2021a, b) straße (Heppenheim–Zwingenberg) und die „Kleine
zählen der Rheingau und die Hessische Bergstraße Bergstraße“ (auch Odenwälder Weininsel genannt),
zu den kleineren deutschen Weinbaugeb ieten. den verstreut liegenden Weinbergen um Groß- und
Landschaftlich differenzieren sich die hessischen Klein-Umstadt (Abb. 4).
Weinbaugebiete in die Regionen Unterer Rheingau
(Rüdesheim–Lorchhausen, auch als Mittelrhein be- Zum Verständnis des Terroirs und speziell der hes-
zeichnet), Oberer Rheingau (Wiesbaden–Rüdes- sischen Weinbergsböden ist es hilfreich, sich die
heim, Untermain bei Hochheim, Flörsheim und Entstehung des Landschaftsraumes zu vergegenwär-
Frankfurt
a
dd
r
s pe
Ni
W
Wi
ic k
Oberer Wiesbaden
e rb
Wa llu
ac
Unterer Rheingau
h
f
R odau
Rheingau
Rh
ein Maingau
h
in
ac
Mainz Ma
rz b
a
hw
Sc
z
re n
rs p
Ge
HESSEN
Kleine
Bergstraße
Darmstadt
Modau
Hessische
Bergstraße
We s c h
Weinbaugebiete Worms
Mümling
Siedlungsflächen
nitz
0 2,5 5 10 km
Abb. 4: Die hessischen Weinbaugebiete.
9Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
tigen. Gerade die sehr unterschiedliche naturräum hessischen Weinbaugebiete und der in Tabelle 1
liche Ausstattung des Oberen und Unteren Rhein skizzierten Bodengruppen umrissen. Umfangrei-
gaus sowie der Hessischen Bergstraße hat zur Aus- chere Ausführungen finden sich in Friedrich (2004),
prägung charakteristischer, regional differenzierter Friedrich & Sabel (2004), Sabel (2006a, b) und vor
Bodengesellschaften geführt. allem in den Weinbergsbodenkarten des Hessischen
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Im Folgenden wird das Bodenmosaik der Wein- (HLNUG).
baugebiete auf der Basis der Standortkartierung der
Tab. 1: Die Bodengruppen der Standortkartierung der hessischen Weinbaugebiete
Bodengruppe I vorwiegend flachgründige, sehr grobbodenreiche, trockene, meist kalkfreie Böden
mittel- und tiefgründige, grobbodenreiche, lehmige, trockene bis frische,
Bodengruppe II
meist kalkfreie Böden
Bodengruppe III tiefgründige, grobbodenarme, lehmige, frische, basenreiche, meist kalkfreie Böden
Bodengruppe IV lehmig-tonige, z. T. grobbodenführende, häufig staunasse, meist kalkfreie Böden
tiefgründige, nur vereinzelt grobbodenführende, schluffige, vereinzelt sandig-
Bodengruppe V
lehmige, t rockene bis frische, meist kalkhaltige Böden
Bodengruppe Va tiefgründige, sandige bis sandig-schluffige, meist kalkhaltige Böden
tiefgründige, häufig grobbodenführende, tonig-lehmige, frische bis feuchte,
Bodengruppe VI
meist kalkhaltige Böden
Bodengruppe VII tonige, grobbodenarme, häufig staunasse, meist kalkhaltige Böden
Frankfurt
u s
Ta un
Main
Mainz
r ück
ns
Hu Mainzer
Becken Darmstadt
Tertiär und Quartär
e
nk
Odenwald
e Tertiär-Sedimente
e-S
ah
Rh
r-N
ein
Saa
Trias und Jura
Perm
(vorwiegend Rotliegend)
Mannheim Nec
Devon des Rheinischen Schiefergebirges
ka
r
Heidelberg Kristallines Grundgebirge
Abb. 5: Geologische Übersichtskarte der hessischen Weinbaugebiete.
10Die Weinbergsböden von Hessen
3.1 Oberer Rheingau
Das Weinbaugebiet Oberer Rheingau umfasst das terschiedlichen Ablagerungen wie Schotter, Sande,
Gebiet zwischen Wiesbaden und Rüdesheim sowie Tone, Kalke und Mergel. Taunuswärts wechselt der
die weinbaulich genutzten Bereiche am Untermain Untergrund zu teilweise tiefgründig verwittertem
zwischen Mainz-Kostheim und Flörsheim am Main. Gestein des Rheinischen Schiefergebirges (Schiefer,
Durch die zusätzlich vorkommenden spezifischen Phyllit, Serizitgneis; vgl. Abb. 6) und vor allem nord-
Böden der Mainterrassen und Flugsande stellt das westlich von Rüdesheim auch Quarzit und Sandstein
Maingebiet bodenkundlich eine Besonderheit dar des Naturraumes Taunuskamm. Als Ausgangssub
und wird daher auch gerne als „Maingau“ unterglie- strat der Bodenbildung ist aber insbesondere der geo
dert. Weinbaulich gehört der „Maingau“ aber zum logisch sehr junge, eiszeitliche Löss oder Sandlöss
Oberen Rheingau. Die mit Abstand größte Anbau hervorzuheben, der als Flugstaub fast überall hinge-
fläche erstreckt sich im Oberen Rheingau auf ca. tragen wurde. Die Bodengesellschaft des Rheingaus
25 km zwischen Wiesbaden und Rüdesheim auf wird auf den Lössen von tief entwickelten, nähr-
einem 3–6 km breiten Streifen parallel zum Rhein. stoffreichen Böden (Parabraunerden, vgl. Abb. 7)
Die sanft gewellte H ügellandschaft wird vom Verlauf mit ausgeglichenem Wasserhaushalt dominiert. Der
des Rheins nach Rüdesheim hin zunehmend ver- schon Jahrtausende währende Ackerbau förderte in
engt, bis sie bei Assmannshausen vom Taunuskamm Hanglagen den Bodenabtrag, sodass die in der der-
abgeschnürt wird. Die nach Süden exponierte Ab zeitigen Warmzeit entwickelten Böden z. T. völlig ab-
dachung vom Fuße des Taunuskammes bis zum getragen wurden. Das erodierte Bodenmaterial füllte
Rhein wurde von den Seitenbächen in zahlreiche Dellen und Tiefenlinien und reicherte sich an den
lang gezogene Rücken und Riedel zertalt. Unterhängen an (Kolluvisol). Wo die Lössbedeckung
nur geringmächtig war, sind die Untergrundgestei-
Der größte Teil des Oberen Rheingaus zählt geo- ne aufgearbeitet und übertrugen ihre Eigenschaf-
logisch zum Mainzer Becken (Abb. 5), einem im ten mehr oder minder stark auf die Böden. Daher
Tertiär entstandenen Senkungsgebiet mit sehr un- sind Böden über Sanden trocken und nährstoffarm
Abb. 6: Weinbergsboden aus Lösslehm und zersetztem vor Abb. 7: Weinbergsboden aus Lösslehm über Löss (Parabraun-
devonischem Serizitgneis (Braunerde-Rigosol). erde-Rigosol).
11Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
W E halten und das anstehende Gestein, viel-
m ü. NN fach Mergel, Tone sowie jüngere Flussab-
165 lagerungen des Rheins (Terrassensande,
Ackerbau Wiese Weinbau Ackerbau
Kies), treten an die Oberfläche und bilden
145 V meist als Gemisch das Ausgangsgestein
Va der Bodenbildung. Trotz der verbreitet
III III
VII Terrasse ungünstigeren Böden (Bodengruppe Va:
135
VI sandig, kalkhaltig und Bodengruppe VII:
Löss
Mergel tonig, kalkhaltig) konzentriert sich hier
125 wegen der Exposition und Hangneigung
Abb. 8: Verteilung der Bodengruppen und der Bodennutzung im Rheingau. der Weinbau, während auf den flachen
Rücken und Riedeln trotz der ertragsrei-
cheren Böden aus Löss (Bodengruppe III:
(Braunerden), über Tonen schwer und wasserabwei- tiefgründig, basenreich und Bodengruppe V: kalk-
send und über Mergeln und Kalksteinen kalkhaltig haltig) nur in Flussnähe noch Weinbau betrieben
(Pararendzina, Rendzina). Im Taunusanstieg sind auf wird. Die mit mächtigem Löss verkleideten, sanft
ebenen Flächen vornehmlich tonig zersetzte Schiefer ostexponierten Hangschleppen, sind dagegen der
und Phyllit anzutreffen. Diese Böden, aber auch die ackerbaulichen Landwirtschaft, die Auen wegen der
tiefgründigen Lösslehme der höher gelegenen Berei- Kaltluftzüge und dem hoch anstehenden Grundwas-
che, neigen zur Staunässe. Die steileren Hänge wer- ser (Bodengruppe VI) der Grünlandbewirtschaftung
den überwiegend von steinig-grusigen Fließerden vorbehalten.
mit geringem bis mittlerem Wurzelraum und unaus-
geglichenem Wasserhaushalt eingenommen. In den Im weiteren Anstieg zum Taunus beschränkt sich
Tallagen sind in der Regel nährstoffreiche Böden mit wegen der Klimaungunst der Weinbau nur noch auf
wechselndem Grundwasserstand verbreitet. die steilsten und optimal nach Südwesten ausgerich-
teten Hänge mit steinigen Braunerden aus lössarmer
Der Weinbau nutzt, wie im folgenden Beispiel dar- Fließerde, während die Verebnungen mit den stau
gestellt, ganz differenziert die Bodenlandschaft. Die nassen Böden über tonigem Zersatz wegen ihres
Rücken und Riedel zwischen den Nebenbächen des mangelhaften Bodenluft- und Bodenwasserhaushal-
Rheins weisen im Querprofil eine ganz typische tes gemieden werden.
Bodenverteilung und Landnutzung auf (Abb. 8). Die
nach Westen exponierten Hangflanken sind im Ver- Der Weinbau am Untermain beschränkt sich auf die
gleich zum Gegenhang markant versteilt. Auf ihnen steilen Uferhänge von Main und Wickerbach, selte-
konnte sich der Löss nur in geringer Mächtigkeit er- ner auf die oberhalb anschließenden flacheren Ver-
ebnungen, die mit mächtigem Löss bedeckt sind. Am
Untermain nehmen verbreitet Tone und Mergel die
weinbaulich genutzten Hänge zwischen Flörshei-
mer Warte und Massenheim sowie die Weinberge
unterhalb der Ortslage Hochheim ein (vgl. Abb. 9).
Entsprechend dominant sind die tonreichen, kalk-
haltigen Böden der Bodengruppe VII, die für die La-
gen „Stein“ und „Nonnberg“, aber auch „Domdecha-
ney“ sowie zum Teil „Hölle“ und „Kirchenstück“ in
Hochheim ganz typisch sind (Sabel 2006b). Daneben
kommen im Unterhang zum Gewerbegebiet Hoch-
heim-Süd noch Sande und Schotter junger Mainab-
lagerungen und Flugsande vor, auf denen die Boden-
gruppe Va überwiegt. Alle anderen Bodengruppen
sind gegenüber dem Rheingau unterrepräsentiert.
Abb. 9: Flörsheimer Warte bei Wicker.
12Die Weinbergsböden von Hessen
3.2 Unterer Rheingau
Während der steten Hebung des Schiefergebirges
schnitt sich der Rhein in den Untergrund ein und
bildete das heutige schmale Mittelrheintal (Abb. 10).
Als Gesteine treten Quarzit, Sandstein sowie Schiefer
auf. Auch im Unteren Rheingau wurde in den Kalt-
zeiten Löss verblasen, der in die steinigen Schuttde-
cken als entkalkter Lösslehm eingearbeitet ist. Tief-
gründiger Löss dagegen ist nur ganz untergeordnet
auf kleineren Flächen verbreitet. Infolgedessen ist im
Mittelrheintal eine ganz eigene Bodengesellschaft
anzutreffen. Charakteristisch sind die weit verbrei-
teten Felsausbisse, die sehr flachgründige trockene
Abb. 10: Blick auf den Rhein bei Burg Ehrenfels.
Böden (Felshumusböden, Rohböden) tragen. Diese
Grenzertragsstandorte (Bodengruppe I) sind heute
nicht mehr in Bewirtschaftung und die Terrassen ündungsbereich der Seitentäler und an Unterhän-
M
verfallen. Ansonsten überwiegen als Ausgangsge- gen mächtigere und lössreichere Fließerden erhalten,
stein der Bodenbildung flachgründige Fließerden, die in denen auch tiefgründigere Böden entwickelt sind.
sich in den exponierten Hangflanken aus Lösslehm
und Untergrundgestein zusammensetzen und stei- Im Engtal des Rheines spielte die Sonneneinstrah-
nige, nährstoffarme, trockene Böden hervorbringen lung für die Standortwahl eine große Rolle. Trotz
(Abb. 11, Abb. 12). Ihre Gründigkeit ist oft auf 0,5 m schwieriger Arbeitsbedingungen wurde der Terras-
beschränkt. Dagegen konnten sich vor allem im senanbau an den optimalen Hangpositionen bevor-
Abb. 11: Braunerde aus Quarzitschutt. Abb. 12: Braunerde aus Tonschieferschutt.
13Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel zugt. Lediglich die steilsten Relieflagen mit Felshu- musböden und Syrosemen wurden gemieden. Beim Terrassenbau wurde angesichts der meist flachgrün- digen Böden der Mangel an durchwurzelbarem Bo- denraum durch Aufschüttungen ausgeglichen. Es überwiegt die Bodengruppe II, die in der Großlage „Steil“ über 50 % der Flächen einnimmt. 3.3 Hessische Bergstraße Als Hessische Bergstraße bezeichnet man den öst lichen Rand des Oberrheingrabens zum Odenwald Abb. 13: Bergstraße – Blick auf die Heppenheimer Lage (Abb. 13). Die Untergrundgesteine, ganz überwie- „Stemmler“. © Reinhard Antes. gend Magmatite des kristallinen Odenwaldes, treten aber nur in exponierten Oberhängen und Kuppen zung haben großflächig die ursprünglichen Böden zutage. In Mittel- und Unterhangposition sind sie mit (v. a. Parabraunerden) abgetragen, sodass der kalk- Sandlöss und Löss verkleidet, die örtlich noch nähr- haltige Löss bzw. Sandlöss diese Flächen einnimmt stoffreiche, tiefgründige Böden mit ausgeglichenem (Abb. 14). Wie im Rheingau reichert sich das erodier- Wasserhaushalt tragen (Parabraunerden). Die hohe te Bodenmaterial an den Unterhängen, in Hangdellen Erosionsanfälligkeit des Sandlösses, die Reliefierung und kleineren Tälern an. Die lössgeprägten Flächen der Hänge und die lange landwirtschaftliche Nut- der Bodengruppe V zeigen vor allem in den Groß- Abb. 14: Weinbergsboden aus Sandlöss (Pararendzina-Rigosol). Abb. 15: Braunerde mit Sandsteinblöcken. 14
Die Weinbergsböden von Hessen
lagen „Rott“ und „Schlossberg“ mit weit über 60 % sionsa nfälligen Bereichen abgetragen. Diese Böden
Flächenanteil die größte Verbreitung. sind durchweg als trocken einzustufen. Die Hänge
und Kuppen tragen Fließerden mit hohem Steinge-
Zur Bodengesellschaft zählen auch die der Steilstu- halt, in denen trockene Braunerden vorherrschen
fe vorgelagerten Braunerden aus kalkhaltigen Flug (Abb. 15).
sanden. Durch den Nutzungseinfluss sind sie in ero
3.4 Kleine Bergstraße (Odenwälder Weininsel)
Das sehr kleine, verstreute Weinbaugebiet bei Groß-
und Klein-Umstadt liegt in der Dieburger Bucht,
einem Teilbereich des Mainzer Beckens, dem nörd-
lichen Rande des Odenwaldes vorgelagert (Abb. 16).
Es handelt sich um eine flachhügelige Landschaft,
in der Gesteine des Odenwaldkristallins (z. B. Gra-
nit, Granodiorit, Diorit) mit mächtigem Löss verhüllt
sind. Auch hier sind die ursprünglichen Parabraun-
erden aus Löss großflächig erodiert. Die Böden der
Bodengruppe V repräsentieren dabei ca. 40 % der
Flächenanteile des Weinbaugebietes.
Erst in den stärker reliefierten Randbereichen
durchragen vereinzelt die Festgesteine die Lössdecke.
Dort bildeten sich über dem Festgestein Fließerden
Abb. 16: Blick auf die Lage „Stachelberg“ bei Klein-Umstadt
mit Braunerden (Bodengruppe II) oder tiefergründige
Parabraunerden (Bodengruppe III).
3.5 Überprägung der natürlichen Böden
Die lange weinbauliche Nutzung der hessischen 3.5.1 Rigolen der Böden
Weinbaugebiete, vor allem das Tiefumgraben oder Fast alle Weinberge werden vor der Neuanlage
„Rigolen“, führte zu einer starken Überprägung der „rigolt“, so nennt man die Bodenvorbereitung durch
natürlichen Böden. Daneben haben erosive Boden- tiefes Umgraben. Weinberge wurden und werden
verluste, aber auch Abgrabungen und Rutschungen z. T. bereits seit dem 8. Jahrhundert im Abstand
die Böden verkürzt oder gar zerstört. Andererseits mehrerer Jahrzehnte vor jeder Neubestockung tief-
wurden und werden im Rahmen der Neuanlage gründig rigolt, d. h. zwischen 40 cm und 100 cm tief
bzw. Wiederbestockung Fremdmaterialien in erheb- umgegraben oder gepflügt.
lichen Mengen auf oder in die Weinbergsböden ein-
gebracht. Dies geschieht z. B. um Abtragungsverluste Durch das Rigolen wird in die natürliche Boden
auszugleichen, die Erosionsanfälligkeit herabzuset- bildung eingegriffen und die ursprüngliche Schich-
zen oder um bearbeitungstechnische Verbesserun- tung und Horizontierung verändert, indem das
gen zu erreichen. Massive Eingriffe können auch umgegrabene Bodenmaterial homogenisiert wird.
durch die Maßnahmen der Flurbereinigung eingelei- Dadurch entsteht ein einheitlicher, durch die Hu-
tet worden sein, die nicht selten zur großflächigen musverteilung dunkel gefärbter, für die Rebe gut
Umgestaltung der Weinbaulandschaft und ihrer Bö- durchw urzelbarer Bodenhorizont. Vor allem auf
den geführt haben. grobbodenreichen Standorten oder bei schweren,
tonhaltigen Böden kann dadurch die Wasser- und
Nährstoffversorgung für die Reben verbessert wer-
den. Abbildung 17 zeigt einen typischen Rigosol,
15Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
dessen Eigenschaften und Merkmale ganz wesent-
lich noch durch die Beimischung des in 55 cm unter
Flur anstehenden unverwitterten Lockergesteins be-
stimmt werden.
Bereits den Römern waren die Effekte des Rigolens
bekannt. In karolingischer Zeit (8.–9. Jahrhundert),
als man die Mehrzahl der deutschen Reblagen erst-
mals mit Reben bepflanzte, wurde über 100 cm tief
„gerodet“. Gründe für das Rigolen finden sich sehr
drastisch beschrieben im Weinbaulehrbuch des
Cannstatter Feldmessers Johann Michael Sommer
aus dem Jahr 1791. Dieser erklärte den schlechten
Wuchs abgängiger Rebflächen dadurch, dass „die
Schuld bloß daran liege dass der Weinberg nicht tief
genug umgeritten worden, dass also die zarten Wur-
zeln, wie es doch die Vernunft hätte lehren sollen,
in einem so starken Boden nicht tief genug einge-
schlagen worden, wodurch sie bey kaltem Wetter
erfrohren, und bey dürrem Sommer verdorret sind“
(Sommer 1791).
Abb. 17: Rigosol mit verändertem Oberboden durch Tiefum-
bruch (Rigosol mit grobbodenreichem aufgefülltem Bodenma-
terial bis 1 m unter Flur über tertiärem Meeressand).
Abb. 18: Rigolpflug im Einsatz. Abb. 19: Spatenmaschine. © Bernd Ziegler
16Die Weinbergsböden von Hessen
Aus dem 17. Jahrhundert sind Rigolarbeiten überlie- im Mittelrheintal und an der Bergstraße betroffen
fert, bei denen bis zu 3 m tiefe Rigolgräben ausgeho- (Emde 2005).
ben wurden. Rigolen war harte Arbeit. Quer zum
Hang wurde zunächst ein Rigolgraben ausgehoben Neben dem Bodenverlust durch das abspülende
und der Aushub mit der Erdenbutte nach oben ge- Oberflächenwasser ist auch immer wieder Massen-
schafft. Anschließend wurde die hangaufwärtige versatz zu beklagen, wenn Bergstürze, Rutschun-
Grabenwand unterhöhlt, so dass die Erde kopfüber gen oder murenartiges Bodenfließen die Weinberge
in den Graben stürzte. Dieser Vorgang des Grabens zerstören. Während bei der Bodenerosion fast aus
und Unterminierens wurde so lange wiederholt, bis schließlich Bestandteile des humosen Feinbodens
man am oberen Teil der Rigolfläche angekommen abgespült werden, erfasst der Massenversatz den
war und man den letzten halb gefüllten Rigolgraben ganzen Bodenkörper samt Reben und alle Korngrö-
mit dem zu Beginn gewonnenen Material einebnen ßen bis zum groben Gesteinsschutt.
konnte.
Großen Einfluss auf das Ausmaß des Bodenabtrags
Hat man traditionell den Boden noch bis vor weni- haben die Art der Bodennutzung und die Techniken
gen Jahrzehnten fast ausschließlich mühevoll von der Bewirtschaftung. So zeigen Weinberge mit Gras
Hand umgesetzt, nutzt man heute überwiegend einsaat in den Rebenzeilen auch bei stärkerer Hang-
R igolpflüge mit einer Arbeitstiefe zwischen 40 und neigung keine Erosionsschäden. Dagegen führen
80 cm (Abb. 18) oder Spatenmaschinen (Abb. 19), die schon geringere Niederschlagsmengen und -intensi-
diesen Arbeitsprozess ganz wesentlich erleichtern. täten auf intensiv bewirtschafteten, offen gehaltenen
Nicht zuletzt deswegen hat sich die Nutzungsdauer Weinbergsarealen zu erheblichem Oberflächenab-
eines Wingerts heute auf 20 bis 40 Jahre verkürzt. fluss und Bodenerosion. Durch die heute übliche ma-
schinelle Bodenbearbeitung entstehen Fahrspuren
mit typischer Bodenverdichtung und Pflugsohlen,
3.5.2 Bodenerosion die das Versickern der Niederschläge behindern und
Aufgrund der ökologischen Ansprüche der Reben be- den Oberflächenabfluss konzentrieren und lenken.
vorzugt der Weinbau Hang- und Steillagen. Die ver-
breitete Ausrichtung der Rebzeilen in Gefällerichtung,
die entsprechend angepasste Anlage der Weinbaupar-
zellen und des Wegenetzes und die erosionsfördern-
de Wirkung der Bodenbearbeitung durch Fräsen und
Grubbern in offen gehaltenen Zeilen führen in der
Sonderkultur Wein sehr viel häufiger zu Abschwem-
mungen als im Ackerbau. Der erosive Verlust an Bo-
denmaterial mit z. T. verheerenden Folgen ist ein tra-
ditionelles Thema im Weinbau.
Wenn in hängigem Gelände die Niederschlagsin-
tensität oder das Schmelzwasser die Infiltrationsrate
des Bodens übersteigen, fließt das Wasser oberfläch-
lich ab und nimmt dabei Bodenpartikel auf. Außer
den extremen Starkregen können auch die zahl-
reichen kleinen und mittleren Erosionsereignisse
über die Jahre hinweg in der Summe ähnlich große
Bodenverluste verursachen. Neben dem Einfluss der
Neigung spielen die Hanglänge und vor allem die
Bodenart eine gewichtige Rolle. Besonders abtrags-
gefährdet sind die leicht abschwemmbaren B öden
aus Löss (Abb. 20). Daher sind auf diesem Ausgangs-
substrat kaum noch natürliche Böden erhalten. Von
der Erosion sind in besonderem Maße die Steillagen Abb. 20: Abgeschwemmtes Oberbodenmaterial auf Lössflächen.
17Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
Der Verlust von Bodenmaterial durch Abschwem- in tiefere Schichten eingemischt werden bzw. durch
mung kann erhebliche Ausmaße erreichen und zu Bodenbeaufschlagungen dort enthalten sein.
einer spürbaren Minderung der Nutzungsfähigkeit
der Böden führen. Die Winzerinnen und Winzer Bezüglich Pflanzenschutzmitteln ist an erster Stelle
versuchen deshalb häufig, Schäden durch Rück- Kupfersulfat zu nennen (früher als Kupfervitriol be-
führung des Materials auszugleichen. Meist geht zeichnet), das bereits seit 1885 erfolgreich als Fun-
der humose, nährstoffreiche Feinboden aber ver- gizid zur Bekämpfung des falschen Mehltaus (Plas-
loren und muss durch ortsfremdes Material ersetzt mopara viticola) eingesetzt wird. Der französische
werden. Die ursprünglichen Standortbedingungen Botaniker Pierre-Marie Alexis Millardet entwickelte
können so im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhun- damals die sogenannte „Bordeauxbrühe“ aus Kupfer-
derte immer stärker verändert werden. Es finden sulfat und gebranntem Kalk (Abb. 21). In den ersten
sich daher Böden, die bis zu mehreren Metern mit Jahrzehnten der Anwendung wurden sehr hohe Kup-
anderem Bodenmaterial überdeckt wurden. Aber fermengen verwendet, in Deutschland durchschnitt-
auch als Vorsorgemaßnahme können ortsfremde Ge- lich 20–30 kg/ha, teilweise sogar 80 kg/ha im Jahr
steine und Böden sowie anthropogene Substrate wie und mehr (Kühne et al. 2009). Seitdem hoch wirk-
Schlacken, Schutt, Trester oder Kompost aufgetragen same chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
werden, um den Oberboden gegen Erosion zu sta- zur Verfügung stehen, gingen die Anwendungs-
bilisieren. Damit ist leider auch ein unkontrollierter mengen kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel in den
Eintrag unerwünschter Stoffe verbunden. letzten Jahrzehnten stark zurück. In Deutschland ist
heute nur noch eine maximale Ausbringungsmenge
Um die Standortcharakteristik, das Terroir, und da- von 3 kg Reinkupfer pro Hektar und Jahr erlaubt, in
mit die Qualität der Weinbergsböden langfristig zu bestimmten Ausnahmefällen (z. B. bei Schwarzfäu-
erhalten, ist daher darauf zu achten, lokal typische le) 4 kg pro Hektar und Jahr (Regierungspräsidium
Substrate für den Fremdmaterialauftrag zu verwen- Darmstadt 2020). Allerdings kann auf kupferhaltige
den. Das Bodenmaterial sollte schonend, also nicht Pflanzenschutzmittel bisher nicht vollständig ver-
zu tiefgründig eingearbeitet werden, um besonders zichtet werden. Vor allem im ökologischen Weinbau
den standorttypischen Unterboden in seiner natürli- gibt es keine Alternativen zur Bekämpfung von Pilz-
chen Ausprägung zu belassen. und Bakterienkrankheiten. Und auch bei konven
tioneller Bewirtschaftung werden Kupferpräparate
in geringen Mengen weiterhin eingesetzt, beispiels-
3.5.3 Stofflicher Bodenzustand weise um durch einen Wirkstoffwechsel Resistenzen
Böden mit einer langjährigen weinbaulichen Nut- vorzubeugen. Aktuell gilt die Zulassung von Kupfer
zung waren bereits historisch diversen Stoffeinträgen als Pflanzenschutzmittel in den EU-Staaten bis Ende
ausgesetzt und sind es auch heute noch. Neben der 2025.
Einbringung von standortfremden Substraten wird
oft organisches Material zugeführt, beispielsweise
weinbau- und kellerwirtschaftliche Rückstände wie
Trester und andere Gärreste, organisches Mulchma-
terial, Komposte oder Aschen, um die Humusversor-
gung zu gewährleisten und die Bodenfruchtbarkeit
zu erhalten. Auch mineralische Düngemittel werden
zu diesem Zweck eingebracht. Weiterhin geht der
Weinbau mit einem intensiven Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln einher, um Schädlinge oder Pflanzen-
krankheiten zu bekämpfen. Die vielfältigen Eintrags-
quellen führen dazu, dass in Weinbergsböden häufig
erhöhte Gehalte an anorganischen und organischen
Spurenstoffen zu finden sind, wobei die heute mess-
baren Gehalte oft auf Einträge aus der Vergangenheit
zurückgeführt werden können. Durch das Rigolen Abb. 21: Kupferhaltiges Pflanzenschutzmittel auf einem
können dabei auch oberflächlich eingetragene Stoffe Weinblatt
18Die Weinbergsböden von Hessen
Kupfer ist ein Schwermetall, welches im Boden nicht dere aufgrund von Vergiftungserscheinungen bei
abgebaut wird, sondern sich infolge langjähriger An- Winzern („Kaiserstuhl-Krankheit“) wurde ihre An-
wendung kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel anrei- wendung im Weinbau aber bereits 1942 gesetzlich
chern kann. Es kann schädigend auf viele Arten von verboten. Eine weitere mögliche Eintragsquelle, bei-
Bodenorganismen wirken, insbesondere auf Regen- spielsweise für Blei und Cadmium, ist die Verwen-
würmer. Aufgrund artspezifisch differierender Emp- dung von Müllkomposten und Klärschlämmen, die
findlichkeiten gegenüber Kupfer kann es zu einer verstärkt nach 1945 als kostengünstige Alternative
Veränderung der Artenzusammensetzung und einer zur Humusversorgung sowie zum Schutz vor Ero
Abnahme der Biodiversität kommen (UBA 2009). Bei sion in Steillagen eingesetzt wurden (Mohr 1985).
Untersuchungen in den deutschen Qualitätsweinan-
baugebieten wurde festgestellt, dass die Kupferbelas- Neben erhöhten Gehalten anorganischer Spurenstof-
tungen der verschiedenen Anbaugebiete und Lagen fe sind in Böden unter langjähriger weinbaulicher
sich erheblich unterscheiden und in erster Linie von Nutzung örtlich auch einige organische Schadstof-
der Bewirtschaftungsdauer in Verbindung mit den fe mit erhöhten Gehalten zu messen. Besonders die
hohen Aufwandsmengen früherer Jahre abhängen Gehalte des jahrzehntelang weltweit am häufigsten
(Strumpf et al. 2011). Das konnte auch bei Untersu- eingesetzten Insektizids DDT (Dichlor-Diphenyl-Tri
chungen repräsentativer Standorte der hessischen chlorethan) sind in Weinbergsböden durchschnitt-
Weinbauregionen bestätigt werden: Insgesamt streu- lich deutlich höher als in Böden unter Ackernutzung
en die gemessenen Kupfer-Gehalte je nach Örtlich- (Abb. 23).
keit in einem weiten Bereich. Im Mittel zeigen die
untersuchten Oberböden im Rheingau aber höhere
Kupfergehalte im Vergleich zur hessischen Bergstra- [cm]
0
ße. Das kann vermutlich damit erklärt werden, dass
im Gebiet der Hessischen Bergstraße die Rebflächen
erst seit 40–60 Jahren bestockt sind (Strumpf et al. 10
2011).
20
Abbildung 22 zeigt beispielhaft die Tiefenverteilung eR-Ap
der Kupfer-Gehalte im Boden eines beprobten Profils
im Rheingau: Die maximalen Gehalte mit mehr als 30
150 mg/kg TM sind in den oberen 10 cm anzutref-
fen; erhöhte Gehalte oberhalb des Vorsorgewertes 40
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) sind aber auch im Rigolhorizont bis in
eine Tiefe von 60 cm messbar. 50
II R
Abgesehen von Kupfer gibt es noch weitere Schwer- 60
metalle, für die in Weinbergsböden oft erhöhte Ge-
halte gemessen werden können. So wurden in den
70
untersuchten hessischen Böden z. B. punktuell ho-
he Zinkgehalte analysiert. Mögliche Eintragsquelle
für diese Belastungen sind vor allem die verzinkten 80
Spalierpfähle und Verdrahtungen, die inzwischen II ilCv
regelhaft die ehemals verwendeten Holzpfähle ablö- 90
sen (Müller 2003). Auch Quecksilbergehalte sind an 0 50 100 150 200 [mg/kg TM]
einigen Standorten erhöht. Hauenstein & Bor (2015)
Kupfer
benennen ehemals verwendete quecksilberhaltige
Fungizide und mit Quecksilberchlorid imprägnierte Abb. 22: Untersuchtes Bodenprofil im Rheingau mit Angabe
Holzpfähle als potenzielle Eintragsquellen in Wein- der Horizontierung und den in den entsprechenden Entnahme
tiefen gemessenen Kupfer-Gehalten (Königswasser-Ex t rakt).
bergsböden. Einige Jahre wurden im Weinbau auch Gestrichelte Linie gibt die Höhe des Vorsorgewertes der
arsenhaltige Insektizide verwendet, in erster Linie BBodSchV für Ton wieder.
zur Bekämpfung des Traubenwicklers. Insbeson-
19Peter Böhm, Klaus Friedrich, Katrin Lügger & Karl-Josef Sabel
DDT und seine Abbauprodukte sind sehr langlebig Hintergrundwerte
und können sich in der Nahrungskette anreichern. Im Rahmen von Boden-Untersuchungen und Be-
Diese Eigenschaften führten bereits 1972 zu einem probungen repräsentativer Standorte der hessischen
Anwendungsverbot in der damaligen Bundesrepu Weinbauregionen konnten weinbauspezifische Hin-
blik Deutschland. Aufgrund der hohen Beständigkeit tergrundwerte für Hessen abgeleitet werden. Als
sind DDT oder seine Abbauprodukte aber vor al- Hintergrundwerte werden repräsentative, statistisch
lem auf Standorten mit ehemals intensiver Anwen- abgeleitete Werte für allgemein verbreitete Hinter-
dung auch heute noch in den Böden nachweisbar. grundgehalte eines Stoffes oder einer Stoffgruppe
Im Normalfall verbleibt DDT vor allem im humosen in Böden bezeichnet (LABO 2017). Der spezifische
Oberboden, da es stark an der organischen Substanz Hintergrundgehalt resultiert dabei aus dem geo-
gebunden wird und sich deshalb kaum verlagert. genen Grundgehalt eines Bodens und den diffu-
Durch das Rigolen, Bodenbeaufschlagungen oder sen Einträgen in den Boden. Diffus sind Einträge,
Bodenverlagerungen durch Bodenerosion ist es aller- die großräumig und über längere Zeiträume erfolgt
dings in Weinbergsböden manchmal auch in Unter- sind. Da für Böden unter langjähriger weinbaulicher
böden zu finden, wie das Beispiel in Abbildung 24 Nutzung die erläuterten nutzungsspezifischen Ein-
zeigt. An diesem Standort sind in dem mächtigen träge zu erwarten sind, können nach LABO (2017)
Rigolhorizont „eR“ die höchsten DDT-Gehalte mit neben den Hauptnutzungsarten Acker, Grünland
über 0,5 mg/kg TM in einer Tiefe von 10–30 cm an- und Wald auch regionale Hintergrundwerte für die
zutreffen; aber auch in der darunterliegenden Probe Nutzung Weinbau abgeleitet werden. Dabei zeigt die
von 30–60 cm sind noch DDT-Gehalte von knapp Belastungsstruktur von Weinbergsböden zwar ein
0,2 mg/kg TM messbar. charakteristisches Spektrum mit erhöhten Gehal-
n = 22 24 38 80 38 [cm]
0,4
0
Ah
10
0,3
20
DDT [mg/kg TM]
30
0,2
eR
40
0,1
50
60
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0
DDT [mg/kg TM]
ge
en
en
en
en
Au ld
erb d
erb r
erb d
erb u
Ob Acke
Ob Wal
Ob nlan
Ob inba
Wa
fla
II ilCcv
od
od
od
od
Grü
We
Abb. 23: Box-Whisker-Plot der DDT-Gehalte (DDT = Summe Abb. 24: Untersuchtes Bodenprofil im Rheingau mit Angabe
aus 6 Isomeren) in hessischen Oberböden verschiedener Nut- der Horizontierung und den in den entsprechenden Entnah-
zungen sowie der Humusauflage unter Wald. metiefen gemessenen DDT-Gehalten (Summe aus 6 Isomeren).
20Die Weinbergsböden von Hessen
Tab. 2: Substratübergreifende Hintergrundwerte anorganischer Spurenstoffe in Oberböden unter weinbaulicher Nutzung in Hessen
(HLUG 2011) und Vorsorgewerte der BBodSchV für die Bodenart Lehm/Schluff. Angegeben werden die Gehalte im Königswasser-
Extrakt.
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb V Zn
[mg/kg TM]
Anzahl 31 33 34 36 16 36 35 22 24 36
50. Perzentil 10 0,18 34 58 0,10 23 35 0,94 46 115
90. Perzentil 39 0,30 58 98 0,20 43 92 2,68 98 195
Vorsorgewerte 1 50 70 150
20 60 40 0,3 - -
Lehm/Schluff (0,4) (15) (40) (60)
Kursiv = geringerer Stichprobenumfang von 10 ≤ n < 20; diese Werte haben nur einen orientierenden Charakter und eignen sich nicht zur Abgren-
zung des Hintergrundwertebereichs.
Fettdruck = Hintergrundwerte, die die Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff überschreiten.
Werte in Klammern = gelten bei einem pH-Wert von < 6 (für Pb < 5).
ten bestimmter Stoffe und Stoffgruppen, allerdings In Tabelle 3 werden die berechneten Hintergrund-
können einzelne Flächen, je nach Dauer und Art der werte organischer Spurenstoffe in hessischen Ober-
Bewirtschaftung und der in diesem Zusammenhang böden unter weinbaulicher Nutzung dargestellt
durchgeführten Maßnahmen, sehr heterogen belas- (HLNUG 2017). Die in der BBodSchV für organische
tet sein. Potenziell können also auch benachbarte Stoffe enthaltenen Vorsorgewerte werden von diesen
Flächen sehr unterschiedliche Spurenstoff-Gehalte nicht erreicht. Allerdings liegen neben den bereits
aufweisen. Selbst auf dem gleichen Flurstück kann erwähnten deutlich erhöhten Hintergrundwerten
die Schadstoffverteilung sehr inhomogen sein. für DDT (Abb. 23) auch die Hintergrundwerte für
Benzo(a)pyren, Polyzyklische Aromatische Kohlen-
In Tabelle 2 werden die für Hessen berechneten sub- wasserstoffe (PAK), Polychlorierte Biphenyle (PCB),
stratübergreifenden Hintergrundwerte anorganischer dioxinähnliche PCB (dl-PCB) sowie Polychlorierte
Spurenstoffe in Oberböden unter weinbaulicher Nut- Dibenzodioxine und -furane (PCDD/F) oberhalb der
zung wiedergegeben (HLUG 2011). Erhöhte Gehalte hessischen Hintergrundwerte für ackerbauliche Nut-
sind erwartungsgemäß vor allem für Kupfer festzu- zung (HLNUG 2017).
stellen, ein überwiegender Anteil der untersuch-
ten Standorte überschreitet die Vorsorgewerte der Insgesamt ist die Spannweite der Spurenstoff-Ge-
BBodSchV. Auch für Blei und Zink liegen die berech- halte in hessischen Weinbergsböden groß, zum Teil
neten 90. Perzentile oberhalb der Vorsorgewerte. sind erhöhte Belastungen festzustellen. Dabei liegen
Tab. 3: Hintergrundwerte organischer Spurenstoffe in Oberböden unter weinbaulicher Nutzung in Hessen (HLNUG 2017) und Vor
sorgewerte (BBodSchV).
B(a)P PAK16 DDX γ-HCH HCB PCB6 PCDD/F dl-PCB
WHO-TEq 1 WHO-TEq 1
[µg/kg TM] [ng TEq/kg TM]
Anzahl 39 39 39 39 36 36 38 36
50. Perzentil 31 318 35,5 < BG 2 < BG 2 < BG 2 1,3 0,33
90. Perzentil 122 1277 231,9 < BG 2 < BG 2 3,4 3,2 0,78
Vorsorgewerte 3 300 3 000 - - - 50 4 - -
1 3
Toxizitätsäquivalent WHO-TEq 2005, exklusive Bestimmungsgrenze (lower Vorsorgewerte bei TOC-Gehalten ≤ 4 %
bound) 4
Vorsorgewert bezieht sich abweichend auf die Summe aus PCB6 und PCB-118
2
unterhalb der Bestimmungsgrenze (1 µg/kg)
21Sie können auch lesen