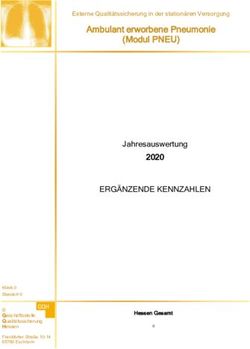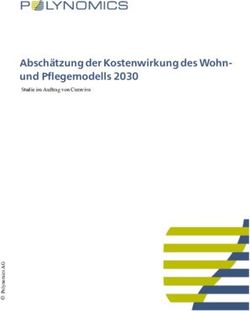Erläuterungen zu den Änderungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) (Ambulant vor Stationär) Vorgesehene Änderungen per 1. Januar 2019 - BAG
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Abteilung Leistungen
Erläuterungen zu den Änderungen der Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV) (Ambulant vor Stationär)
Vorgesehene Änderungen per 1. Januar 2019
(Version vom 29. September 2017)Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 3
2 Ausgangslage 3
2.1 Potenziell verlagerbare Fälle .................................................................................................... 3
2.2 Finanzierung ............................................................................................................................. 5
2.3 Strukturen der Leistungserbringung ......................................................................................... 5
3 Vorgesehene Verordnungsänderung 5
3.1 Zielsetzung der Verordnungsänderung .................................................................................... 5
3.2 Grundzüge der Verordnungsänderung ..................................................................................... 5
3.3 Liste der Eingriffe ...................................................................................................................... 6
3.4 Kriterien für eine stationäre Durchführung ................................................................................ 7
3.5 Prüfungsverfahren .................................................................................................................... 8
3.5.1 Variante 1, vorgängige Bewilligung durch den Versicherer ...................................................... 8
3.5.2 Variante 2, nachträgliche Rechnungskontrolle sowie vorgängiges
Kostengutspracheverfahren für Spezialfälle ............................................................................. 8
4 Monitoring und Evaluation 9
5 Finanzielle Auswirkungen 9
6 Zeitplan / Inkraftsetzung 9
21 Einleitung
In der Schweiz werden bestimmte Eingriffe, im Vergleich zum Ausland, öfter stationär als ambulant
durchgeführt, obwohl ambulantes Operieren für Patienten Vorteile hat und weniger Ressourcen benö-
tigt. Verschiedene Länder (Frankreich seit 2007, Deutschland seit 2012) haben Massnahmen zur Ver-
lagerung von stationärer zur ambulanten Durchführung von Eingriffen getroffen.
Das BAG hat sich im Jahr 2015 mit der Thematik auseinandergesetzt. Nachdem seitens Obsan erste
Analysen zur quantitativen Auswertung von potenziell ambulant durchführbaren Operationen erfolg-
ten, hat das BAG die Analysen mit Zahlen aus dem Tarifpool der SASIS AG hinsichtlich Anzahl ambu-
lant durchgeführter Eingriffe ergänzt und Gespräche mit den Stakeholderverbänden sowie den be-
troffenen ärztlichen Fachgesellschaften1 geführt. Grundsätzlich sind die Stakeholder der Ansicht, dass
es sinnvoll ist, einfache Eingriffe ambulant durchzuführen. Am 15. Juni 2017 fand eine Sitzung mit
allen betroffenen Stakeholdern (curafutura, santésuisse, FMH, fmCH, H+, GDK) statt, zwecks Anhö-
rung deren Anliegen, Diskussion des Vorschlags BAG sowie Präsentation der Rahmenbedingungen
sowie des weiteren Vorgehens betreffend einer gesamtschweizerischen Lösung im Rahmen der
Krankenpflege-Leistungsverordnung und begleitenden Massnahmen. Die Stakeholder begrüssen
grundsätzlich eine einheitliche Lösung für die ganze Schweiz gegenüber kantonalen Lösungen.
Gleichzeitig sind mehrere Kantone daran, Listen mit ambulant durchzuführenden Eingriffen zu definie-
ren und mit unterschiedlichen Umsetzungsvarianten einzuführen. Der Kanton Luzern2 verwendet ein
System mit vorgängigen Kostengutsprachen und einem zeitnahen Controlling durch den Kanton, das
bei der Rechnungstellung durch die Spitäler erfolgt. Der Kanton Zürich3 gibt pro Spital zu erreichende
ambulante Quoten vor und verpflichtet die Spitäler zu einer Dokumentation der Ursachen, die zu ei-
nem stationären Aufenthalt geführt haben. Das elektronische Controlling erfolgt retrospektiv. Der Kan-
ton Luzern hat sein Programm per 1. Juli 2017 mit einer Liste von 13 Eingriffen gestartet. Der Kanton
Zürich hat die Einführung per 1. Januar 2018 beschlossen. Kürzlich haben auch die Kantone Wallis
und Zug die Einführung einer mit Zürich und Luzern abgestimmten Liste und einer an die vom Kanton
Luzern angelehnten Umsetzungsvariante per 1. Januar 2018 bekanntgegeben. Die Kantone haben
Kriterien definiert, die einen stationären Eingriff rechtfertigen können.
Im vorliegenden Dokument wird ein Entwurf für eine Massnahme auf Ebene des Bundes zur Förde-
rung der Verlagerung von der stationären zur ambulanten Durchführung von Eingriffen vorgestellt.
2 Ausgangslage
2.1 Potenziell verlagerbare Fälle
Im Rahmen von Evaluationsstudien im Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung und Anpas-
sungen des Risikoausgleichs wurde untersucht, inwiefern ambulant durchführbare Eingriffe in den
Spitälern in der Schweiz vorkommen. Das BAG beauftragte dazu das Obsan mit der Durchführung
einer quantitativen Analyse zu ausgesuchten Eingriffen.
1
Gynécologie suisse (SGG), Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Traumatologie (SGACT/SSCGT),
Schweizerische Gesellschaft für Anästhesie und Reanimation (SGAR/SSAR), Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie
(SGC/SSC), Schweizerische Gesellschaft für Gefässchirurgie (SGG) swissvasc.ch, Schweizerische Gesellschaft für Kinderchi-
rurgie, Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie (SGORL), Schweizerische Gesell-
schaft für Phlebologie (SSP/SGP), Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV), Schweizeri-
sche Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC); swiss orthopaedics
2
Weblink auf Seite Kt. LU: https://gesundheit.lu.ch/themen/gesundheitsversorgung/ambulantvorstationaer
3
Weblink auf Seite Kt. ZH: https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/qualitaet-in-
listenspitaelern/indikationsqualitaet--ambulant-vor-stationaer.html
3Als Grundlage für die Analyse diente die Liste der IAAS (International Association for Ambulant Sur-
gery) mit 37 Prozeduren, die ambulant durchgeführt werden können und sollten.4 Für die Analyse
erfolgte vorab durch das Bundesamt für Statistik (BFS) eine „Transkription“ der von der IAAS verwen-
deten ICD-9-Codes in die entsprechenden CHOP-Codes. Anschliessend wurden in der medizinischen
Statistik der Krankenhäuser (MedStat) des Jahres 2013 alle Fälle, in denen mindestens einer der de-
finierten CHOP Codes figurierte, identifiziert. Die so gefundenen Fälle wurden nach der Aufenthalts-
dauer LOS (length of stay) und ihrem Schweregrad des Behandlungsfalls (PCCL 0 – 4) klassifiziert.
Fälle, die als „Notfall“ eingetreten sind, sowie von der Unfallversicherung vergütete Fälle wurden in der
Analyse nachträglich ausgeschlossen. Fälle, mit einer LOS 2, die verlagerbar
wären, aber nicht berücksichtigt wurden. Daher wurde diese Annahme, als für diese Übersichtszwe-
cke vertretbarer Näherungswert erachtet.
Um das Verhältnis von ambulant zu stationär durchgeführten Eingriffen besser abschätzen zu können,
hat das BAG bei den zahlenmässig relevanten Diagnosen zusätzlich eine Analyse der ambulant
durchgeführten Eingriffe gemacht. Es wurden TARMED-Codes im Sinne von Indikator-Eingriffen defi-
niert und ihre Häufigkeit für das Jahr 2013 anhand der Daten des Tarifpools der SASIS AG bestimmt.
Nicht alle Eingriffe liessen sich immer eindeutig klaren TARMED-Positionen zuteilen. Zudem wurden
in erster Linie insbesondere Eingriffe mit einem namhaften Verlagerungspotenzial aus der Obsan-
Analyse berücksichtigt.
Die Analyse mit den oben genannten Annahmen ergab bei 37 untersuchten Eingriffe ein Verlage-
rungspotenzial von über 77‘000 Fällen (Anhang1). Davon wurden vom BAG sechs Gruppen von Ein-
griffen ausgewählt, die hohe Fallzahlen aufweisen (Verlagerungspotenzial von total über 42‘000 Fäl-
len), in einem hohen Prozentsatz stationär durchgeführt werden (soweit ersichtlich) und gleichzeitig
mit relativ wenigen Begleitmassnahmen im schweizerischen Gesundheitswesen auch ambulant durch-
führbar wären.
Abbildung 1: Übersicht Fallzahlen der sechs ausgewählten Eingriffe
Chirurgische Eingriffe, 2013 Stationäre Fälle Ambulante Fälle
PCCL=0, Verlager-
nur KV bare Fälle Total Anteil
Eingriff Total PCCL=0
ohne (zusätzlich. ambulant ambulant
Notfälle LOS2.2 Finanzierung
Für die Abgeltung ambulanter und stationärer Leistungen bestehen in der Schweiz zwei unterschiedli-
che Systeme.
- Ambulant erfolgt die Rechnungsstellung anhand des Einzelleistungstarifs TARMED. Diese
Kosten werden zu 100% von den Krankenversicherer getragen.
- Stationär erbrachte Leistungen werden über Fallpauschalen (SwissDRG) abgerechnet. Diese
Kosten werden zu mindestens 55% von den Kantonen und der Rest durch die Krankenversi-
cherer getragen. Im stationären Bereich – und nur hier – werden zudem bei Zusatzversicher-
ten nach VVG durch die Versicherer Zusatzvergütungen entrichtet.
Dies führt erstens dazu, dass je nach Setting (DRG bzw. TARMED) für denselben Eingriff unter-
schiedlich hohe Beträge in Rechnung gestellt werden können. Zweitens kann bei zusatzversicherten
Patienten bei stationärer Durchführung oftmals zusätzlich ein Honorar in Rechnung gestellt werden.
Aus Sicht des Leistungserbringers führt dies je nach Höhe der stationären und ambulanten Tarife zu
finanziellen Vorteilen des einen oder anderen Settings sowie Bevorzugung der stationären Durchfüh-
rung bei zu-satzversicherten Patienten. Weiter gehen bei stationären Aufenthalten lediglich maximal
45% der Behandlungskosten zulasten der Krankenversicherer. Insgesamt hat das heutige Tarif- und
Finanzierungssystem wenig Anreize die, Eingriffe ambulante Durchführung zu fördern.
2.3 Strukturen der Leistungserbringung
Die aktuellen Strukturen in den Spitälern sind meist auf stationäres Operieren ausgerichtet. Eine Ope-
ration erfolgt in der Schweiz meistens in einem Spital. Kleinere Eingriffe können auch in einer entspre-
chend eingerichteten privaten Arztpraxis durchgeführt werden. Daneben existieren auch auf ambulan-
te Eingriffe spezialisierte Einrichtungen, meistens als private Einrichtung.
Die Prozesse in den Spitälern sind aktuell meistens nach internen Bedürfnissen und passend zur be-
stehenden Infrastruktur definiert. Einfache Eingriffe werden, nach Angaben der Leistungserbringer,
z.B. oft als Lückenfüller zwischen zwei grösseren Eingriffen benutzt, was unter Umständen bedingt,
dass sie erst am Abend durchgeführt werden und der Patient nicht mehr am selben Tag nach Hause
entlassen werden kann. Dieses Vorgehen ist geeignet für das Spital, aber weniger für die Patienten.
Soll eine Verlagerung zu ambulanten Eingriffen erfolgen, müssen auf Patienten ausgerichtete Anpas-
sungen an Strukturen und Prozessen erfolgen. Gleichzeitig müssen die ambulante Vor- und Nachsor-
ge bei Operationen aber auch die Versorgung bei Notfällen geregelt und der Datenfluss koordiniert
werden. Dieser Vorgang benötigt Zeit.
3 Vorgesehene Verordnungsänderung
3.1 Zielsetzung der Verordnungsänderung
Mit der vorgesehenen Anpassung der KLV werden folgende Zielsetzungen verfolgt:
- Förderung der ambulanten Leistungserbringung, wo sie medizinisch indiziert, patientenge-
recht und ressourcenschonend ist
- Schaffung gleicher Voraussetzungen für alle OKP-Versicherten durch eine gesamtschweize-
risch einheitliche Regelung
3.2 Grundzüge der Verordnungsänderung
Gemäss den Voraussetzungen zur Kostenübernahme von Leistungen zu Lasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (OKP) müssen die Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich
sein (Artikel 32 KVG). Angesichts des deutlichen Verlagerungspotenziales besteht Bedarf für Mass-
namen zur Förderung der ambulanten Leistungserbringung.
5Eine oft diskutierte Massnahme ist die einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Leis-
tungen. Diesbezügliche Gesetzesanpassungen sind in Diskussion. Eine allfällige Revision würde noch
einige Jahre Zeit in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit soll nicht nur zugewartet, sondern andere
Massnahmen zur Förderung der ambulanten Leistungserbringung umgesetzt werden, um die Struktur-
und Prozessanpassungen hin zum effizienteren und patientenortientierteren ambulanten Eingriffen zu
fördern.
Der vorgestellte Lösungsansatz beruht auf einer Regelung in der Krankenpflege-Leistungsverordnung
(KLV) mit:
- einer Liste von elektiven Eingriffen, deren Kosten für die stationäre Durchführung von der
OKP nur vergütet werden, wenn diese aus medizinischen Gründen nicht ambulant durchge-
führt werden können
- einem Referenzdokument mit Kriterien hinsichtlich der Spitalbedürftigkeit (diese sind nicht ab-
schliessend und im Einzelfall sind weitergehende Beurteilungen durch die Versicherer mög-
lich).
Die Aktualisierung der Liste und des Referenzdokuments zur Anpassung an neue Erkenntnisse und
Umstände erfolgt in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern und den eidgenössischen Kommissionen.
Angesichts der bestehenden Herausforderungen hinsichtlich Anpassung von Strukturen und Prozes-
sen auf vermehrte ambulante Leistungserbringung sowie in der Tarifierung der Leistungen soll in ei-
nem ersten Schritt eine Liste mit einer beschränkten Anzahl von sechs Gruppen von elektiven Eingrif-
fen, die sich besonders eigenen, vorgegeben werden. Dabei nicht berücksichtigt wurden Leistungen,
die bereits heute überwiegend ambulant durchgeführt werden (z.B. Kataraktoperationen), da hier der
Handlungsbedarf als gering erachtet und eine Regelung mit administrativem Zusatzaufwand als nicht
notwendig erachtet wird. Nach Umsetzung und Evaluation der Auswirkungen kann die Liste der Ein-
griffe später erweitert werden. Somit wird bewusst vorerst eine gegenüber den von gewissen Kanto-
nen beschlossenen Lösungen eingeschränktere Variante für die gesamtschweizerische Umsetzung
vorgeschlagen.
Auch soll eine Übergangsfrist (Verabschiedung Beschluss Frühling 2018, Inkrafttreten 1. Januar 2019,
siehe auch Kapitel 6) vorgesehen werden, welche es den Leistungserbringern ermöglicht, ihre Struk-
turen und Prozesse anzupassen und in welcher die Tarifpartner Fragen der Tarifierung und des admi-
nistrativen Prüfungsverfahren klären können.
Weiter soll die Umsetzung mit einem Monitoring begleitet und die Auswirkungen evaluiert werden.
3.3 Liste der Eingriffe
Für die sechs ausgewählten Gruppen von elektiven Eingriffen (Abbildung 2) wurde eine Liste mit
CHOP-Codes erstellt, die den Fachgesellschaften im Juli / August 2017 zur Konsultation zugestellt
wurde. Unter Berücksichtigung der Rückmeldungen wurden Anpassungen vorgenommen und ein
Referenzdokument „Liste ambulant durchzuführender elektiver Eingriffe“ erstellt, für die grundsätzlich
nur eine ambulante Durchführung aus der Grundversicherung vergütet wird, ausser es liegen beson-
dere Umstände (siehe dazu Kap. 3.4) vor. Muss einer der Eingriffe notfallmässig durchgeführt werden
(z.B. Leistenhernienoperation bei inkarzerierter Hernie) fällt dieser nicht unter diese Regelung bezüg-
lich elektiver Eingriffe.
6Abbildung 2: Grundsätzlich ambulant durchzuführende elektive Eingriffe
Eingriffe
1 Krampfaderoperationen der unteren Extremität
2 Eingriffe an Hämorrhoiden
3 Leistenhernienoperationen
4 Diagnostische/therapeutische Eingriffe an der Gebärmutter und am Gebärmutterhals
5 Kniearthroskopien inkl. Eingriffe am Meniskus
6 Eingriffe an Tonsillen und Adenoiden
Spezifische seitens der Fachgesellschaften eingebrachten Anmerkungen, die nicht oder nur teilweise
im Referenzdokument berücksichtigt worden sind, werden nachfolgend dargelegt.
Bei verschiedenen Eingriffen wurde darauf hingewiesen, dass diese bei verschiedenen Komorbiditä-
ten nicht ambulant durchgeführt werden können. Diese eingebrachten Komorbiditäten sind nach Ein-
schätzung des BAG im Referenzdokument "Kriterien für eine stationäre Durchführung" abgedeckt und
deshalb nicht in der Bezeichnung der Eingriffe berücksichtigt.
Bezüglich den Leistenhernienoperationen wurde auf die Problematik der Komorbidität bei älteren Pa-
tienten hingewiesen und eine Alterslimite für die ambulante Durchführung von 65 Jahren eingebracht.
Das BAG ist der Ansicht, dass mit dem Referenzdokument „Kriterien für eine stationäre Durchführung“
den Faktoren der Komorbidität angemessen Rechnung getragen wird. In den Diskussionen mit Vertre-
tern der Fachgesellschaften war die Mehrheit der Ansicht, dass das Alter alleine als Grund für einen
stationären Eingriff, angesichts der sehr grossen Variabilität des Gesundheitszustandes bei Senioren,
als nicht angemessen erscheint und nicht in den Kriterien aufgeführt werden soll. Somit wurde keine
Alterslimite aufgenommen.
Bezüglich der Dilatation und Curettage im Anschluss an Geburt oder Abort (CHOP Z69.02) wurde
eine Streichung betreffend "im Anschluss an eine Geburt" beantragt, da Geburten per se selten ambu-
lant seien und postpartale Curettagen bei Fällen vermehrter Blutung (häufig wegen Plazentaresten
oder Atonie) indiziert sind. Auch bei Fällen von Wiedereintritten wegen vermehrten Blutungen im Wo-
chenbett handle es sich immer um Risikosituationen mit zusätzlichen Blutverlust beim Eingriff selbst.
Dies benötige eine verlängerte postoperative Überwachung, welche nicht ambulant durchführbar sei.
Das BAG hat in der Liste die Ausnahme bei Kombination mit Geburt aufgeführt, hingegen Wiederein-
tritte wegen Blutungen im Wochenbett nicht spezifisch berücksichtigt, da die Liste nur elektive Eingrif-
fe umfasst und Hospitalisationen aufgrund von nachgeburtlichen Notfällen nicht von der Regelung
betroffen sind.
Betreffend Eingriffen an Tonsillen und Adenoiden wurde eingebracht, dass bei Kindern unter 6 Jahren
eine stationäre Durchführung indiziert sei. Gemäss Angaben von Anästhesisten und einer gängigen
Praxis, in der bereits 3 -jährige Kinder ambulant adenotomiert werden, ist ein Mindestalter von 6 Jah-
ren für den erwähnten Eingriff für das BAG nicht nachvollziehbar. Eine Stellungnahme von Seiten der
Kinderchirurgen ist noch ausstehend.
3.4 Kriterien für eine stationäre Durchführung
Nicht alle der gelisteten Eingriffe können in jedem einzelnen Fall ambulant durchgeführt werden. Be-
gleiterkrankungen und andere Umstände können eine stationäre Durchführung erforderlich machen.
Sowohl in Frankreich wie in Deutschland wurden verschiedene Kriterien definiert, die eine stationäre
Behandlung rechtfertigen.
In einem Referenzdokument werden Kriterien genannt, die eine stationäre Durchführung zu Lasten
der OKP rechtfertigen. Ziel war es, ein System zu entwickeln, das einfach handhabbar ist und eine
administrativ einfache, rasche und einheitliche Beurteilung in einer grossen Mehrheit der Fälle erlaubt.
7Stationäre Durchführungen in besonderen Fällen ausserhalb dieser Kriterien sind möglich und erfor-
dern eine Einzelfallprüfung.
Für die Erarbeitung solcher Kriterien hat das BAG Gespräche mit Vertretern der betroffenen Fachge-
sellschaften geführt. Die Diskussionen erfolgten auf der Basis eines Vorschlags, der von der Schwei-
zerischen Gesellschaft der Vertrauensärzte (SGV) eingebracht und von der Schweizerischen Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR) weiterentwickelt wurde. Zudem hat sich das BAG
mit den Kantonen ausgetauscht, die sich mit denselben Fragen auseinandersetzten. Beide konsultier-
ten Kantone haben ihre Kriterien in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Ärzteschaft erarbeitet.
Unabhängig von diesen Kriterien können immer auch unvorhergesehene Ereignisse oder Umstände
eintreffen, die eine Entlassung nach Hause nicht ermöglichen. Diese stellen nicht Bestandteil der vor-
gesehenen Regelung auf Verordnungsstufe dar.
3.5 Prüfungsverfahren
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben. Das BAG
stellt im Rahmen der Konsultation die zwei unten dargestellten Varianten vor. In der vorgesehenen
Übergangsphase sollen dann die konkreten Aspekte des administrativen Verfahrens zur gewählten
Variante festgelegt werden.
3.5.1 Variante 1, vorgängige Bewilligung durch den Versicherer
Soll ein elektiver Eingriff gemäss Liste im Referenzdokument stationär durchgeführt werden, muss
vorgängig immer ein Gesuch um Kostengutsprache beim Krankenversicherer gestellt und durch die-
sen bewilligt werden. Ist eines der genannten Kriterien erfüllt, kann die Kostengutsprache ohne aus-
führliche Fallprüfung erteilt werden. Andernfalls kann auch ein begründetes Gesuch z.H. des Vertrau-
ensarztes eingereicht werden. Die Voraussetzung der vorgängigen Kostengutsprache wird in der KLV
festgeschrieben.
Stärken:
- Zwingende vorgängige Kontrolle erlaubt es, alle Fälle zu erfassen.
- Vorgängige klare Finanzierungsverhältnisse für Patienten, Leistungserbringer und Versicherer
- Effiziente Methode, um eine ambulante Durchführung zu fördern.
Schwächen:
- Kontinuierlicher, zusätzlicher administrativer Aufwand auf Seiten der Leistungserbringer und
der Versicherer
- Bei jeder Erweiterung der Liste um zusätzliche Eingriffe steigt der administrative Aufwand an.
3.5.2 Variante 2, nachträgliche Rechnungskontrolle sowie vorgängiges Kostengutsprache-
verfahren für Spezialfälle
Fälle, die eine stationäre Behandlung benötigen und eines der Kriterien gemäss Referenzdokument
erfüllen, können ohne vorgängige Kostengutsprache seitens Versicherer durchgeführt werden. Die
Erfüllung der Kriterien ist seitens Leistungserbringer entsprechend zu dokumentieren respektive zu
codieren.
Für Fälle ausserhalb der im Referenzdokument genannten Kriterien, muss vorgängig eine Kostengut-
sprache beim Versicherer eingeholt werden.
Es erfolgt eine Rechnungskontrolle durch den Krankenversicherer. Rechnungen mit den in der Liste
aufgeführten CHOP-Codes werden von der Datenannahmestelle der Krankenversicherer zeitnah auf
ihre Plausibilität und Erfüllung der Kriterien geprüft. Für stationär erfolgte Eingriffe müssen entweder
Codes zur Erfüllung der Kriterien oder eine Kostengutsprache vorliegen. Rechnungen, die keine ent-
8sprechende Dokumentation aufweisen werden zur Einzelfallprüfung ausgesteuert und beim Leis-
tungserbringer wird ein Bericht eingefordert.
Die Installation des Systems ist Sache der Tarifpartner. In der KLV werden keine näheren Vorgaben
gemacht. Die Rechnungskontrolle muss durch die Krankenversicherer durchgeführt werden.
Stärken:
- Adäquat stationär erbrachte Leistungen verursachen nur einen geringen laufenden Aufwand
- Einheitliche Prüfsystematik für alle Versicherten
- Minimierung der Anzahl Kostengutsprachegesuche auf unklare Fälle
- Vorgängig geklärte Finanzierungsverhältnisse bei unklaren Fällen
Schwächen:
- Voraussichtlich würden zusätzliche CHOP-Codes hinsichtlich der Kriterien notwendig
- Unsicherheit bezüglich Umsetzung der Rechnungskontrolle durch alle Versicherer
- Latenz der Medizinische Statistik der Krankenhäuser erschwert Massnahmen aufgrund des
Monitorings
4 Monitoring und Evaluation
Die Auswirkungen der Massnahme sollen hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl ambulanter und
stationärer Eingriffe überwacht werden. Innerhalb von drei Jahren soll eine Evaluation hinsichtlich
Auswirkungen der Massnahme auf Patienten, Leistungserbringer und Versicherer hinsichtlich Qualität
und Kosten erfolgen. Ein Monitoringkonzept ist in der Übergangsphase zu entwickeln. Das BAG wird
die Stakeholder in die Ausarbeitung des Konzepts direkt einbeziehen.
5 Finanzielle Auswirkungen
Zusammen mit den Abschätzungen zu den verlagerbaren Fällen hatte das BAG erste Berechnungen
zu den finanziellen Auswirkungen vorgenommen, welche keine Zusatzbelastungen auf Seiten der
Versicherer respektive Prämienzahlenden ergaben. Die finanziellen Auswirkungen auf die Prämien
und die Kantone werden aufgrund der konkretisierten Liste der Eingriffe sowie den neuen ab dem Jahr
2018 geltenden Tarifen neu berechnet. Das BAG bezieht die Tarifpartner und Kantone parallel zur
Konsultation der KLV-Änderungen in diese Arbeiten ein. Wenn später in der Übergangsphase die
Tarifpartner sich auf neue spezifische Tarife einigen würden, wären dementsprechende neue Berech-
nungen erforderlich.
6 Zeitplan / Inkraftsetzung
Folgender Zeitplan ist vorgesehen:
- Frühjahr 2018: Beschluss KLV-Anpassung durch Departementsvorsteher EDI
- 1. Januar 2019: Inkrafttreten der KLV-Änderungen
Erarbeitung Konzept für Monitoring und Evaluation in Übergangsphase durch Bund mit Einbezug der
Stakeholder.
Aufgaben der Tarifpartner in der Übergangsphase:
- Definition der administrativen Prozesse zwischen Leistungserbringern und Versicherern
- Klärung tariflicher Fragen
9Anhang 1
Auswertung Obsan und BAG: Fallzahlen von 37 ambulant durchführbaren Eingriffen (nach Definition
der IAAS), die stationär erfolgt sind (Auswertung Medstat 2013) sowie Fallzahlen für ambulant erfolgte
Eingriffe (Auswertung Tarifpool 2013, Angaben wo vorhanden).
Eingriffe 2013 Fälle stationär Fälle ambulant
PCCL=0, nur Verlagerbare
Total Anteil
Eingriff Total PCCL=0 KV ohne Fälle (zusätz-
ambulant Ambulant
Notfälle lich LOSSie können auch lesen