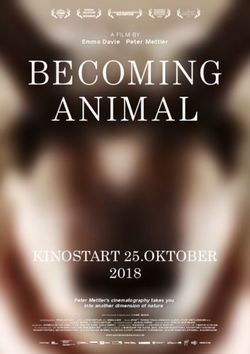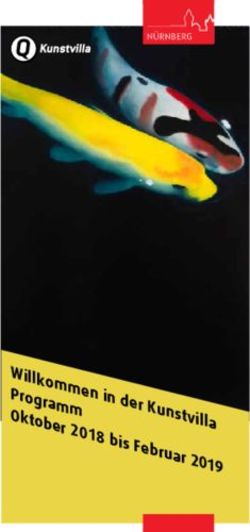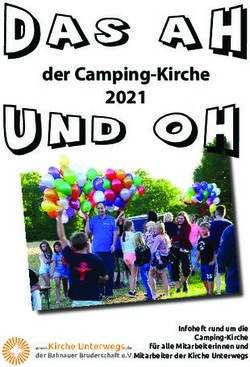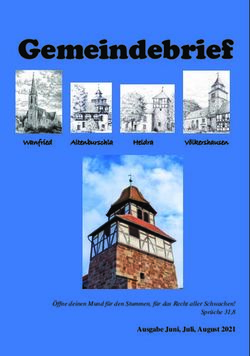ERSTSPRACHERWERB: GRUNDLAGEN - eClass
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DGB 41 THeorien des Spracherwerbs Universität Athen, SoSe 2021
Winfried Lechner Skriptum, Teil 1
ERSTSPRACHERWERB: GRUNDLAGEN
Dieser erste Teil des Skriptums definiert die wichtigsten Aufgaben und Ziele der Forschung zum
kindlichen Spracherwerb (Erstspracherwerb, im Folgenden auch L1). Außerdem werden
grundlegende linguistische und psycholinguistische und Begriffe eingeführt bzw. wiederholt
werden.
Allgemeine Hinweise zum Skriptum
Die Reihenfolge, in der die einzelnen Themen auftauchen, entspricht nicht immer jener, in der
diese Themen im Seminar besprochen werden. Der Prüfungsstoff umfaßt alles, was im Seminar
durchgenommen wurde. Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare, Hinweise, Fragen, Vorschläge
und Korrekturen! Jeder Hinweis, der zur Verbesserung des Skriptums beiträgt, ist jederzeit
willkommen (wlechner@gs.uoa.gr)!
1. SPRACHLICHE ENTWICKLUNG
Drei Arten der zeitlichen Veränderung von Sprache. Jedes Lebewesen besitzt genetisch
veranlagte Eigenschaften, deren Summe man in der Biologie als den Genotyp bezeichnet. Im
Laufe der Ontogenese kommt es durch genetisch bedingte Veränderungen sowie durch den
Einfluss der Umwelt zur Ausbildung eines individuellen Lebewesens - des Phänotyps. Im
Gegensatz zur Ontogenese steht die Phylogenese. Unter Phylogenese versteht man ‘Evolution’
im allgemein gebräuchlichen Sinne, sie beschreibt die Veränderung des genetischen Materials
über mehrere Generationen hinweg:
(1) a. Ontogenese: Biologische Entwicklung des einzelnen Individuums. Veränderung des
Phänotyps.
b. Phylogenese: Entwicklung aller Individuen einer Art (Stammesgeschichte).
Veränderung des Genotyps.
Auch bei der menschlichen Sprachfähigkeit handelt es sich, da sie auf biologischen Grundlagen
basiert, um ein Phänomen der Biologie. Genauer gesagt bildet das Sprachsystem einen Teil des
kognitiven Apparats, der unterschiedliche Arten von Information im Gehirn verarbeitet und für
unterschiedliche Aspekte des Verhaltens zuständig ist. Typische Aufgaben der Kognition
umfassen die Bildung des Bewusstseins, die Fähigkeit zu Zählen und stereoskopisch (3D) zu
sehen, die Aufmerksamkeit, die Verarbeitung von Musik, die Orientierung im Raum und die
Interpretation der Handlungen anderer Individuen (sogenannte Theory of Mind; s.u.).
Das auf Sprache spezialisierte kognitive System generiert und analysiert abstrakte
Repräsentationen (z.B. Phrasenstrukturbäume oder phonologische Repräsentationen), und leitet
diese Information an die periphären Systeme (Larynx, Mund, Zunge, Ohr, etc...) weiter, wo die
abstrakten Strukturen in akustische Signale (Schallwellen) umgewandelt werden (für Details
s.u.). Diesen Prozess, in dessen Verlauf abstrakte Repräsentationen in akustische Signale
umgewandelt werden, nennt man Externalisierung (εξωτερίκευση). Externalisierung ist eine Art
von Transduktion, also Informationsumwandlung.
Um die oben angedeutete Ähnlichkeit zwischen Sprache und anderen biologischen Systemen
zu betonen, wird Sprache oft auch als ein abstraktes Organ bezeichnet. Jede sprachlicheÄußerung ist somit das Produkt eines biologischen Systems. Auch bei Sprache kann daher
zwischen unterschiedlichen Arten von zeitlich abhängigen Veränderungen differenziert werden.
Konkret verläuft die zeitliche Entwicklung von Sprache entlang dreier unterschiedlicher
Dimensionen:
(2) a. Evolution von Sprache als biologisches System (wird in Biolinguistik,
Evolutionsbiologie untersucht)
b. Historische (auch: diachrone) Sprachentwicklung, z.B. des Althochdeutschen zum
Neuhochdeutschen (Teil der Indogermanistik und Historischen Sprachwissenschaft)
c. Spracherwerb des Kindes (Gebiet der Psycholinguistik und Neurolinguistik)
Die Frage, wie sich Sprache im Menschen phylogentisch entwickelt hat wird in verschiedenen
Disziplinen wie der Evolutionsbiologie, Biolinguistik, Kognitionsforschung und Anthropologie
untersucht. Eines der Ergebnisse aus diesem Bereich ist, dass Homo sapiens zumindest seit
100,000 über Sprache verfügen dürfte, sowie dass die Evolution von Sprache eng mit anderen
kognitiven Entwicklungen (Rechnen, Planen, Musik) und kulturellen Veränderungen
(Siedlungsbau, gemeinsame Jagd, ...) verbunden sein muss.1
Davon zu trennen ist die diachrone, historische Entwicklung von Sprache. Diese sollte nicht
mit der biologischen Entwicklung des Sprachsystems verwechselt werden. Während sich z.B.
Althochdeutsch (750 – 1,050 n.Chr.) stark vom heutigen Deutsch unterscheidet, hat sich Homo
sapiens in den letzten 1,000 Jahren genetisch praktisch nicht verändert. Sprachgeschichte ist also
nicht Phylogenese!
Im Zentrum des Interesses der Spracherwerbsforschung und somit auch dieses Kurses steht
schließlich die sprachliche Ontogenese, also das Reifen des Sprachsystems (das Wachsen des
Sprachorgans) im einzelnen Individuum. Spracherwerbsforschung befasst sich mit Aspekten der
Entwicklung (oder Reifung) des kognitiven Apparats. Die Erkenntnisse in diesem Bereich
basieren dabei meistens auf Daten, die entweder auf (i) Beobachtungen an Sprechern (Kindern)
in natürlicher Umgebung zurückgehen, oder (ii) mit Hilfe von Experimenten gewonnen werden.2
Spracherwerbsforschung ist daher ein Teil der Psycholinguistik oder der kognitiven
Entwicklungspsychologie.
L1 vs. L2. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen zwei Arten von Spracherwerb - Erst-
und Zweitspracherwerb - je nachdem ob es sich bei der erworbenen Sprache um eine
Muttersprache handelt oder nicht. Als Muttersprache wird jene Sprache bezeichnet, die im frühen
Alter - in der sogenannten kritischen Periode (s.u.) - ungelenkt, d.h. ohne Unterricht, erworben
wird:
(3) a. Erstspracherwerb (L1-Erwerb): Prozess, der zum Erwerb der Muttersprache(n) führt
b. Zweitspracherwerb (L2-Erwerb): Erwerb einer weiteren Sprache
i. Ungelenkter, früher L2-Erwerb (bilingualer Erstspracherwerb; Meisel 1984)
ii. Gelenkter, später L2-Erwerb (= Fremdspracherwerb)
Weiters macht es einen Unterschied, ob L2 früh und ungeleitet (d.h. ohne Unterricht) stattfindet,
oder ob die Zweitsprache erst spät, z.B. im Schulalter und mittels Unterricht erworben wird.
1
Eine gute Einführung in die Evolution von Sprache bieten Fitch (2010) und Hauser (1996).
2
Zusätzlich kommen auch neurologische Verfahren (ERP, fMRI,... ) und Computersimulationen zur
Anwendung. Darüber später mehr.3 DGB 41 Spracherwerb, SoSe 2021
Daraus ergeben sich die drei möglichen Spracherwerbssituationen in (3). (Weitere Details zur
Unterscheidung L1 vs. L2 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.)
Vorschau. Dieser Kurs führt in grundlegenden Aspekte der Spracherwerbsforschung ein, stellt
Theorien und Methoden vor, die in der Forschung zur Anwendung kommen, und diskutiert
wichtige Resultate der Forschung. Der Fokus liegt dabei auf L1-Erwerb. (4) listet zentrale
Themen auf, die im Laufe des Seminars behandelt werden sollen:
(4) Inhalt des Kurse
a. Was wird erworben? Definition von Sprache, Unterschiede Sprache vs.
Tierkommunikation, biologische Voraussetzungen für Sprache
b. Wie wird Sprache erworben?
i. Universalgrammatik und Poverty of Stimulus (I)
ii. In welcher Reihenfolge lernen Kinder unterschiedliche Phänomene? Übersicht
über Stadien und Sequenzen des L1-Erwerbs.
c. Was kann gelernt werden?
i. Lerntheorien (Golds Theorem und Chomsky Hierarchie)
ii. Poverty of Stimulus (II)
d. Methodik: Mit welchen Mitteln und Methoden kann man Spracherwerb untersuchen,
messen und diagnostizieren?
e. Theorien des Spracherwerbs: Unterschiedliche Ansätze in der
Spracherwerbsforschung, inklusive kurzem historischem Überblick.
f. Phänomene und Fallbeispiele: Analyse ausgewählter syntaktischer und semantischer
Phänomene (Pronomen, Satzstruktur, Nullsubjekte, wh-Bewegung,...)
g. Theoretische Konsequenzen: Welche Erkenntnisse gewinnt man durch Studium des
Spracherwerbs für die allgemeine Theorie des Sprachsystem?
h. Special Language Impairment (SLI): Sprachstörungen und Störungen der
Sprachentwicklung
i. L1 vs. L2: Wie unterscheidet sich L1-Erwerb von L2-Erwerb?
2. NATÜRLICHE SPRACHE
Bevor wir uns L1-Erwerb zuwenden, ist es notwendig, einige grundlegende Eigenschaften von
Sprache und des Sprachsystems explizit zu machen. Erst mit einer einigermassen präzisen
Definition von Sprache ist es möglich, auf sinnvolle Art und Weise zu fragen, was eigentlich im
Laufe des Spracherwerbs gelernt wird.
2.1. SPRACHE UND GRAMMATIK
Als ein sprachliches Zeichen bezeichnet man einen Ausdruck, der über eine phonologische,
syntaktisch/morphologische und semantische Struktur verfügt. Das Zeichen kann einfach (Buch)
oder komplex (das grüne Buch) sein.
(5) Sprachliches Zeichen
Multimodalität. Die Form eines sprachlichen Zeichens wird in gesprochenen Sprachen durch
akustische Signale vermittelt (man sagt auch: kodiert). Nicht alle natürliche Sprachen verwenden
akustische Signale, die selbe Information kann auch mit anderen Mitteln (sogenannten
Modalitäten) ausgedrückt werden. In Gebärdensprachen (sign language, νοηματική γλώσσα)#1: Grundlagen 4
wird die Form z.B. nicht mittels Schallwellen, sondern mittels Bewegungen der Hände und Arme
kodiert.3 Sprache ist also multimodal.
Zeichen bilden die atomaren Bestandteile von Sprachen. Formal gesehen bestehe alle
Sprachen aus zwei Komponenten. (i) einem Alphabet, das die Grundbausteine der Sprache
definiert zur Verfügung stellt, und einer (ii) Menge von Regeln, welche die Grammatik der
Sprache charakterisieren. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um natürliche oder formale
Sprachen (Logische Sprachen, Computersprachen wie C++ oder Prolog) handelt. Die Grammatik
produziert aus dem Alphabet schrittweise Sätze und andere komplexe Ausdrücke.
(6) Alphabet: endliche Menge der atomaren Ausdrücke einer Sprache. Diese Ausdrücke
werden auch Symbole der Sprache genannt.
Beispiele:
Alphabet des Griechischen = Menge aller griechischen Morpheme/Phoneme
Alphabet der griechischen Orthographie = {α, β, γ,...}
Alphabet der natürlichen Zahlen = {0, 1, 2, 3, ...9}
Alphabet des Morse-codes = {., –}
(7) a. Satz: Kette (string) von Symbolen aus dem Alphabet einer Sprache.
b. Grammatik: endliche Menge von Regeln, die aus dem Alphabet einer Sprache eine
potentiell unendliche Menge von Sätzen/Ausdrücken produziert.
c. Sprache: die Menge aller Sätze, die eine Grammatik generiert.
Die Aufgabe der naturwissenschaftlich orientierten Untersuchung von Sprache besteht darin, die
Eigenschaften jener Grammatiken zu entdecken, mit der sich alle natürliche, menschlichen
Sprachen - und ausschließlich diese - generieren lassen. Weiters soll erklärt werden, warum die
Grammatik genau die Form besitzt, die man in den Sprachen der Welt beobachtet.
2.2. UG, LAD, PSD UND PARAMETER
UG. Im Rahmen der Generativen Grammatik (Noam Chomsky, ab 1955) geht man davon aus,
das es sich bei der menschlichen Sprachfähigkeit um eine angeborene Eigenschaft handelt. Diese
angeborene Fähigkeit, Sprache zu erlernen wird auch als Universalgrammatik (UG) bezeichnet.
Die Annahme, dass die genetische Ausstattung des Menschen auch eine UG umfasst wurde in
den letzten 50 Jahren durch unzählige experimentelle Resultate unterstützt und wird von
praktisch allen seriösen Linguistinnen akzeptiert.4 Die Frage, wie genau UG aussieht, wie viel
Information angeboren ist, und in welcher Form steht dagegen noch im Zentrum aktiver
Forschung.
3
Die Forschung der letzen 50 Jahre hat gezeigt, dass Gebärdensprachen über die gleiche formale
Ausdruckskraft wie akustische Sprachen verfügen: alles was in akustischer Sprache ausgedrückt werden
kann, kann auch in einer Gebärdensprachen ausgedrückt werden (und umgekehrt). Weltweit existieren
über 300 Gebärdensprachen. Für Übersicht s. Quer (2013) auf E-class/Dokumente.
4
Diese Einschränkung ist wichtig, da man leider immer wieder Meinungen zu wissenschaftlichen Themen
hören muss, die von Leuten stammen, die von der Materie wenig oder nichts verstehen. Ein Beispiel ist
die Debatte um Evolution vs. Kreationismus/Kreatives Design, in der religiöse Gruppen vermeintliche
Argumente gegen Evolution verbreiten. Ähnliche unqualifizierte Aussagen findet man
bedauerlicherweise auch in der Linguistik (Konstruktionsgrammatik, gewisse Formen kognitiver
Linguistik, Funktionalismus, ...).5 DGB 41 Spracherwerb, SoSe 2021
Konkret sind alle Individuen der Spezies Homo sapiens mit der selben, genetisch veranlagten
mentalen Grammatik, der Universalgrammatik (UG), ausgestattet. UG ist eine angeborene
biologische Eigenschaft und stellt daher einen Genotyp dar. Die Universalgrammatik legt einige
grundlegende Charakteristika aller Sprachen fest (s. Abschnitt 2.2), ist jedoch noch nicht in allen
Eigenschaften voll spezifiziert. Dies bedeutet, dass der Genotyp UG ‘Leerstellen’ besitzt, die
man auch Parameter nennt, und die im Laufe des L1-Erwerbs mit Information gefüllt werden.
Auf diese Art kommt es im Individuum zur Ausbildung von Grammatiken für konkrete
Einzelsprachen. Wie dies geschieht, wird im Folgenden etwas näher ausgeführt. Details folgen
dann zu einem späteren Zeitpunkt.
LAD. Kinder werden mit der Fähigkeit geboren, eine mentale Grammatik zu erwerben. Diese
Fähigkeit wird in der Literatur auch der Spracherwerbsmechanismus (Language Acquisition
Device; LAD; Chomsky 1965) genannt. Zu Beginn besitzen Kinder noch keine einzelsprachliche
Grammatik, sondern verfügen über alle Möglichkeiten, die UG zulässt. Bei der Geburt sprechen
Kinder also, etwas vereinfacht gesagt, nicht Navajo, Griechisch, Albanisch, Kiswahili oder
Warlbiri, sondern jede mögliche Sprache. Im Laufe des L1-Erwerbs wird das Kind mit einer
großen Anzahl von primären sprachlichen Daten5 (PSD; primary linguistic data, PLD)
konfrontiert. Unter PSD versteht man sprachliche Äußerungen, mit denen Kinder in normaler
sprachlicher Umgebung in Kontakt kommen. Das LAD ermöglicht es Kindern nun aus PSD der
Umwelt eine einzelsprachliche Grammatik zu filtern. Diesen Prozess, in dessen Verlauf
Grammatiken eliminiert werden, die nicht mit den PSD der Umgebung kompatibel sind, nennt
man selektives (vs. instruktives) Lernen (Marler 1997; s.u.).
Konkret besteht LAD aus mehreren Teilen: den angeborenen Prinzipien der UG, sowie
einigen anderen grundlegenden, teils allgemeinen und teils wahrscheinlich sprachspezifischen
Fähigkeiten, wie z.B. der Fähigkeit, akustische Daten zu segmentieren (in Silben und Morpheme
aufzutrennen), und zu kategorisieren und der Fähigkeit, aus diesen Daten zusammen mit UG eine
Zielgrammatik zu bilden.
PSD. Welche Form ein Parameter annimmt, hängt vom sprachlichen Umfeld des Kindes ab. Im
Sinne der im Abschnitt 1 besprochenen Unterscheidung stellt UG also einen Genotyp dar, der
durch Kontakt mit der Umwelt zu einem Phänotyp, einer konkreten Zielgrammatik, wächst. Sehr
vereinfacht sieht das allgemeine Format für Parametersetzung wie folgt aus: PSD bilden den
Input des kindlichen Spracherwerbs. Dieser Input variiert natürlich je nach sprachlicher
Umgebung, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Zuerst zum qualitativen Aspekt: Kinder, die
in einer albanischen Sprachgemeinschaft aufwachsen, werden hauptsächlich mit PSD aus dem
Albanischen konfrontiert, während japanische Kinder vorwiegend Äußerungen aus dem
Japanischen hören. Sprecher des Deutschen hören z.B. Äußerungen wie (8)a, Sprecher des
Englischen dagegen (8)b. Durch diese und viele ähnliche Sätze schließt das Kind, dass die VP
des Deutschen hauptfinal ist (die Abfolge ist OV), während VPs im Englischen hauptinitial sind
(VO):
(8) a. Sie behauptet, dass Peter keine Erdbeeren mag Y [VP O V]
b. She is claiming that Peter doesn’t like strawberries Y [VP V O]
5
Im Gegensatz zu PSD stehen ‘sekundäre Daten’, wie man sie in Grammatiken oder linguistischen Texten
findet (‘Das finite Verb im nicht eingebetteten deutschen Hauptsatz nimmt die zweite Position ein').#1: Grundlagen 6
Sind alle Parameter der UG gesetzt, kommt es zur Ausbildung einer vollständigen,
sprachspezifischen Grammatik, etwa des Albanischen, Griechischen, Japanischen, Kinyarwanda
oder einer der anderen ca. 7,000 bekannten Sprachen weltweit. Man nennt eine solche konkrete,
voll ausgeformte Grammatik einer Einzelsprache auch Zielgrammatik. Unterschiedliche
Sprachen sind dabei das Produkt unterschiedlicher Parametersetzung.
Aber es gibt auch beträchtliche quantitative Varianz im Input, dem Kinder ausgesetzt sind.
Nicht alle Kinder werden der gleichen Anzahl an PSD konfrontiert. So stellten Hart und Risley
(2003)6 fest, dass in den USA Kinder von Eltern, die höheren sozio-ökonomischen Klassen
angehören, ca. 11,2 Millionen Worten pro Jahr ausgesetzt sind, wohingegen Kinder von
Arbeitern nur ca. 6,5 Millionen Worte und Kinder von Sozialhilfeempfängern im Durchschnitt
nur um die 3,2 Millionen Worte hören. Dennoch entwickeln alle Kinder vollständige
Sprachkompetenz in ihrer Zielsprache. Das LAD ist also robust genug, um diese großen
statistischen Unterschiede zu eleminieren.
Selektives vs. instruktives Lernen. UG legt fest, welche Form ein Parameter annehmen kann. So
kann z.B. der Direktionalitätsparameter der VPs entweder als VO oder als OV gesetzt werden,
die Option, OS oder SO existiert jedoch nicht - dies folgt aus der Tatsache, dass die VP
universell, also in allen Sprachen, aus dem Verb und dem Objekt besteht, und nicht aus dem
Verb und dem Subjekt. Diese Eigenschaft ist Teil der UG und daher schon festgelegt, bevor der
eigentliche L1-Erwerb beginnt. Durch PSD wird dann entweder der eine oder der andere Wert
(OV vs. VO) ausgewählt. Man nennt diesen Vorgang auch selektives Lernen, da Signale aus der
Umwelt zu einer Wahl zwischen bereits durch die UG vorgegebenen Werten führt (Edelman
1987; Marler 1997). Beispiele für selektives Lernen umfassen das Immunsystem und
Vogelgesänge. Im Gegensatz dazu steht das instruktive Lernen, bei dem externe Faktoren das
kognitive System formen und ihm eine neue Struktur geben. Beispiel für instruktives Lernen
inkludieren das Erlernen von Spielen (Schach, Poker, Bridge,...) oder eines Musikinstruments.
2.3. NICHT-SPRACHSPEZIFISCHE KOGNITIVE FÄHIGKEITEN
Kinder verfügen natürlich auch über nicht sprachspezifische, kognitive Fähigkeiten, wie etwa das
Gedächtnis, die Fähigkeit zu Zählen und zu Sortieren, oder Lernmechanismen, mit deren Hilfe
aus ungeordneten Daten statistische Regelmäßigkeiten gefiltert werden können. Im Spracherwerb
spielen auch diese, nicht allein auf Sprache beschränkten Faktoren, eine wichtige Rolle. Ein
Beispiel verdeutlicht, welchen Beitrag nicht sprachspezifische, Fähigkeiten leisten.
PSD besteht ausschließlich aus nicht-analysierten akustischen Signalen, in denen
Informationseinheiten nicht voneinander getrennt aneinander gereiht werden. Wird z.B. ein Satz
wie (9)a geäußert, dann entsteht eine Kette von Lauten, in denen das Ende und der Beginn der
Wörter üblicherweise nicht durch Pausen gekennzeichnet wird ((9)b). Das Kind kann daher im
frühen Stadium des L1, in den ersten Lebensmonaten, noch nicht erkennen, dass eine Frage wie
(9)a aus drei diskreten, unterschiedlichen Einheiten besteht:
(9) a. Hast Du Hunger? (Orthographie)
b. [hast‰xuõX] (IPA-Transkription von (9)a)
c. hast_du_Hunger (Segementierung)
6
https://www.aft.org/ae/spring2003/hart_risley7 DGB 41 Spracherwerb, SoSe 2021
Eine der ersten Schritte im L1-Erwerb besteht daher darin, dieses unanalysierte Signal zu
segmentieren, d.h. in diskrete Teile zu zerlegen. Diese Trennung des Signals in kleinere
Einheiten wird durch allgemeinere, stochastische und statistische Systeme in unserem Gehirn
ermöglicht, die vermutlich auch in anderen, nicht-sprachlichen Bereichen, wie etwa der
Verarbeitung von Musik oder der Erkennung von visuellen Mustern, zur Anwendung kommen.
L1-Erwerbs setzt also neben PSD und UG auch das Vorhandensein einer dritten Gruppe von
Faktoren voraus.
Nach der Segmentierung endet die Analyse noch nicht. Sprache besitzt Struktur, die Kette
in (9)b muss also in eine reichere Repräsentation - etwa ((9)d - überführt werden. Diese Aufgabe
wird nun wieder von einem sprachspezifischen System übernommen, das für die Generierung
der Struktur und die Benennung der Knoten (Kategorisierung) zuständig ist. Am Schluss weist
die mentale (generative) Grammatik also dem Signal in (9)b die syntaktische Repräsentation in
(9)d zu (die semantische Repräsentation fehlt hier noch).
(9) d. [CP [V° hast]1 [IP du [VP [NP Hunger] t1]]] (Syntaktische Form)
Dass es sich bei dem Mechanismus, der (9)d generiert, um sprachspezifische Systeme handeln
muss, folgt u.a. aus folgender Überlegung. In syntaktische Repräsentation erhält jeder Knoten
einen Namen, der seiner morphosyntaktischen Kategorie (V, N, ...) entspricht. Welche
Kategorien ein Knoten enthält hängt nun alleine von linguistischen Faktoren ab. Es existiert z.B.
keine Sprache, in der alle grünen Objekte einer Kategorie α und alle roten Objekte einer
Kategorie β zugeordnet werden würden, oder in der alle stummen Objekte sich wie Zählnomen
und alle lauten Objekte sich wie Massennomen (Wasser) verhalten würden. Dies ist unerwartet,
wenn die Grammatik auch Zugang zu anderen kognitiven System, wie dem visuellen System,
hätte. Die Tatsache, dass linguistische Eigenschaften niemals durch nicht-linguistische Faktoren
determiniert werden zeigt also, dass die Grammatik nicht mit diesen anderen Systemen in
Kontakt steht.
Résumé. Zusammenfassend lässt sich der Weg von UG zur Zielgrammatik also wie folgt
darstellen.
(10) a. Genotyp (UG) Y Phänotyp (Zielgrammatik)
b. LDA(UG + PSD) Y Zielgrammatik
Weiters wurden bisher die folgenden unterschiedlichen Faktoren identifiziert, die eine
Voraussetzung für Sprache bilden ((11)b wurde nicht explizit erwähnt, ist aber offensichtlich
notwendig, da es sich dabei um die neuronale Basis von (11)c/d handelt).
(11) Voraussetzungen für Sprache
a. Physiologische und anatomische Voraussetzungen: Mundraum (Larynx, Zunge,
Lippen, Ohr)
b. Neuronale Entwicklungen: Gedächtnis, Koordination der periphären Organe (Zunge,
Rachen, Ohr)
c. Allgemeine kognitive Fähigkeiten
d. Sprachsystem (‘Sprachmodul’): Sprachspezifisches mentales System
Generative Grammatik: Vorsicht beim Gebrauch des Terminus Generative Grammatik, da dieser
drei unterschiedliche Dinge bezeichnen kann. Erstens ein formales System, das der Definition#1: Grundlagen 8
von Grammatik in (7)b entspricht; zweitens das abstrakte Sprachorgan, das ein kognitives,
biologisches System darstellt, in dem das formale System umgesetzt (‘implementiert’) wird; und
drittens schließlich eine konkrete (linguistische) Theorie über eines dieser beiden Systeme.
(12) Generative Grammatik
a. Abstraktes formales System (Mathematik, Computerwissenschaft, Mathematische
Linguistik)
b. Psychologisches, mentales Objekt (‘abstraktes Sprachorgan’), das dieses abstrakte
System implementiert.
c. Spezifische Theorie über (12)a und/oder (12)b
3. POVERTY OF STIMULUS (UNZULÄNGLICHKEIT-DES-STIMULUS) ARGUMENT (I)
In diesem Abschnitt werden einige Beschränkungen auf Form und Bedeutung
natürlichsprachlicher Ausdrücke. Die Beobachtungen zeigen, dass gewisse Aspekte des
sprachlichen Wissens nicht erlernt werden können, sondern angeboren sein müssen. In anderen
Worten, Sprecher verfügen über eine genetisch determinierte UG. Man nennt Argumente für UG
der Art, wies sie unten diskutiert werden, auch Unzulänglichkeit-des-Stimulus Argumente
(Poverty of Stimulus, PoS-Argument). Weitere Details zu PoS werden zu einem späteren
Zeitpunkt, in der Diskussion von Lerntheorien, nachgeliefert werden.
3.1. UNIVERSALE BESCHRÄNGUNGEN DES SPRACHSYSTEMS
3.1.1. Beschränkungen auf Form (syntaktische Beschränkungen)
Alle Sprecher des Deutschen empfinden (13)a und (13)b als wohlgeformte Sätze, (13)c jedoch
als unakzeptabel. Dies zeigt, dass Kopfbewegung (nach C°) nicht in allen syntaktischen
Umgebungen möglich ist. Es darf immer nur der strukturell höchste Kopf verschoben werden
(Kopfbewegungsbeschränkung; Travis 1984).
(13) a. Jeder, der will, kann es lesen. (kann wird nach C° bewegt; V2)
b. Kann jeder, der will, es lesen __? (kann wird nach C° bewegt, will bleibt in V°)
c. *Will jeder, der __, es lesen kann?7 (will wird nach C° bewegt, kann bleibt in V°)
Dieses sprachliche Wissen kann nu nicht erlernt sein. Kein Sprecher wurde jemals darauf
hingewiesen wurde, dass Ausdrücke wie (13)c nicht grammatisch sind und daher nicht zum
Deutschen gehören. Kein Kind hört z.B. jemals den Hinweis in (14)a oder die Instruktion (14):
(14) a. Sage niemals einen Satz wie “Will jeder der kann es auch lesen”
b. In Entscheidungsfragen musst du das strukturell höchste finite Verb an die erste
Position verschieben!
Trotzdem ‘weiß’ jeder Sprecher, dass (13)c ungrammatisch ist. Ähnliche Regelmäßigkeiten in
bezug auf Kopfbewegung (und andere Beschränkungen; s.u.) wurden systematisch für alle bisher
7
(13)c kann ohne Probleme interpretiert werden. (13)c bedeutet genau das selbe wie die Frage Will
jemand es nicht lesen, wenn er es nicht lesen kann? Dies folgt aus der Überlegung, dass (13)a synonym
mit (i) ist, und (i) ist wiederum äquivalent mit (ii)
(i) Wenn jemand es lesen will, kann er es lesen.
(ii) Wenn jemand es nicht lesen kann, will er es nicht lesen. (Modus tollens)9 DGB 41 Spracherwerb, SoSe 2021
untersuchten Sprachen beobachtet. Daraus kann geschlossen werden, dass grundlegende
Eigenschaften von Sprache, wie etwa die Kontraste in (13), auf angeborenen Prinzipien basieren
muss. Wesentliche Teile der Grammatik sind also in Form der UG angeboren.
Die Tatsache, dass Sprecher klare Intuitionen über die unterschiedliche Grammatikalität in
(13) besitzen, kann also nicht allein mit Hilfe der Umweltreize (des ‘Stimulus’, d.h. die PSD)
erklärt werden, denen das Kind ausgesetzt ist. Stimuli wie (14) fehlen einfach in der Umwelt des
Kindes. Die Stimuli sind nicht ‘reich’ genug. Man spricht daher hier auch von einem
Unzulänglichkeit-des-Stimulus Argument (‘Poverty of Stimulus’) für die Annahme, dass gewisse,
zentrale Charakteristika des Sprachsystems angeboren sind. Universelle Beschränkungen auf des
Sprachsystem stellen somit ein starkes Argument für UG dar. Im Anschluss werden kurz einige
weitere universale Eigenschaften von Sprache vorgestellt werden.
" Bewegung aus koordinierten Phrasen (Coordinate Structure Constraint; CSC; Ross 1967):
(15) a. Hans lud ihn ein und Maria lud ihn wieder aus.
b. Wen lud Hans ein und Maria wieder aus?
c. *Wen lud Hans ein und Maria wieder auslud?
d. *Wen lud Hans ein und Maria ihn wieder aus?
(16) b. Wen1 lud [Hans twen ein tVerb] und [Maria twen wieder aus tVerb]?
c. *Wen1 lud [Hans twen ein tVerb] und [Maria twen wieder auslud]?
d. *Wen1 lud [Hans twen ein tVerb] und [Maria ihn wieder aus tVerb]?
" Extraposition aus Subjekten (Right Roof Constraint; Ross 1967):
(17) a. Dass er den Preis erhalten hat, der ihm versprochen wurde, ist interessant.
b. Es ist interessant, dass er den Preis erhalten hat, der ihm versprochen wurde.
c. *Dass er den Preis erhalten hat, ist interessant, der ihm versprochen wurde.
" Subjektsinseln: Bewegung aus Subjektssätzen führt zu Ungrammatikalität.
(18) a. Sie meinte dass dieses Buch zu lesen fast unmöglich ist.
b. */?Welches Buch meinte sie dass zu lesen fast unmöglich ist.
" Adjunktsinseln (Ross 1967):
(19) a. Peter hat das Buch gelesen bevor er den Film sah.
b. *Was hat Peter das Buch gelesen bevor er sah t.
(20) a. Obwohl Maria krank war, wollte Peter ins Kino gehen.
b. *Wer wollte obwohl t krank war, Peter ins Kino gehen.
(21) a. Wenn die Regierung die Steuern weiter anhebt, wird mein Arzt seinen Porsche
verkaufen müssen
b. *Was wird mein Arzt seinen Porsche verkaufen müssen wenn die Regierung t anhebt.
" Relativsatzinseln: keine Bewegung aus restriktiven Relativsätzen:
(22) a. Der Freund hat uns empfohlen, den neuen Film von Eastwood zu sehen
b. Was hat uns der Freund empfohlen t zu sehen
c. Von wem hat uns der Freund empfohlen den neuen Film t zu sehen#1: Grundlagen 10
(23) a. Der Freund hat uns einen Film empfohlen, den Eastwood gedreht hat
b. *Wer hat uns der Freund einen Film empfohlen, den t gedreht hat
c. Der Freund hat uns einen Film empfohlen, der von Eastwood gemacht wurde
d. *Von wem hat der Freund uns einen Film empfohlen, der t gemacht wurde
3.1.2. Beschränkungen auf Bedeutung
Bindung und Koreferenz (Bindungstheorie; Chomsky 1981, 1986):
(24) a. Er1 glaubte, dass Peter1 ein guter Koch ist.
b. *Peter1 glaubte, dass er1 ein guter Koch ist.
(25) a. Der Peter1 betrachtete sich1 im Spiegel.
b. *Der Peter1 betrachtete ihn1 im Spiegel.
c. *Der Peter sagte, dass Du sich stundenlang im Spiegel betrachtet hast
d. Der Peter2 sagte, dass Du ihn2 stundenlang im Spiegel betrachtet hast
Weitere Beispiele und Details werden zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden.
3.1.3. Morphologische Beschränkungen
Universale Beschränkungen auf mögliche Reihenfolge von Derivationsmorphemen:
(26) a. Entscheid-bar-keit, *Entscheid-keit-bar
b. les-bar, *bar-les
Beschränkungen auf mögliche Kombinationen von Morphemen in derivationeller Morphologie:
(27) a. les-bar, ess-bar, spiel-bar, erklär-bar
b. *lach-bar, *schwimm-bar, *wart-bar, *einschlaf-bar
(28) a. Jemand kann das Buch lesen ² Das Buch ist lesbar
b. Peter kann schwimmen ² *Peter ist schwimmbar
c. Peter kann sicher 5min warten ² *Peter ist sicher 5min wartbar
3.2. UNIVERSALE DESIGNMERKMALE NATÜRLICHER SPRACHEN
Hockett (1960, 1963) identifizierte insgesamt sechzehn allgemeine Designmerkmale von
menschlicher Sprache.8 Zu diesen auch absoluten Universalien genannten Eigenschaften zählen
die Generalisierungen in (28). Beispiele für Designmerkmal (28)l wurden bereits im 2.2.
besprochen. Da sich diese Merkmale in allen Sprachen zeigen, müssen sie angeboren sein, also
auf einer gemeinsamen biologischen Basis fundieren.
8
(28)c, (28)g und (28)h und (28)l stammen nicht von Hockett selbst.11 DGB 41 Spracherwerb, SoSe 2021
(29) Designmerkmale menschlicher Sprache (teils adaptiert aus Hockett 1960)
a. Modalität: Gesprochene Sprachen werden im Vokaltrakt produziert und mittels
Schallwellen übertragen. (Keine Sprache verwendet sprachliche Laute, die mit dem
Bauch, den Füssen oder dem Ellenbogen produziert werden.)
b. Lernbarkeit: Alle Sprachen können im Laufe des Erstspracherwerbs als
Muttersprache erlernt werden.
c. Kritische Periode: Sprache kann nur in der kritischen Periode (ca. 0 - 5 Jahre) als
Muttersprache erworben werden.
d. Alle Sprachen besitzen eine Unterscheidung zwischen Vokalen und Konsonanten.
e. Diskretheit: Sprachen besitzen diskrete (–atomare) Einheiten, die vom Sprachsystem
manipuliert werden. Dazu zählen Phoneme, Morpheme und syntaktische Phrasen.
f. Arbirarität: die Bedeutung eines Morphems ist nicht systematisch aus der Form
ableitbar.
g. Produktivität: Jede Sprache besteht aus einer potentiell unendlichen Menge von
Sätzen.
h. Rekursivität: Menschliche Sprach ist rekursiv (s.u.)
i. Kompositionalität: Die Bedeutung komplexer Ausdrücke kann systematisch aus der
Bedeutung der Teile abgeleitet werden (s.u.)
j. Referenz auf nichtvorhandene Objekte: Alle Sprachen haben die Fähigkeit, sich auf
Entitäten zu beziehen, die nicht physisch präsent sind (z.B.: Maria hätte gerne das
gestrige Spiel gesehen.)
k. Reflexivität: Es ist möglich, mit Sprache über Sprache zu sprechen. (Dieser Satz hat
fünf Worte.)
l. Fehlen der Kleene-Eigenschaft: Jede Sprache besitzt Beschränkungen. Keine Sprache
erlaubt alle möglichen Kombinationen von Symbolen (s.u; nicht von Hockett)
Rekursion ist eine Eigenschaft von Regeln. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Rekursion
und Iteration.
(30) Rekursion
Eine Regel ist rekursiv, wenn der Output wieder als Input der Regel dient.
Beispiel: Teilen der βασιλόπιτα in zuerst 2, dann 4, dann 8, dann 16, etc... Stücke
(31) a. Der Mann, der den Hund, der den Knochen gegessen hat, gesehen hat, kam zurück
b. weil Peter seinen Nachbarn den Hund Kunstücke machen lassen sehen will
c. weil ein Lehrer das verstehen können wollen muss
Regeln: IP ÿ VP NP
VP ÿ IP V
(32) Iteration
Eine Regel ist iterativ, wenn sie mehr als einmal auf einen Ausdruck angewendet wird
Beispiel: Zum Tisch gehen, ein Stück βασιλόπιτα nehmen, und es jemandem geben.
Diese Handlung so oft wiederholt werden, wie es Kuchenstücke gibt.
(33) Peter sagt, dass Fritz glaubt, dass Maria hofft, dass Peter sagen wird,.... dass er kommt.#1: Grundlagen 12
Hinweis: Jede Iteration kann als Rekursion ausgedrückt werden, aber nicht umgekehrt. (32) kann
daher als Iteration oder als Rekursion behandelt werden. Die Beispiele von Zentraleinbettung in
(30) lassen sich dagegen nur als Rekursion analysieren (Hinweis zu einer Erklärung: in (30)
entspricht die Anzahl der Subjekte genau der Anzahl der Prädikate. (30) besitzt also die
allgemeine Form an bn , wobei an für die Anzahl der Subjekte und bn für die Anzahl der Prädikate
steht. Eine Regel, die (30) generiert, muss sich also merken, wie viele Subjekte es gibt, und wie
viele Prädikate. Oder, anders ausgedrückt, sie muss sich merken, wie oft sie angewendet worden
ist. Dies ist ein Kennzeichen von Rekursion.)
Kleene-Eigenschaft. Eine Sprache besitzt die Kleene-Eigenschaft, wenn sie mit Hilfe des
Kleene-Sterns beschreibar ist:
(34) Kleene-Stern
Für jede Menge A: A* ist die Menge der Ausdrücke, die aus beliebiger Kombination der
Elemente von A gebildet werden können
Beispiel: A = {do, re}
A* = {do, re, dodo, dododo, ... rere, rerere,... dore, redo, dodore, reredo,...}
4. SPRACHSYSTEM VS. TIERKOMMUNIKATION
Im Tierreicht gibt es generell zwei Arten von Kommunikationssystemen:
(35) a. Einfach in Form, und die Signale besitzen Bedeutung (Lockrufe, chemische Signale
bei Insekten,...)
b. Relativ komplex, aber ohne erkennbare Bedeutung (Vogelgesang, Walgesang)
Tierkommunikation unterscheidet sich fundamental, und nicht nur graduell/quantitiv von
natürlicher Sprache: Tierkommunikation fehlt u.a. die Eigenschaft der Produktivität und
Rekursivivtät, die Systeme sind daher auch weniger komplex.
Eine wichtige Frage in der Biologie ist: Warum hat sich Sprache nur beim Menschen
entwickelt? Folgende Antworten sind im Prinzip möglich, jedoch nicht
(36) Warum hat sich Sprache nur beim Menschen entwickelt?
a. Da Menschen ein größeres Gehirn besitzen?
Nein: Gehirn von Elefant (5kg) und Walen (Pottwal: > 9kg) ist größer als Gehirn
des Menschen (1,5kg)
b. Aufgrund der höheren Intelligenz?
i. Nein: Williams Syndrom (niedrige Intelligenz, normale Sprachentwicklung)
ii. Nein: Special Language Impairment (normale Intelligenz, gestörte
Sprachentwicklung), Broca Aphasie
c. Aufgrund der besonderen Anatomie der peripheralen Produktions/Perzeptionsorgane
beim Menschen?
i. Nein: Sprache ist multimodal, kann z.B. auch mit Händen ausgedrückt werden
(Gebärdensprache)
ii. Nein: Bestimme Tiere besitzen ähnliche Anatomie wie der Mensch (abgesenkte
Larynx; Rothirsch, Damhirsch), sprechen jedoch nicht.13 DGB 41 Spracherwerb, SoSe 2021
d. Da nur der Mensch abstrakt denken kann?
Nein: Primaten9 und Vögel (Raben) verwenden Instrumente, und besitzen
(rudimentäre) Theory of Mind (s.u.). Beides weist auf Vorhandensein von
abstrakten Repräsentationen hin.
L e. Generelles Interesse an der Umwelt (Natural Pedagogy; Csibra und Gergely 2009)
Der Mensch besitzt den Drang, das Verhalten anderer zu imitieren sowie mit anderen
zu kommunizieren. Primaten fehlt dieses allgemeine Interesse an der Umwelt.
Theory of Mind. Unter Theory of Mind (ToM) versteht man die Fähigkeit, die mentalen
Repräsentationen (Gedanken) eines anderen Individuums nachvollziehen zu können, um sich in
ein anderes Individuums ‘hineinzuversetzen’.10 ToM entwickelt sich ab dem 3. bis 5. Lebensjahr,
und stellt eine Voraussetzung dar, um das Verhaltens anderer richtig interpretieren zu können.
Nur durch ToM kann man verstehen, dass andere Leute die Welt anders interpretieren als man
selbst. ToM ist daher auch für alle Arten von kooperativen Tätigkeiten, wie z.B. Ackerbau,
gemeinsames Jagen, Bauen eines Hauses, etc... notwendig.
Ob ein Kind bereits ToM verfügt oder nicht kann experimentell nachgewiesen werden. Ein
klassisches Beispiel für einen ToM-Test sind sogenannte False Belief Aufgaben:
(37) Szenario: Das Kind beobachtet zwei Puppen, Anna und Maria. Anna legt ein Spielzeug
in einen Korb und geht aus dem Zimmer. Maria nimmt das Spielzeug, und versteckt es
im Bett. Anna kommt zurück ins Zimmer.
Frage an das Kind: Wo wird Anna das Spielzeug suchen?
Die ‘richtige’ Antwort ist natürlich: im Korb. im Kinder bis zum 4. Lebensjahr antworten jedoch
systematisch mit: “Anna wird im Bett suchen”, da sie noch nicht in der Lage sind, die mentalen
Repräsentationen von Anna nachzubilden - sie verfügen noch über keine ToM.
Sprache als Instinkt? Pinker (1994) schlägt vor, Sprache als einen Instinkt (Trieb, Reflex) zu
interpretiern, ähnlich wie der Fluchtreflex bei Gefahr, der Instinkt zur Nahrungssuche, Brupflege,
oder der Sexualtrieb.
(38) Probleme für Instinkttheorie (kontra Pinker 1994)
a. Instinkt entwickelt sich auch ohne spezifischen Input
b. Instinkte sind weniger komplex: nicht produktiv/rekursiv
c. Phylogenetische Kontinuität: Instinkte des Menschen auch bei Primaten
[d. Keine Variation innerhalb einer Spezies (aber: Interne vs. externe Grammatik)]
9
Zu den Primaten oder Menschenaffen zählen Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang Gutans.
Schimpansen sind genetisch mit Homo sapiens näher verwandt, als mit anderen Primaten.
10
Für kurze Übersicht siehe
http://www.psy.lmu.de/epp/studium_lehre/lehrmaterialien/lehrmaterial_ss10/wintersemester1011/leh
rmat_kristen/seminar1kristen16/tom_teil1.pdf#1: Grundlagen 14
BIBLIOGRAPHIE
Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht, The Netherlands:
Foris Publications.
Chomsky, Noam. 1986. Knowledge of Language. New York, New York: Praeger Publishers.
Csibra, Gergely und György Gergely. 2009. Natural pedagogy. Trends in Cognitive Science
13.4: 148-153.
Edelman, Gerald. 1987. Neural Darwinism. New York: Basic Books.
Fitch, Tecumseh. 2010. The Evolution of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/GS347/Fitch%202010%20evolution%2
0of%20language.pdf
Hauser, Marc. 1996. The evolution of communication. Cambridge, MA: MIT Press.
Hockett, Charles. 1960. The origin of speech. In Wang, W.S-Y. (ed.). Human
Communication: Language and its Psychobiological Bases, Scientific American, 1982
(Paper originally published in Scientific American Scientific American 203: 89–96.)
Marler, Peter 1997. Three models of song learning: evidence from behavior. Journal of
Neurbiology 33.5: 501-516. Download:
http://www.people.fas.harvard.edu/~fs39x/readings/marler-3models.pdf
Meisel, Jürgen (Hg.). 1994. Bilingual First Language Acquisition. Amsterdam: John
Benjamins.
Pinker, Stephen. 1994. The Language Instinct. Harper Perennial Modern Classics. Reprint
edition (September 4, 2007).
Travis, Lisa. 1984. Parameters and Effects of Word Order Variation. Doctoral Dissertation,
Massachusetts Institute of Technology.
Ross, John. 1967. Constraints on Variables in Syntax. Doctoral Dissertation, Massachusetts
Institute of Technology.Sie können auch lesen