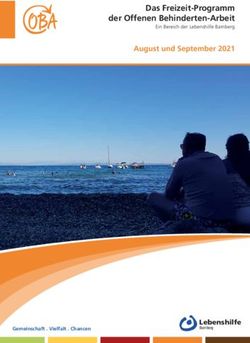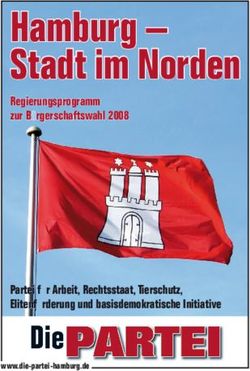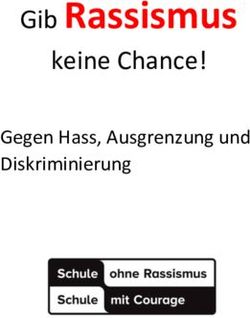Festhaltende Genauigkeit - Die Theaterphotographie der Maria Steinfeldt - Theater der Zeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Festhaltende Genauigkeit Die Theaterphotographie der Maria Steinfeldt von Friedrich Dieckmann Das Bild des Theaters, wie es Maria Steinfeldt in vier Jahrzehnten in Berlin-Mitte, dort vor allem, in vielerlei Gestalt festgehalten hat – wo ist es, außer in diesem Buch und in Zeitschriften und Büchern jener Zeit, zu finden? Ich gehe in das Archiv der Akademie der Künste und werde von Stephan Dörschel, dem Chef der Abteilung Darstellende Kunst, freundlich aufgenommen; in seinem Dienstzimmer sehe ich Raritäten einer älteren Epoche an der Wand: Porträtgemälde Maria Wimmers von der Hand Caspar Nehers. Dann geht es über weitläufige Treppen und Gänge, an Tür und Wand werden Sicherheitshebel heruntergedrückt, eine stählerne Pforte bewegt sich, die Schatzkammer steht mir offen – nimmt die Darstellende Kunst hier den größten Raum ein? Stephan Dörschel erklärt mir die ingeniöse Vorkehrung, die es erübrigt, daß im Brandfall mit Wasser gelöscht werden müßte; im Falle eines Falles löscht man mit Gas, mit Stickstoff, der, eingeleitet, den Sauerstoff verdrängen und die Flammen ersticken würde. Das ist zu Anfang des Jahrhunderts hier installiert worden, die alte Zeit baute das Haus (es gilt als der einzige Archiv-Neubau der DDR), die neue vervollkommnete es. Die Verschiebbarkeit der Regalwände gegeneinander führt zu maximaler Raumausnutzung, man kann sich den Platz vor den Regalen jeweils freidrehen; so gelange ich vor jenes beidseitig bestückte Regal, das in seiner ganzen Tiefe – es sind etwa 7 m – mit schwarzen, wohlbezeichneten Kästen belegt ist. Renate Rätz, die spezielle Schatzhüterin, öffnet einige von ihnen und zieht graue Mappen hervor, die Negative, Kontaktabzüge, Originalfotos enthalten – das Bildmaterial, das Maria Steinfeldt in fünf Jahrzehnten von der Arbeit der Regisseure gefertigt, bezeichnet, gesammelt hat, die sich für sie und für die sie sich interessierte: Ruth Berghaus vor allem und Heiner Müller, die Regieteams Manfred Wekwerth/Joachim Tenschert und Manfred Karge/Matthias Langhoff, sodann die Jüngeren: B. K. Tragelehn und Einar Schleef, in jüngerer Zeit vor allem Peter Konwitschny.
Auch Benno Besson, Adolf Dresen und Friedo Solter, mit einzelnen Regiearbeiten Wolfgang Heinz, Karl von
Appen, Peter Kupke und Ekkehard Schall, die Opernregisseure Walter Felsenstein, Christian Pöppelreiter, Horst Bonnet und Doris Dörrie und viele andere mehr, darunter Uta Birnbaum, Arila Siegert, Heinz-Uwe Haus und das Regieteam Peter Kleinert/Peter Schroth, sind hier vertreten. Maria Steinfeldt hat in Berlin am TiP (Theater im Palast) und am BAT, am Theater 89 und am Theater der Freundschaft alias carrousel, an der Staatsoper, der Komischen Oper und am Metropoltheater photographiert. Aber die meisten derer, mit denen sie zusammenarbeitete, kamen aus dem Umkreis des Berliner Ensembles – ein Zufall? Kein Zufall war es, daß sie sich 1962 die BE-Aufführung von Brechts Die Tage der Commune als Thema ihrer Diplomarbeit erkor. Die 27jährige Studentin an der Leipziger Hochschule für Graphik und Buchkunst kam aus der Kleinstadt Gnoien im Norden der Mecklenburgischen Schweiz, nicht gerade einer Theatergegend. Der Vierzehnjährigen hatte eine Schwester aus West-Berlin eine Box mitgebracht, den einfachsten Fotoapparat, den man sich vorstellen konnte. Das Gerät half ihr die Krankheit überstehen, die sie zu dieser Zeit packte, eine Tuberkulose, gegen die es damals noch keine Medikamente gab. Man mußte sie in Sanatorien ausliegen, das dauerte in ihrem Fall drei Jahre – eine Zeit der Gefährdung, der Isolation, der Teilnahme am Leid anderer. In dieser Zeit reifte der Eigenwille der jungen Mecklenburgerin, die nach ihrer Genesung in eine Fotowerkstatt eintrat, ohne sich mit den Aussichten zu begnügen, die der Abschluß der Lehre bot. An der Arbeiter- und Bauernfakultät in Rostock machte sie das Abitur, um sich an der Leipziger Hochschule bewerben zu können, zu der auch eine Fotoklasse gehörte, und merkte nach der siebentägigen Aufnahmeprüfung, daß es dessen eigentlich nicht bedurft hätte. Sie wurde angenommen, bekam es mit wechselnden Lehrkräften zu tun und fand Kontakt zu Helga Wallmüller, der Hausphotographin der Leipziger Theater, einer renommierten Lichtbildnerin, die zehn Jahre zuvor den Übergang von Stand- zu Probenfotos vollzogen hatte und die Schaukästen der drei Bühnen mit Impressionen füllte, deren Bestreben es war, in der Großaufnahme der Akteure das Wesen einer Aufführung bildhaft zu pointieren. Der Eigensinn der wortkargen Elevin zeigte sich daran, daß sie sich dafür überhaupt nicht interessierte. Wie sollte man, fragte sie sich, das Wesen einer Aufführung in Nahoder Halbnah-Aufnahmen einzelner Schauspieler erfassen können? Sie bekam Brechts Theaterarbeit in die Hand, den großen Text-Bild-Band von 1952; was dort mit der Signatur rb. (Ruth Berlau) auf fünf Seiten über Theaterphotographie1 stand, wurde zum Leitbild ihrer Arbeit, die nicht auf Pressefotos und Schaukästen beschränkt sein wollte, sondern darauf zielte, in den Prozeß der Inszenierung einbezogen zu werden. „Wir benutzten oft unsere Fotos“, hatte Ruth Berlau geschrieben, „die Arrangements auf Sinn und Schönheit nachzuprüfen. Auf den Bildern kann nicht das Wort oder der Schwung über die Dürftigkeit des Anblicks hinwegtäuschen. Weder des Schauspielers Spiel noch die Spannung auf den Fortgang der Handlung machen den Betrachter der Bilder die Einzelheiten übersehen: die hingeschlampte kleine Szene im Hintergrund, den lieblos gemachten, nichtssagenden Stuhl. Selbst der Regisseur übersieht auf der Probe, folgend dem Darsteller, der die Szene führt, einen andern, der nichts zu ihr beiträgt. Oft genügt es, wenn man einem Darsteller ein Bild zeigt, damit er einen Fehler korrigieren kann.“2 Hilfestellung beim Probenprozeß, das war das eine. Das andere: Überlieferung des Ergebnisses und der Wege und Umwege, die zu ihm geführt hatten, mithin: eine ganz neue Basis für die Theatergeschichtsschreibung. „Das Theater“, endete Berlaus Text, „würde viel gewinnen, wenn es damit rechnen könnte und müßte, daß seine Darbietungen im Bild festgehalten werden. Die Schauspieler würden neuen Spaß an wahrheitsgetreuen und bedeutenden Gestaltungen gewinnen, wissend, daß spätere Zeiten von ihrem Wissen und Wirken erfahren würden.“3 Es war Brecht und seinen Mitstreitern um nichts Geringeres gegangen als um die Grundlegung einer neuen Schwesterkunst des Theaters, vergleichbar derjenigen, die die graphische Kultur Japans und Chinas in Gestalt zahlreicher Schauspieler- und Szenendarstellungen hervorgebracht hatte. Doch auch das deutsche Theater hatte in seinen Blütezeiten dergleichen gekannt; aus dem ersten Jahrzehnt der Zauberflöte gibt es graphische Szenenfolgen, deren Bezug auf Theateraufführungen offenkundig ist.4 Die Aufgabe, dies mit den Mitteln der Photographie auf unmittelbar dokumentarische Weise zu leisten, war im 20. Jahrhundert nur punktuell angegangen worden; jeder bemerkt es, der in Archiven deutscher Theater nach Bildmaterial fahndet und nur ganz vereinzelt auf Bildfolgen stößt, die einen Eindruck von der szenischen Gesamtkomposition geben. Diese Abstinenz mochte, außer mit dem Fehlen festangestellter Hausphotographen, auch mit der mangelnden Lichtempfindlichkeit der Filme zusammenhängen. Die Grobkörnigkeit hochempfindlicher Filme nicht als Hindernis, sondern als einen Reiz anzusehen war eine ausdrücklicher Mahnung Ruth Berlaus in Theaterarbeit. Maria Steinfeldt las dort die Seiten über Theaterphotographie und über die Anfertigung von „Modellbüchern“, also die Anordnung von Aufführungsfotos zu textuntersetzten Szenenfolgen, und begab sich an den Ursprung dieser grundstürzenden Neuerungen, an das Berliner Ensemble, um dort Manfred Wekwerths und Joachim Tenscherts Inszenierung der Tage der Commune schon im Probenprozeß aufzunehmen, der ein volles Jahr in Anspruch nahm. Wo sind alle diese Aufnahmen geblieben, im Archiv Helga Wallmüllers oder in dem der Leipziger Hochschule? Die Mentorin konnte bemerken, daß hier jemand auf ganz andern Wegen wandelte als sie selbst. Der Studentin war etwas gelungen, was die Ökonomie des regierenden Sozialismus vergebens einforderte: Überholen ohne einzuholen. Bewarb sich die Leipziger Diplomandin damals an anderen Theatern? Sie bemerkte, daß sie mit dem, was
sie wollte, nicht ihren Lebensunterhalt verdienen könne und lebte als freischaffende Photographin von ganz andern Aufgaben, von Porträt-, Ausstellungs- und Sachaufnahmen aller Art. Auch in späteren Jahren hat sie die Porträtphotographie nicht außer Acht gelassen und bei Gelegenheiten, die sie interessierten, ihre Practica gezückt, bei Vorträgen, Lesungen, Geburtstagsfeiern und Preisverleihungen derer, die sie kannte und schätzte. Die Spanne reicht von Therese Giehse bis zu Curt Bois, von Stefan Heym bis zu Helene Weigel, von Loriot bis zu Peter Hacks. Ihre Stunde als Theaterphotographin schlug, als Ruth Berghaus 1965 im Berliner Theaterleben Fuß faßte: mit Dessaus und Brechts Oper Die Verurteilung des Lukullus an der Deutschen Staatsoper und dem Lehrstück vom Ja- und vom Neinsager am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Beide Inszenierungen nahm Maria Steinfeldt auf, es folgte die Uraufführung von Paul Dessaus Puntila-Oper an der Lindenoper ein Jahr später; zwischen der Regisseurin und der Photographin bahnte sich ein Arbeitsverbund an, der auf einer besonderen Gleichgestimmtheit beruhte. Was sie verband, war die Lust am pointierten Bild und der Hang zu dem, was die einen ordentliche Arbeit und die weniger Ordentlichen Perfektion nennen, dazu eine Art von Sprödigkeit, die der tiefen Unlust an jeder Selbstdarstellung über die Arbeit hinaus entsprang. Maria Steinfeldt, schrieb ich 2002 zu einer Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste, war von der Regisseurin „als eine Photographin erkannt worden, die den genauen Blick auf die Bühne, die Sensibilität für den richtigen Bildmoment, für die Drehpunkte, wie Brecht es nannte, mit größter technischer Professionalität verband, eine Haltung, in der Sachlichkeit, Empfindung, Distanz, das Zurücktreten hinter der mit großem Engagement betriebenen Arbeit sich ähnlich verbanden wie bei ihr selbst. So wurde Maria Steinfeldt zu mehr als nur zu einer Bildreporterin dieses an Reichweite und Souveränität wachsenden Theater-OEuvres; sie wurde zu einer Mitarbeiterin, die sich immer schon in die Proben setzte, um ein Gefühl für die entstehende Arbeit zu bekommen, und deren visuelle Bestandsaufnahme – auf den Proben und danach – oft zur Basis für die Weiterarbeit wurde.“5 Nur freischaffend, unter eingeschränkten materiellen Bedingungen, konnte die Photographin ihrer Neigung folgen, mit dem Ernst zu machen, was Brecht und Berlau an Anforderungen formuliert hatten. Als Ruth Berghaus 1972 die Nachfolge Helene Weigels als Intendantin des Berliner Ensembles antrat, ergab sich keine Möglichkeit der Anstellung an diesem Theater, das in dem Ostpreußen Percy Paukschta einen Hausphotographen besaß, der ihr nach Können und Haltung nahekam. Paukschta arbeitete seit Jahrzehnten auf der von Brecht vorgezeichneten Linie und nahm die Inszenierungen des Theaters aus der Totale mit großer Akribie modellbuchhaft auf, ergänzt von Vera Tenschert, einer jüngeren Lichtbildnerin, die als Frau des Chefdramaturgen auch zahlreiche Porträtgelegenheiten wahrnahm. Wohin sonst hätte Maria Steinfeldt gehen sollen? Als Freischaffende nahm sie sich die Zeit, die sie brauchte, um „von dem eigenen Erleben bis zu den fertigen Bildern zu kommen“ (Interview mit Thomas Irmer in diesem Band), die oft mit Nachtschichten verbunden waren. Als hilfreich erwiesen sich die Aufträge des Theaterverbands der DDR, der sie manchmal mit kompletten Inszenierungsdokumentationen betraute. Der Ruf, den sie sich durch die Sorgfalt und Fühlsamkeit ihrer Arbeit erworben hatte, trug dazu bei, ihr andere Regisseure zuzuführen, die auf präzise Dokumentationen Wert legten, am Deutschen Theater wie an der Volksbühne, an der Staats- und an der Komischen Oper. Ihr Interesse daran, das Gesamtbild der Bühne in der Wechselwirkung von Portal, Bühnenbild und bewegter Szene zu überliefern, ein Ganzes in Einzelaufnahmen, die jede für sich ein Bildganzes vorstellten, sicherte ihr die Zuneigung der Bühnenbildner, besonders derer, die von Brecht oder dessen Schülern darauf gebracht worden waren, mit Arrangementskizzen der Regiearbeit vorzuarbeiten. Standen solche Entwürfe am Anfang der Arbeit, so konnte man bei Maria Steinfeldt sehen, was am Ende dabei herausgekommen war. Ich selbst wurde auf Maria Steinfeldt aufmerksam, als ich in den sechziger Jahren an einem Buch über die Theaterarbeit Karl von Appens am Berliner Ensemble arbeitete; intensiv wurde unsere Zusammenarbeit im Vorfeld der II. Prager Quadriennale, einer Weltausstellung des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur, an deren DDR-Beitrag ich dispositiv beteiligt war. In der ihn begleitenden Bildbroschüre stammten zwei Drittel der Aufnahmen von Maria Steinfeldt; zahlreiche Szenenfotos, eine Neuerung im internationalen Rahmen, hingen dann an den Stellwänden. Die Prager Jury würdigte das Ganze mit der Goldenen Triga. Einar Schleef trat dort mit einer furiosen studentischen Abschlußarbeit zum ersten Mal ins Rampenlicht; vier Jahre später, auf der III. Prager Quadriennale, war der Einunddreißigjährige mit vier Aufführungen vertreten, drei davon mit dem Regisseur B. K. Tragelehn. Beide hatten sich bei ihrer Arbeit der diskreten Kunst der Maria Steinfeldt versichert, in ihrer Doppelrolle als Dokumentaristin des Probenprozesses und des Endergebnisses. Peter Konwitschny tat später ein Gleiches, und auch er tat gut daran. Alle Regisseure, die sie als Photographin gewannen, konnten sich glücklich schätzen: Ihre Arbeiten, ihr OEuvre sind auf diesem Weg besser, genauer, nachvollziehbarer überliefert als die der meisten andern. Aber ist das Videoband, die DVD-Scheibe nicht inzwischen die anschaulichere Form der Dokumentation? Schon Walter Felsenstein hatte seine wichtigsten Inszenierungen in Filme umgesetzt, die allerdings mit riesigem Aufwand verbunden gewesen waren. War Brechts Konzept der inszenatorischen Gesamtaufnahme als dichte, aber statisch-diskrete Folge von Einzelaufnahmen nicht eine Übergangserscheinung auf dem Weg zu der auf einmal eröffneten Möglichkeit, ohne allzu große Umstände das kinetisch-kontinuierliche
Gesamtbild einer Aufführung aufzunehmen? Über die mangelnde Tauglichkeit des Videos, im Probenprozeß, aber auch bei Wiederaufführungen Einzelheiten zu überprüfen und wiederherzustellen, hat die Photographin sich in ihrem Gespräch mit Thomas Irmer geäußert (S. 16). Ein anderes kommt hinzu: Es ist der permanente Wechsel der Kameraeinstellungen zwischen Nah, Halbnah und manchmal auch der Totale, was die Kompetenz solcher Abfilmungen mindert. Sie sind oft so effekthascherisch gemacht wie die meisten Konzertübertragungen, die dem Gesichtsausdruck des blasenden Posaunisten, der nicht eben viel zum Verständnis der Musik beiträgt, ein größeres Gewicht geben als den sprechenden Gebärden des Dirigenten, der nur sporadisch ins Blickfeld gerät. Die Fehlorientierung des auf rasche, zerstreuende Bildwechsel gedrillten Normalfernsehens belastet auch viele Theaterabfilmungen, mit Ausnahmen, die nur dort eintreten, wo der Regisseur Einfluß auf die Kameraführung nehmen kann. Auch von daher sind die steinfeldtschen Bildfolgen kein Ersatz für fehlende Videos, sondern ein fesselndes Instrument, eine Aufführung mit bildkünstlerischer Kompetenz als ein Ganzes zu erfahren, das aus vielen einzelnen Ganzheiten besteht. Es war dieser den Betrachter herausfordernde Widerspruch, den Brecht als dialektisch, also als fruchtbar, empfunden und herausgefordert hatte. In einem Zeitalter, da viele Regisseure an genau erarbeiteten Bildwirkungen nicht mehr interessiert sind, schrumpft das Feld für die Art von Theaterphotographie, die Maria Steinfeldt zeitlebens betrieben hat. Wo sich die Kunst nicht mehr ernst nimmt, hat Überlieferung ihr Recht verloren. So wird das photographische OEuvre der Steinfeldt zu dem Merkmal einer Epoche, in der die Suche nach der standhaltenden Form nicht als Einschränkung individueller Freiheit, sondern als deren Erfüllung galt und Sachlichkeit nicht als Selbstverleugnung, sondern als Voraussetzung der Dauer. Maria Steinfeldts Arbeit erzählt von einem Zeitalter, da das Theater noch an das Bild glaubte. Wenn es diesen Glauben, dieses Bedürfnis eines Tages wiedergewinnt, wird man sich erstaunt und begeistert über den Inhalt der vielen schwarzen Kästen beugen. Schon heute erhalten sie die Erinnerung an eine Zeit aufrecht, als sich auf engem Raum eine Fülle von Talenten drängte, denen Brecht den Weg zu einem neuen Einklang des Schönen und des Wahren, von Esprit und Sentiment gewiesen hatte, aus der untilgbaren Hoffnung auf eine Vermenschlichung des Menschen und seiner Umstände. 1 Das Wort ist dort mit zwiefachem f geschrieben, was inzwischen orthographisch zugelassen sowie beliebt und bequem, aber nicht sinnvoll ist, wenn man in Worten wie Theater, Phantasie oder Philosophie die griechische Herkunft der Worte mit dem eingeschobenen h vernünftigerweise immer noch signalisiert. Anders steht es mit dem Kurzwort Foto, das als deutsches Lehnwort gelten kann. (F. D.) 2 Berliner Ensemble/Helene Weigel (Hrsg.): Theaterarbeit, Dresden 1952, S. 343. 3 Ebd., S. 345. 4 Vgl. Friedrich Dieckmann (Hrsg.): Die Zauberflöte, Berlin 1984, S. 182 – 207. 5 Friedrich Dieckmann: „Berghaus meets Steinfeldt / Die Landschaft der Erinnerung“, in: Sinn und Form, Heft 1/2003, S. 130. Quelle: https://www.theaterderzeit.de/buch/maria_steinfeldt._das_bild_des_theaters/32438/komplett/ Abgerufen am: 07.01.2021
Sie können auch lesen