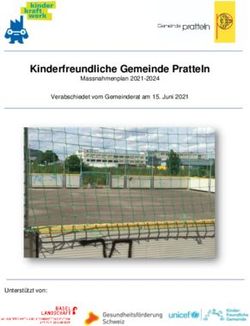Fokus Gesundheit Kinder und Jugendliche stärken! Wege zur Förderung der psychischen Gesundheit - ZHAW
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fokus Gesundheit Kinder und Jugendliche stärken! Wege zur Förderung der psychischen Gesundheit Prof. Dr. Frank Wieber St. Leiter Forschung Institut für Gesundheitswissenschaften 21. Oktober 2021 ZHAW – Department Gesundheit – Haus Adeline Favre – Winterthur 1 Zürcher Fachhochschule
Psychische Gesundheit und
psychische Erkrankung als 2 Kontinua Modell
(nach Keyes)
• Die psychische Gesundheit kann unabhängig vom Ausmass
psychischer Erkrankungen gefördert werden.
• Auch psychisch kranke Personen können eine gute psychische Gesundheit erreichen.
Zürcher Fachhochschule
5WIE GEHT ES DEN KINDERN UND
JUGENDLICHEN IN DER SCHWEIZ IN
BEZUG AUF IHRE PSYCHISCHE
GESUNDHEIT?
Zürcher Fachhochschule
6Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen (basierend auf klinischen Diagnosen) • Im Kindesalter geht man global von 10 bis 20% Betroffenen aus (Kieling et al., 2011) • Viele psychische Störungen treten schon früh im Leben auf. (Kieling et al., 2011) • Unbehandelte psychische Störungen können langfristige Folgen für Kinder und Jugendliche haben, wie eingeschränkte schulische Entwicklung und Schulmisserfolge (Schulte-Körne, 2016) Zürcher Fachhochschule 7
Psychische Störungen bei Jugendlichen
(basierend auf klinischen Diagnosen)
• Rund 13 % der 14- bis 17-jährigen Jugendlichen in der Schweiz haben
im Zeitraum von 6 Monaten an einer psychischen Störung gelitten
(Steinhausen, 1994)
• Ähnlich zu den international 13.4 % für die vier grössten
psychiatrischen Störungsgruppen (Vergleich über 41 Studien aus 27
unterschiedlichen Ländern; Polanczyk et al., 2015)
JedeR 10. Jugendliche hat eine klinisch diagnostizierte psychische
Störung
Zürcher Fachhochschule
8Häufigste Krankheitsbilder
• Depression
• Angst
• ADHS
Weitere psychische Störungen
• Essstörungen
• Suchterkrankungen
• Schizophrenie
Zürcher Fachhochschule
9Psychischer Gesundheit bei
Jugendlichen/jungen Erwachsenen
(basierend auf Screening Fragebögen)
Swiss Youth Epidemiological Study on Mental Health (S-YESMH)
- 3’840 Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren
- 33% der jungen Frauen und 20% der jungen Männer zeigten in 2018
Hinweise für eine der drei psychischen Störungen Depression, Angst
oder ADHS
- 50% dieser Personen erachtete eine therapeutische Behandlung als
nicht notwendig
- 66% dieser Personen haben noch nie professionelle Hilfe in Anspruch
genommen
- Mögliche Gründe:
- unzureichende Kenntnisse von klinischen Symptomen sein
- Unvermögen, sich in therapeutische Behandlung zu begeben
(Mohler-Kuo et al., 2021; Werlen et al., 2020).
Zürcher Fachhochschule
10COVID-19 Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
(basierend auf Screening-Fragebögen)
- Jüngere Personen psychisch mehr belastet als ältere (z. B. de
Quervain et al., 2020a und 2020b)
- 35.2% der 12- bis 17-Jährigen wurden positiv auf eine psychische
Erkrankung gescreent (Mohler-Kuo et al., 2021)
- 20.2% der Studierenden berichteten moderate bis schwere Angst-
Symptome in der 1. Welle der Pandemie (Amendola et al., 2021,
Dratva et al., 2020)
- 30.1 % weist eine problematische Internetnutzung auf dies wird auch
von anderen Studien bestätigt (Werling et al., 2021)
- Deutlicher Anstieg der Fallzahlen in Notfallambulanzen der Kinder- und
Jugendpsychiatrie während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020
und noch deutlicher ab Herbst 2020 bis ins Frühjahr 2021 (Werling et
al., 2021)
Zürcher Fachhochschule
11Beispiel für einen Screening-Fragebogen
Stärken und Schwächen (SDQ) - Version für Eltern 4-17-Jähriger
(Youth in Mind, 2021)
Zürcher Fachhochschule
12Ergebnisse zu psychischen Belastungen bei Jugendlichen
Wiederholte bez. chronische psychoaffektive Beschwerden bei
15-Jährigen
Anteil Jugendliche (in Prozent) mit Beschwerden
(mehrmals wöchentlich oder täglich in den letzten sechs Monaten)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002 2006 2010 2014 2018
Traurigkeit Nervosität
schlechte Laune / Gereiztheit Ängstlichkeit / Besorgnis
Verärgerung / Wut Müdigkeit
Einschlafschwierigkeiten Quelle: Sucht Schweiz - Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
Überall höhere Werte für Mädchen als für Jungen (Ambord et al., 2020)
Zürcher FachhochschuleErgebnisse zu psychischen Belastungen bei Jugendlichen
HBSC – Wohlbefinden und allg. Gesundheitszustand (Ambord et al., 2020)
Fragen zur Lebenszufriedenheit
Die Mehrheit der 11- bis 15-Jährigen fühlt sich 2018 gut:
– 83.6 % der Mädchen
– 90.7 % der Jungen
• Die Werte sind stabil (über fünf Erhebungen im Zeitraum 2005 bis 2018)
• Lebenszufriedenheit bei den 12- bis 15-Jährigen stets etwas tiefer als bei
den 11-Jährigen
Fragen zum allgemeinen Gesundheitszustand
Die Mehrheit der 11-bis 15-Jährigen gibt 2018 einen (sehr) guten
Gesundheitszustand an:
– Leicht unter 90 % der Mädchen
– Leicht über 90 % der Jungen
Zürcher Fachhochschule
14Gibt es angesichts der Ergebnisse Handlungs-
bedarf zur Förderung der psychischen
Gesundheit bei Jugendlichen?
• JA.
• Die WHO empfiehlt allen Ländern die
Einführung von Programmen zur
Förderung der psychischen
Gesundheit von Jugendlichen,
• Die Evidenz auf Grundlage qualitativ
hochstehender Studien ist zwar noch
nicht sehr breit abgestützt, aber der
wahrscheinliche Nutzen ist gross und
das Risiko unerwünschter
Nebenwirkung sehr klein
https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-mental-health-promotive-and-preventive-interventions-for-adolescents
Zürcher Fachhochschule
15WIE KANN DIE PSYCHISCHE
GESUNDHEIT GESTÄRKT WERDEN?
Zürcher Fachhochschule
16Wichtig neben der Förderung - Früherkennung
• Die frühzeitige Identifikation von psychischen Störungen bei
Jugendlichen – insbesondere von ersten Anzeichen oder Vorstufen –
stellt eine grosse Herausforderung dar.
• Eine frühzeitige Diagnosestellung kann allerdings helfen, oft chronisch
verlaufende psychische Krankheiten zu einem frühen Zeitpunkt zu
erkennen und zu behandeln, um eine Chronifizierung zu verhindern.
• Eine zentrale Rolle bei der Früherkennung von psychischen
Krankheiten bei Jugendlichen nehmen die Kinder- und Hausärzt:innen
ein. Sie haben i.d.R. einen vertrauten Zugang zu den Jugendlichen,
sehen ihre Entwicklung in einem längeren Verlauf und können so
oftmals den Zusammenhang zwischen somatischen Beschwerden und
möglichen psychischen dahinterliegenden Problemen erkennen.
(Wieber et al., 2021)
Zürcher Fachhochschule
17Wo gibt es Ansatzpunkte für die Förderung der
psychischen Gesundheit?
Belastungen
intern und extern
Gesundheit
• Ressourcen
intern und extern
In Anlehnung an das Anforderungs-Ressourcen Modell in der Gesundheitsförderung (z.B. Blümel, 2021)
18
Zürcher FachhochschuleWo gibt es Ansatzpunkte für die Förderung der
psychischen Gesundheit?
Psychisch
Biologisch
Einstellungen
körperlich
Emotionen
genetische Risikofaktoren
Kind/ Charakter
JugendlicheR
Sozial
Familiäres Umfeld
Lebensbedingungen
Gesellschaft
Zürcher Fachhochschule
(z.B. Egger, 2018) 1Lebensfelder und Rahmenbedingungen der Gesundheit von
jungen Menschen
Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte für Interventionen zur Förderung
der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
(OBSAN, Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht, 2020)
Zürcher Fachhochschule
20Zentrale Ansätze in der Gesundheitsförderung
• Der Settingansatz ist zentral in der Gesundheitsförderung, da er neben dem
individuellen Verhalten einer Person auch die Verhältnisse betrachtet werden
(Verhaltens- und Verhältnisprävention)
• Der Peer-Ansatz bietet eine grosse Chance, um Jugendliche zu erreichen
Sogenannte Peers, d. h. Gleichaltrige oder aus der gleichen Zielgruppe
Stammende, werden in Programmen der Prävention und Gesundheitsförderung
eingesetzt. Sie werden speziell geschult, um andere Mitbetroffene über
spezifische Themen zu informieren und somit deren Einstellungen und
Verhaltensweisen zu beeinflussen. Der Peer-Ansatz bietet sich für verschiedene
Gesundheitsthemen im Jugendalter an (z. B. Alkohol- oder Drogenkonsum,
Stressbewältigung, Sexualaufklärung) (Backes, 2004).
• Die Partizipation der Zielgruppe und das Ziel, die Zielgruppe zu ermächtigen,
ihre Gesundheit selbständig managen zu können (Empowerment).
• Die Chancengleichheit bei der Erarbeitung und Implementierung von
Massnahmen
Zürcher Fachhochschule
21Beispiele zu Projekten zur Förderung der
psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit
Projekte zur Smartphone Nutzung
https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/klinische-psychologie-und-gesundheitspsychologie/saeuglingsforschung/smart-start/
Zürcher Fachhochschule
https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/klinische-psychologie-und-gesundheitspsychologie/saeuglingsforschung/smart-toddlers/ 22Beispiele zu Projekten zur Förderung der
psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit
Projekte zum Nutzen und Einfluss digitaler Informationen
https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/forschung/gesundheitswissenschaften/projekte/digitale-elternratgeber/
Zürcher Fachhochschule
https://digitalhealthlab.ch/de/digital-health-forum/kids-health-de 23Beispiele zu Projekten zur Förderung der
psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit
Bewertung digitale Apps als Informationen für Eltern
https://digitalhealthlab.ch/de/digital-health-forum/kids-health-de
Zürcher Fachhochschule
24Beispiele zu Projekten zur Förderung der
psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit
Tipps für Eltern mit Babys und kleinen Kindern bis 4 Jahre
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/empfehlungen/kinder-und-jugendliche/Infografik_GFCH_2021_03_-_So_wird_mein_Kind_seelisch_stark.pdf
Zürcher Fachhochschule
25Beispiele zu Projekten zur Förderung der psychischen Gesundheit in der Kindheit BAG Projekt «Psychische Gesundheit in der kinder- und hausärztlichen Versorgungspraxis» Ziel Wie können Eltern, Kinder/Jugendliche und Kinderärzt:innen ins Gespräch kommen über die psychische Gesundheit und über Möglichkeiten sie zu fördern? Wie kann man psychische Erkrankungen frühzeitig erkennen und eine gute Behandlung ermöglichen? https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im- gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m10-psychische-gesundheit.html Zürcher Fachhochschule 26
Entwicklung der Broschüren Alle Broschüren wurden forschungsbasiert entwickelt PraktikerInnen und Verbände wurden während der Entwicklung konsultiert In Zusammenarbeit mit: Zürcher Fachhochschule 27
Vorgehen
Auswahl
Analyse der geeigneter
Literaturrecherche
Faktoren Faktoren und
Tipps
Fokusgruppe mit Überarbeitung der
Grafische
med. Faktoren und
Umsetzung
Fachpersonen Tipps
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 2Materialien für die Eltern/Kinder
Fachinformation für die pädiatrische und hausärztliche Praxis
Psychische Gesundheit in der Kindheit:
Sensibilisierung und Früherkennung
Ein Flyer für Eltern, die aktiv die psychische Gesundheit ihrer
Kinder stärken wollen
Wie stärke ich die psychische Gesundheit meines Kindes?
Zürcher Fachhochschule 29Erahnen Sie, welche 10 Aspekte hier gemeint sind?
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 3Problemlöse-
fähigkeiten
Selbstwert
Selbst-
wirksamkeit
Emotions-
regulation Erholung
Optimismus
Soziale
Unterstützung
Familienklima
Offline
Natur Beschäftigung
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 3Zürcher Fachhochschule
32Zürcher Fachhochschule
33Mein Kind traut sich etwas zu
• Lassen Sie Ihr Kind sinnvolle Aufgaben selbst
übernehmen. Zum Beispiel selbst kochen, etwas
reparieren oder sich um das Haustier kümmern.
Selbst-
wirksamkeit
• Solche Erfolgserlebnisse sind wichtige
Erfahrungen, die dem Kind zeigen sollen: Ich kann
etwas beeinflussen!
• Ein Erfolgserlebnis kann auch sein, jemandem zu
helfen oder selbst etwas herzustellen.
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 3Mein Kind kann Probleme selber lösen
• Lassen Sie Ihr Kind Probleme alleine lösen. Helfen
Sie nur, wenn es nötig ist, zum Beispiel indem Sie
zusammen kleine machbare Handlungsschritte
Problemlöse- planen.
fähigkeiten
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiss, wo es sich
Hilfe holen kann.
• Auch wenn es schwierig ist: Denken Sie daran, dass
Ihr Kind durch Misserfolge dazulernt. Helfen Sie ihm,
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule
einen neuen Anlauf zu nehmen. Ihr Kind soll lernen, 3Mein Kind hat ein positives Bild von sich selbst
• Erkennen Sie die Stärken Ihres Kindes. Betonen Sie
diese Stärken: «Ich finde es toll, dass du ...» oder
«Du kannst besonders gut ...».
Selbstwert
• Erklären Sie Ihrem Kind, dass manchmal auch Kritik
wichtig ist. Fehler zu machen, hat nichts mit
Schwäche zu tun. Kritik kann uns helfen, uns zu
verbessern.
• Zeigen Sie Ihrem Kind: «Wir haben dich lieb, so wie
du bist.» Und: «Du musst nicht besser sein als
andere, um ein wertvoller Mensch zu sein.»
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule
• Anerkennen Sie, wenn Ihr Kind sich bemüht, etwas 3
zu schaffen. Feiern Sie gemeinsam kleineMein Kind kann mit seinen Gefühlen umgehen
• Gehen Sie auf die Gefühle Ihres Kindes ein. Benennen Sie
seine Gefühle, zum Beispiel: «Kann es sein, dass du
traurig/wütend/enttäuscht bist?»
Emotions-
regulation
• Seien Sie interessiert und fragen Sie nach, wenn Ihr Kind
von einer schwierigen Situation erzählt.
• Überlegen Sie gemeinsam Strategien, wie das Kind mit
Gefühlen umgehen kann. Zum Beispiel, wenn es traurig ist,
mit Eltern oder einem Kuscheltier kuscheln oder sich
ablenken.
• Seien Sie ein Vorbild, indem Sie offen mit Gefühlen
Zürcher Fachhochschule
umgehen. Kinder übernehmen viele Verhaltensmuster 3
Zürcher Fachhochschule
durch Abschauen von den Eltern: Erklären Sie Ihre GefühleMein Kind sieht die positiven Dinge im Leben
• Helfen Sie Ihrem Kind, auch bei negativen
Erlebnissen einen positiven Ausblick zu entwickeln –
nach Tiefen kommen auch wieder Höhen.
Optimismus
• Eine optimistische Haltung lässt sich trainieren:
Lassen Sie Ihr Kind jeden Tag ein schönes Erlebnis
aufschreiben oder zeichnen, zum Beispiel in einem
Tagebuch.
• Tauschen Sie sich mit Ihrem Kind über die
Erlebnisse eines Tages aus, erzählen Sie beide, was
heute gut gelaufen ist und was weniger.
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule
• Ein Abendritual kann helfen, den Tag positiv 3
abzuschliessen und erholsam zu schlafen.Mein Kind und wir Eltern verstehen uns gut in
der Familie
• Planen Sie regelmässig Zeit ein, in der Sie als Mutter
oder Vater oder gemeinsam als Eltern etwas Schönes
mit Ihrem Kind unternehmen.
• Entscheiden Sie sich gemeinsam oder lassen Sie
Familienklima immer abwechselnd ein anderes Familienmitglied
entscheiden, was Sie zusammen machen.
• Tragen Sie Konflikte zwischen Familienmitgliedern fair
aus, indem Sie allen zuhören und Entscheide
begründen.
• Strukturieren Sie den Alltag. Alltägliche Rituale wie ein
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule
gemeinsames Essen schaffen Verlässlichkeit. Es muss 3
nicht immer ein spezieller Ausflug sein.Mein Kind hat regelmässig freie Zeit
• Finden Sie heraus, bei welchen Tätigkeiten sich Ihr
Kind gut entspannen kann, zum Beispiel beim
Lesen oder Musikhören.
Erholung
• Ihr Kind braucht täglich Zeit, um sich selbst zu
beschäftigen und sich zu entspannen. Auch
Nichtstun ist eine wichtige Aktivität. Sie hilft, besser
durch stressreiche Zeiten zu kommen.
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 4Mein Kind hat gute Freunde
• Gute Freunde kümmern sich, respektieren sich,
lassen sich Freiheiten und unternehmen Dinge,
die beide/alle mögen.
Soziale
Unterstützung • Besprechen Sie mit Ihrem Kind, welche Freunde
ihm gut tun und wie es dazu beitragen kann, gute
Freundschaften zu schliessen und zu pflegen.
• Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, sich mit
anderen Kindern zu treffen, zum Beispiel bei
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule
einem gemeinsamen Hobby oder zu Hause. 4Mein Kind verbringt regelmässig Zeit draussen
• Gehen Sie mit Ihrem Kind in die Natur, zum
Beispiel in den Wald oder an einen Fluss. Die
Natur hat eine beruhigende Wirkung und
Natur reduziert Stress.
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 4Mein Kind kann sich offline beschäftigen
• Legen Sie Zeiten ohne Benutzung von digitalen Medien
(Smartphone, Tablet, Laptop, TV,…) fest, zum Beispiel
Offline keine Benutzung vor den Hausaufgaben oder beim Essen.
Beschäftigung
• Mediennutzung am Abend kann zu späten Einschlafzeiten
führen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind ausreichend
schläft. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit von Kindern:
6- bis 12-jährige Kinder sollten 9 bis 12 Stunden pro Tag
schlafen.
• Benutzt Ihr Kind regelmässig digitale Medien, dann zeigen
Sie Interesse an dem, was es macht. Kinder wünschen
sich, dass die Eltern sich interessieren für das, was sie
digital tun.
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 4
• Seien Sie ein Vorbild: Zeigen Sie, dass auch Sie fürEin Tipp nach dem anderen
Montag Dienstag Mittwoch Donnersta Freitag Samstag Sonntag
g
Zürcher Fachhochschule
Zürcher Fachhochschule 4Zürcher Fachhochschule
45Zürcher Fachhochschule 46
Materialien für die Jugendlichen
Fachinformation für die pädiatrische und hausärztliche Praxis
Psychische Gesundheit in der Jugend:
Sensibilisierung und Früherkennung
Ein Werkzeugkasten für Jugendliche,
die aktiv mit Herausforderungen umgehen wollen
Heb der Sorg!
Zürcher Fachhochschule 47Die Lebenswelten von Jugendlichen
Für Jugendliche im Übergang vom Kind zum Erwachsenen sind zum
einen nach wie vor die Lebenswelten von Familie, Schule und Vereine
verschiedenster Art bedeutsam.
Hinzu kommt für alle Jugendlichen, die eine Berufslehre beginnen, das
Setting des Betriebs als wichtige Lebenswelt.
Immer zentraler – oftmals essenzieller als alles andere – wird aber vor
allem die Peergroup. Sie bestimmt über Kleidungsstil und Musikvorlieben
und über verschiedene Verhaltensweisen. Dies betrifft insbesondere
gesundheitsfördernde bzw. gesundheitsgefährdende Handlungen.
Darüber hinaus werden Freundschaften an sich wertvoller, denn das
Gefühl der Verbundenheit trägt durch schwierige Erfahrungen. Peer-to-
Peer-Ansätze in der Gesundheitsförderung bauen denn auch auf der
positiven Kraft der Peergroup auf.
Zürcher Fachhochschule
48Schutzfaktoren ausbauen
• optimaler Zeitpunkt für Interventionen. Einerseits beginnen hier die
meisten psychischen Erkrankungen und Risikoverhaltensweisen und
andererseits besteht im Rahmen der Hirnentwicklung eine erhöhe
Veränderbarkeit der Denk- und Verhaltensmuster (Neuroplastizität)
• Im Rahmen der Förderungsmassnahmen lernen Jugendliche, sich
aktiv um ihre psychische Gesundheit zu kümmern und ihr
Gesundheitsverhalten selbständig zu managen. Dieser Lernprozess ist
zentral für den Aufbau langfristiger Gewohnheiten und
Verhaltensweisen. Gerade aufgrund der engen Verbindung zwischen
der psychischen und physischen Gesundheit zahlt sich das über die
gesamte Lebensspanne aus.
Zürcher Fachhochschule
49Schutzfaktoren ausbauen
• Starke Ressourcen wappnen Jugendlichen gegen verschiedene
Risikofaktoren. Risikofaktoren erhöhen stetig und zunehmend bis
ins Erwachsenenalter die Anfälligkeit für psychische Störungen.
Starke Ressourcen helfen hier, die Häufigkeit psychischer Störungen
zu verringern oder die zu erwartenden Verläufe in Richtung weniger
beeinträchtigender Folgen zu verschieben (Arango et al., 2018).
Zürcher Fachhochschule
50Risikofaktoren reduzieren
• Mit einer schlechten psychischen Gesundheit gehen oft
Risikoverhaltensweisen wie Tabak-, Alkohol- und sonstiger
Substanzkonsum oder auch riskantes Sexualverhalten und Gewalt
einher, deren Auswirkungen sich über die gesamte Lebensspanne
erstrecken und schwerwiegende Folgen haben.
• Eine Verbesserung der psychischen Gesundheit ist demnach eine
effektive Massnahme zur Prävention von Suchterkrankungen,
übertragbaren Krankheiten und Gewalt. Das Verhindern oder
Reduzieren von Risikoverhaltensweisen hilft dabei auch, das Leiden
Dritter zu reduzieren. Beispielsweise ist das Erfahren von Gewalt
häufig mit psychischen Problemen bei den Opfern verbunden .
Zürcher Fachhochschule
51Risikofaktoren reduzieren
• Suizide sind (nach Unfällen) die zweithäufigste Todesursache bei älteren
Jugendlichen.
• Über 90 Prozent der Jugendlichen, die suizidal werden hatten im Jahr
vorher eine psychische Krankheit, häufig eine klinische Depression in
Verbindung mit Substanzkonsum mit weiteren Belastungsfaktoren wie
Verhaltensstörungen, sozialen Verlusten, Gewalt, Unsicherheit über die
sexuelle Orientierung oder physischer oder sexueller Missbrauch
• Das Verhindern von psychischen Krankheiten und Suchtverhalten ist
somit auch Suizidprävention.
Zürcher Fachhochschule
52Risikofaktoren reduzieren
• Die Chronifizierung psychischer Erkrankungen ist mit hohen Kosten
und Leiden verbunden.
• Die Förderung der psychischen Gesundheit verringert das Risiko
chronischer psychischer Erkrankungen. So gibt es eine starke
wirtschaftliche Evidenz für schulpsychologische Interventionen zur
Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen (Feldman et al., 2021; Mcdaid et al., 2017).
• Die WHO empfiehlt in ihrer Liste der kostenwirksamen Interventionen
zur Förderung der psychischen Gesundheit in Ländern mit mittlerem
und hohem Einkommen dementsprechend schulbasierte sozio-
emotionale Lernprogramme (WHO, 2021) und zwar sowohl für alle
Kinder (universell) als auch für gefährdete Kinder (indiziert).
Zürcher Fachhochschule
53Risikofaktoren reduzieren
• Schliesslich fordern auch die Vereinten Nationen die Verbesserung der
psychischen Gesundheit bei jungen Menschen.
• In ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development
Goals, SDGs) formulieren sie "Ein gesundes Leben gewährleisten und
das Wohlergehen aller Menschen in jedem Alter fördern" (SDG 3).
• Da die psychischen Erkrankungen einen erheblichen Teil der
weltweiten Krankheitslast im Jugendalter ausmachen und die
Hauptursache für Behinderungen bei jungen Menschen darstellen, ist
die Verbesserung der psychischen Gesundheit der Jugendlichen
notwendig, um die Ziele zu erreichen.
Zürcher Fachhochschule
54Zürcher Fachhochschule
55Zürcher Fachhochschule
56Zürcher Fachhochschule
57ZHAW Psychologisches Institut 58
Zürcher Fachhochschule
59Zürcher Fachhochschule
60Zürcher Fachhochschule
61Zürcher Fachhochschule
62Zürcher Fachhochschule
63Zürcher Fachhochschule
64ZHAW Psychologisches Institut 65
ZHAW Psychologisches Institut 66
Zürcher Fachhochschule 67
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und an die Unterstützenden des Take Care Projekts! In Zusammenarbeit mit: Finanziert von: Förderprogramm Interprofessionalität Besonderer Dank an: VBGF/ARPS und NPG/RSP Projektteam: Frank Wieber Agnes von Wyl Aureliano Crameri Julia Dratva Silvia Passalacqua Annina Zysset Zürcher Fachhochschule 68
Literaturverzeichnis
APA, 2021. Teen Suicide Is Preventable [WWW Document]. https://www.apa.org. URL https://www.apa.org/research/action/suicide (accessed 10.18.21).
Arango, C., Díaz-Caneja, C.M., McGorry, P.D., Rapoport, J., Sommer, I.E., Vorstman, J.A., McDaid, D., Marín, O., Serrano-Drozdowskyj, E., Freedman, R., Carpenter,
W., 2018. Preventive strategies for mental health. Lancet Psychiatry 5, 591–604.
Ambord, S., Eichenberger, Y., Jordan, M.D., 2020. Gesundheit und Wohlbefinden der 11-bis 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz im Jahr 2018 und zeitliche
Entwicklung -Resultate der Studie “Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC) (For-schungsbericht Nr. 113). Sucht Schweiz, Lausanne.
Amendola, S., von Wyl, A., Volken, T., Zysset, A., Huber, M., & Dratva, J. (2021). A Longitudinal Study on Generalized Anxiety Among University Students During the
First Wave of the COVID-19 Pandemic in Switzerland. Frontiers in Psychology, 12, 706. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.643171
Blümel, S. (2020). Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell in der Gesundheitsförderung. Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention: Glossar zu
Konzepten, Strategien und Methoden. https://doi.org/10.17623/BZGA:224-I121-2.0
Dratva, J., Zysset, A., Schlatter, N., von Wyl, A., Huber, M., & Volken, T. (2020). Swiss University Students’ Risk Perception and General Anxiety during the COVID-19
Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20), 7433. https://doi.org/10.3390/ijerph17207433
Egger, J. (2018). Das biopsychosoziale Modell. Schweizerische Ärztezeitung, 99(35), 1156–1158. https://doi.org/10.4414/saez.2018.06861
Feldman, I., Gebreslassie, M., Sampaio, F., Nystrand, C., Ssegonja, R., 2021. Economic Evaluations of Public Health Interventions to Improve Mental Health and
Prevent Sui-cidal Thoughts and Behaviours: A Systematic Literature Review. Adm. Policy Ment. Health Ment. Health Serv. Res. 48, 299–315.
youthinmind. (o. J.). SDQ Frageboegen—Deutsche Version. SDQ Frageboegen - Deutsche Version. Abgerufen 22. Oktober 2021, von
https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=German
Keyes, C.L.M., 2005. Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the Complete State Model of Health. J. Consult. Clin. Psychol. 73, 539–548.
Mcdaid, D., Park, A.-L., Knapp, M., 2017. Commissioning Cost-Effective Services for Promotion of Mental Health and Wellbeing and Prevention of Mental Ill-Health.
Mohler-Kuo, M., Dzemaili, S., Foster, S., Werlen, L., Walitza, S., 2021. Stress and Mental Health among Children/Adolescents, Their Parents, and Young Adults
during the First COVID-19 Lockdown in Switzerland. Int. J. Environ. Res. Public. Health 18, 4668.
Polanczyk, G.V., Salum, G.A., Sugaya, L.S., Caye, A., Rohde, L.A., 2015. Annual Research Review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders
in children and adolescents. J. Child Psychol. Psychiatry 56, 345–365.
OBSAN, (2020). Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020. Abgerufen 22. Oktober 2021, von
https://www.gesundheitsbericht.ch/de
Quervain, D. de, Aerni, A., Amini, E., Bentz, D., Coynel, D., Freytag, V., Gerhards, C., Papas-sotiropoulos, A., Schicktanz, N., Schlitt, T., Zimmer, A., Zuber, P., 2020a.
The Swiss Corona Stress Study: second pandemic wave, November 2020.
Quervain, D. de, Aerni, A., Amini, E., Bentz, D., Coynel, D., Gerhards, C., Fehlmann, B., Frey-tag, V., Papassotiropoulos, A., Schicktanz, N., Schlitt, T., Zimmer, A.,
Zuber, P., 2020b. The Swiss Corona Stress Study.
Schulte-Körne, G. (2016). Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Umfeld. Deutsches Aerzteblatt, 113, 183–190.
https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0183
Steinhausen, H.C., Metzke, C.W., Meier, M., Kannenberg, R., 1998. Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders: the Zürich Epidemiological Study. Acta
Psychiatr. Scand. 98, 262–271.
Werlen, L., Puhan, M.A., Landolt, M.A., Mohler-Kuo, M., 2020. Mind the treatment gap: the prevalence of common mental disorder symptoms, risky substance use
and service utilization among young Swiss adults. BMC Public Health 20, 1470.
WHO, 1994. Life skills education for children and adolescents in schools. Pt. 1, Introduction to life skills for psychosocial competence. Pt. 2, Guidelines to facilitate the
development and implementation of life skills programmes. https://apps.who.int/iris/handle/10665/63552
WHO, 2017. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!). https://www.who.int/publications/i/item/9789241512343
WHO, 2020. Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents. https://www.who.int/publications-detail-redirect/guidelines-on-mental-
health-promotive-and-preventive-interventions-for-adolescents
WHO, 2021. Menu of cost-effective interventions for mental health. https://www.who.int/publications/i/item/9789240031081
WHO-5 Questionnaires [WWW Document], 1998. URL
https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx (accessed 10.18.21).
Wieber, F., Passalacqua, S., Zysset, A., Crameri, A., Künzler, A., & von Wyl, A. (2021). Prävention psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter.
Schweizerische Ärztezeitung, 102(38), 1228–1230. https://doi.org/10.4414/saez.2021.20015
Zürcher Fachhochschule
69Sie können auch lesen