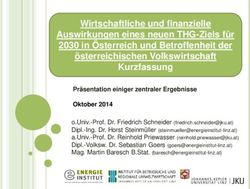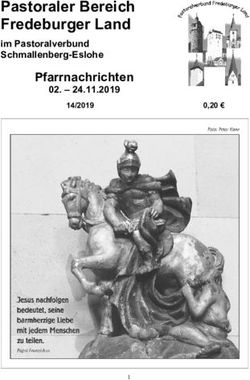Gebäudehüllensanierung versus Heizsystemerneuerung, gibt es ein Optimum? - Dipl.-Ing. Dr. Horst Steinmüller - Klimaaktiv
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gebäudehüllensanierung
versus
Heizsystemerneuerung,
gibt es ein Optimum?
Dipl.-Ing. Dr. Horst SteinmüllerAgenda
I. Einleitung
II. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen
und ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungs-
maßnahmen im Vergleich zur thermischen Sanierung
zur effizienteren Energienutzung
III. Studie: Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen
eines neuen THG-Ziels für 2030 in Österreich und
Betroffenheit der österreichischen Volkswirtschaft
IV. Standortspezische Überlegungen
V. Zusammenfassung
2
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2011. Einleitung
Vorstellung des Energieinstitutes an der JKU Linz
Gründung des Instituts im Jahr 2001
Spendenabzugsfähiger, gemeinnütziger Verein
Außeruniversitäres Forschungsinstitut
„Partner of Innovation“ der Johannes Kepler Universität Linz
Aktuelle Mitarbeiterzahl (Mai 2015): 27 Mitarbeiter
Abteilung Energiewirtschaft
o.Univ.-Prof. Dr. Friedrich Schneider
Institut für Volkswirtschaftslehre, JKU
Abteilung Energierecht
Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer,
Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, JKU
Abteilung Energietechnik
3
Dipl.-Ing. Dr. Horst Steinmüller, Geschäftsführung
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 201Unsere Methoden und Themen
4
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2011. Einleitung
Die Ausführungen sollen zeigen, dass für die Frage
Gebäudehüllensanierung versus Heizsystemerneuerung,
gibt es ein Optimum?
die Rahmenbedingungen und die standortspezifischen
Gegebenheiten eine wichtige Rolle spielen. Hierfür werden die
Ergebnisse folgender beiden Studien herangezogen:
„Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungs-
maßnahmen im Vergleich zur thermischen Sanierung zur
effizienteren Energienutzung“
„Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen
THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der 5
österreichischen Volkswirtschaft“
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2012. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Hintergrund:
• Geplante Energie- und Emissionseinsparungen im
Wohngebäudesektor nicht erreicht
• Sanierungsquote Altbau: liegt zurzeit bei ca. 1 % (Ziel der
Klimastrategie 2007: 3 %, mittelfristiges Ziel: 5 %)
Ziel: Untersuchung verschiedener Sanierungspfade
zur effizienteren Energienutzung
62. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Abb. 1: Übersicht der betrachteten Sanierungsmaßnahmen
REFERENZ: thermisch & anlagenseitig unsaniertes Gebäude des österreichischen Wohnbestandes mit
1 Wohneinheit (1 WE) 6 Wohneinheiten (6 WE) 16 Wohneinheiten (16 WE)
Sanierungsstrategie 1: Sanierungsstrategie 2:
Thermisch sanieren Anlagenseitig sanieren
· Austausch von Fenster & Türen Luft- Erdwärme-
Stückgut Pellets Hackschnitzel
· Dämmung der Außenwände Wärmepumpe Wärmepumpe
· Dämmung der obersten Geschoßdecke
· Dämmung der Kellerdecke
Alle Anlagen auch in Kombination mit einer Solaranlage zur
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
12 m² (1WE) / 18 m² (6 WE) / 27 m² (16 WE) Kollektorfläche
7
Zusatzmodul: Integration einer Photovoltaik-Anlage
14,9 kWpeak (1WE) / 19,9 kWpeak (6 WE) / 45,9 kWpeak (16 WE)
Quelle: eigene Darstellung.2. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Abb. 2: Einsparung der gesamten jährlichen Kosten (Kapitaldienst + Brennstoff + Betrieb) der
Sanierungsstrategien im Vergleich zur REFERENZ-Situation in %
Anmerkung: Fehlerindikator gibt die Bandbreite der untersuchten Gebäudetypen (1 WE, 6 - 16 WE) an.
8
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung basierend auf spezifischen Energieausweisberechnungen.2. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Abb. 3: Amortisationszeit der thermischen Sanierung im Vergleich zur anlagenseitigen Sanierung
Anmerkung: Maßnahme ist zu 100% kreditfinanziert (5% Zinsen); Jährliche kWh-Einsparung durch Maßnahme bleibt über
20 Jahre konstant (keine Berücksichtigung der Inflation oder der Energiepreisentwicklung).
9
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung.2. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Abb. 4: Veränderung des Bruttoinlandsprodukts in Österreich durch Umsetzung der Sanierungsstrategien
Anmerkung: Berechnung je Sanierungsstrategie für 100.000 Wohngebäude in 6 Jahren, anhand von makroökonomischen
Simulationsanalysen mit dem Zeitreihenmodell MOVE.
10
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung.2. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Abb. 5: Veränderung der Anzahl der Beschäftigten in Österreich durch Umsetzung der Sanierungsstrategien
Anmerkung: Berechnung je Sanierungsstrategie für 100.000 Wohngebäude in 6 Jahren, anhand von makroökonomischen
Simulationsanalysen mit dem Zeitreihenmodell MOVE.
11
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung.2. Studie: Betrachtung der ökonomischen, energetischen und
ökologischen Effekte anlagenseitiger Sanierungsmaßnahmen im
Vergleich zur thermischen Sanierung zur effizienteren
Energienutzung
Fazit der Studie
• Hohe erzielbare Reduktionen des Heizenergiebedarfs
(thermische Sanierung: bis zu 65 %; anlagenseitig: bis zu 82 %)
• Durch anlagenseitige Sanierung ergeben sich im Vergleich zur
thermischen Sanierung
geringere jährliche Gesamtkosten, geringere
Amortisationszeiten
kurzfristig: geringere Erhöhung des BIP, der Investitionen
u. Beschäftigten
langfristig: ähnliches Niveau der volkswirtschaftlichen
Effekte
12
• Anlagenseitige Sanierungsmaßnahmen können (aus ökonomischer,
energetischer und ökologischer Sicht) einen signifikanten Beitrag3. Studie Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der österreichischen Volkswirtschaft“ In dieser Studie wurde auch ein komperativ - statischer Vergleich von 26 Einzelmaßnahmen im Non-ETS Sektor durchgeführt, wobei sechs die vorliegende Fragestellung betreffen: (07) FAM-H4 Zusätzliche Steigerung der Heizsystemerneuerung auf 4% im Jahr 2020 (08) WAM-H2 Förderung klimafreundlicher Heizsysteme (16) FAM-I2 Solarthermische Energie für Prozess- und Raumwärme (24% des Gesamtanteils) (16) FAM-I2 Solarthermische Energie für Prozess- und Raumwärme (24% des Gesamtanteils) (25) FAM-H1 Thermische Sanierung bestehender Gebäude (Sanierungsrate von 1,2% auf 5% p.a., (26) WAM-H1 Forcierung der thermischen Sanierung von Gebäuden (Sanierungsrate um 1,2% p.a.) 13 Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 201
3. Studie Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen
THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der
österreichischen Volkswirtschaft“
(01) FAM-I4 Energieeffiziente Motoren
(02) RAM-V3 Umstellung von Dieselbetrieb auf Erdgasbetrieb bei LKWs (2020: 34%, 2030: 70%)
(03) FAM-V4 Ausbau nichtmotorisierter Transportmittel
(04) FAM-V3 Effiziente Verkehrseinsparung durch Urbanisierung
(05) FAM-I1 Erneuerbare Energieressourcen für Prozesswärme in der verarbeitenden Industrie (24% des Gesamtanteils)
(06) FAM-I3 Erhöhung der thermischen Effizienz in industriellen Gebäuden
(07) FAM-H4 Zusätzliche Steigerung der Heizsystemerneuerung auf 4% im Jahr 2020
(08) WAM-H2 Förderung klimafreundlicher Heizsysteme
(09) WAM-V4 Effizientere Kfz-Nutzung – Flächendeckende Tempolimits
(10) RAM-V2 Anstieg von 3l-Fahrzeugen bis 2030 auf 1,29 Mio. Fahrzeuge (30% GF ohne EV)
(11) FAM-E1 Substitution fossiler Energieproduktion (Gas und Kohle) durch Windenergie (16% des Gesamtanteils)
(12) FAM-E3 Substitution fossiler Energie- und Wärmeproduktion (Gas und Kohle) durch Biomasse- und Biogas-KWKs (16% des Gesamtanteils)
(13) FAM-E2 Substitution fossiler Energieproduktion (Gas und Kohle) durch Laufwasserkraftwerke (16% des Gesamtanteils)
(14) FAM-V5 Fracht Transport Verbesserung - Verlagerung des Frachttransportes von der Straße auf die Schiene
(15) FAM-V1 Erhöhung der Biokraftstoffanteile: 7% bis 2015, 10% bis 2020 und 25% bis 2030
(16) FAM-I2 Solarthermische Energie für Prozess- und Raumwärme (24% des Gesamtanteils)
(17) FAM-V6 MÖSt-Erhöhung 2021 um 0,04€/l Benzin und 0,02€/l Diesel (Bedingt WAM-V1! Steuerverlust Inland 24,7 Mio. € + Ausland 222,6 Mio. €)
(18) WAM-V1 MÖSt-Erhöhung 2015 und 2019 um jeweils um 0,05€/L Benzin und Diesel. (Steuerverlust Inland 21,4 Mio. € + Ausland 192,9 Mio. €)
(19) FAM-I5 Substitution von Kohle und Ölöfen durch Gasöfen (exkl. Eisen- und Stahl-Industrie)(24% des Gesamtanteils)
(20) RAM-V1 Anstieg von Elektrofahrzeugen bis 2030 auf 1,46 Mio. Fahrzeuge (30% der Gesamtflotte, bedingt WAM-V5!)
(21) FAM-H3 Solarwärme für Raumheizung und Warmwasser (Deckungsgradanstieg von 1% auf 10%)
(22) WAM-V5 Trend Elektromobilität – Forcierung der Elektromobilität gemäß Energiestrategie Österreich
(23) FAM-H2 Errichtung neuer Gebäude mit Passivhausstandard (90% aller Neubauten bis 2020)
(24) FAM-V2 Ausbau und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs
(25) FAM-H1 Thermische Sanierung bestehender Gebäude (Sanierungsrate von 1,2% auf 5% p.a.,
(26) WAM-H1 Forcierung der thermischen Sanierung von Gebäuden (Sanierungsrate um 1,2% p.a.)
14
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2013. Studie Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der österreichischen Volkswirtschaft“ Abbildung 6: Jährliche CO2e-Vermeidungskosten zur Zielerreichung und EU-Ziele für Österreich in 2030 – Non-ETS-Sektoren (Reihung: Kosteneffizienz) Quelle: Eigene Berechnungen basierend primär auf Daten aus Europäische Kommission (2014), FVT TU Graz 15 (2011), Streicher et al. (2011), Umweltbundesamt (2013a, 2013b, 2008) und WIFO (2011)
3. Studie Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines
neuen THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der
österreichischen Volkswirtschaft“
Abbildung 7: Jährliche THG-Vermeidungskosten im Zeitraum 2010-2030 zur
Zielerreichung des 35%/40%/45% EU-Ziels für Österreich in 2030 in den Nicht-ETS-
Sektoren, Reihung: realpolitische Durchsetzbarkeit
16
Die Überlappung von Maßnahmen und daraus folgende Einflüsse auf das Einsparpotential dieses Portfolios werden innerhalb der Analyse nicht berücksichtigt.
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen basierend primär auf Daten aus Europäische Kommission (2014), FVT TU Graz (2011), Umweltbundesamt
(2013a, 2013b, 2008) und WIFO (2011)3. Studie Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen
THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der
österreichischen Volkswirtschaft“
Bei der Komparativen Statik handelt es sich um die Gegenüberstellung
mehrerer gesamtwirtschaftlicher Gleichgewichtszustände. Es werden
dabei gewöhnlich ein Start- und ein Zielzustand (hypothetischer
Zustand) verglichen. Die Eigenschaft der Statik resultiert aus der
Tatsache, dass der Anpassungsprozess über die Zeit nicht analysiert
wird.
Komparativ-statische Betrachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen
eines neuen THG-Ziels für 2030 in Österreich
Österreich in 2030
• EU-THG-
CO2e-Reduktion CO2e-Reduktion Ø-Kosten
Reduktionsziel Sektor
(Basis: 2005) [Mio. tCO2e] [Mio. € p.a.]
in 2030
-40% ETS* 43% 15,4 558
Reihung nach Nicht-ETS 40% 14,0 39
Kosteneffizienz ∑ 41% 29,4 597
ETS* 43% 15,4 558
-40%
Reihung nach Nicht-ETS 40% 14,0 1.444
realpolitischer
Durchsetzbarkeit ∑ 41% 29,4 2.002 17
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2013. Studie Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen
THG-Ziels für 2030 in Österreich und Betroffenheit der
österreichischen Volkswirtschaft“
Die dynamische Modellierung erlaubt die Betrachtung der Entwicklung
volkswirtschaftlicher Größen im Zeitverlauf bzw. deren Abhängigkeit
von der Zeit. Das bedeutet, dass nicht nur einzelne Momentaufnahmen
vorgenommen werden, sondern dass ebenfalls zwischen den
Gleichgewichtszuständen liegende Annäherungsprozesse analysiert
werden. Bei den Simulationsanalysen des Energieinstituts werden
Mehrrundeneffekte berücksichtigt.
Zentrale makroökonomische Auswirkungen in Österreich bei Umsetzung des 40%-THG-
Einsparziele auf EU-Ebene in 2030
Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt
THG-Reduktion auf EU-
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt
Ebene um 2030
2010-2020 2021-2030 2010-2030
[Mio. €]
[Mio. € pro Jahr] [Mio. € pro Jahr] [Mio. € pro Jahr]
-40%
-135 -3.324 -1.654 -5.044
Reihung nach Kosteneffizienz
-40%
Reihung nach realpolitischer -154 -3.095 -1.554 -3.865
18
Durchsetzbarkeit
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2014 . Standortspezifische Überlegungen
Städtisches oder ländliches Gebiet
Nah- bzw. Fernwärme versorgt
Art des Energieträgers leitungsgebunden versus
nicht- leitungsgebunden
Nutzung von Abwärme
19
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 2015. Zusammenfassung
Die vorangegangenen Ausführungen haben
gezeigt, dass es für die Frage
Gebäudehüllensanierung versus
Heizsystemerneuerung,
gibt es ein Optimum?
keine eindeutige Antwort gibt, sondern
dass die Rahmenbedingungen und die
regionalspezifischen Gegebenheiten eine
wichtige Rolle spielen.
20
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 201Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt:
Energieinstitut an der Johannes Kepler
Universität Linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz
AUSTRIA
Tel: +43 723 2468 5656
Fax: + 43 723 2468 5651
e-mail: office@energieinstitut-linz.at
21
Energieinstitut an der JKU Linz, Städtische Wärmewende Wien, 29. Jänner 201Sie können auch lesen