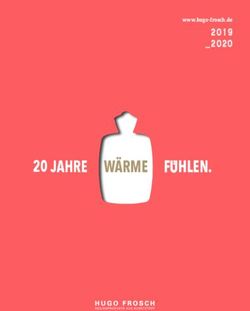Geregelte Schädlinge an Steinobst (Prunus) - ISIP
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Geregelte Schädlinge an Steinobst (Prunus)
Schädlinge, die Symptome schwerpunktmäßig an den Pflanzen verursachen,
teilweise auch an Früchten
Viren und ähnliche Erreger
Apple chlorotic leaf spot virus Chlorotisches Blattfleckenvirus des Apfels RNQP
Candidatus Phytoplasma prunorum Europäische Steinobstvergilbung RNQP
Cherry green ring mottle virus Grünes Ringfleckenvirus der Kirsche RNQP
Cherry mottle leaf virus Blattsprenkelvirus der Kirsche RNQP
Cherry necrotic rusty mottle virus Nekrotisches Rostfleckenvirus der Kirsche RNQP
Little cherry virus 1 und 2 Viröse Kleinfrüchtigkeit der Kirsche RNQP
Peach latent mosaic viroid Latentes Pfirsichmosaikviroid RNQP
Plum pox virus Scharka-Virus RNQP
Prune dwarf virus Verzwergungsvirus der Pflaume RNQP
Prunus necrotic ringspot virus Nekrotisches Ringfleckenvirus des Steinobstes RNQP
American plum line pattern virus Amerikanisches Pflaumenbandmosaikvirus UQS
Cherry rasp leaf virus Rauhblättrigkeit der Kirsche UQS
Peach mosaic virus Pfirsichmosaikvirus UQS
Peach rosette mosaic virus Pfirsichrosettenmosaikvirus UQS
Tomato ringspot virus Tomatenringfleckenvirus UQS
Bakterien
Agrobacterium tumefaciens Wurzelkrebs, Wurzelkropf RNQP
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Bakterienbrand des Steinobsts RNQP
Pseudomonas syringae pv. persicae Bakterienbrand des Pfirsichs RNQP
Pseudomonas syringae pv. syringae Bakterienbrand RNQP
Xanthomonas arboricola pv. pruni Fleckenbakteriose an Steinobst RNQP
Xylella fastidiosa Feuerbakterium pUQS
Pilze
Phytophtora cactorum Kragenfäule RNQP
Verticillium dahliae Verticillium-Welke RNQP
Apiosporina morbosa Schwarzknotenkrebs UQS
Insekten
Pseudaulacapsis pentagona Maulbeerschildlaus RNQP
Quadraspidiotus perniciosus San-José-Schildlaus RNQP
Anoplophora chinensis Zitrusbockkäfer pUQS
Aromia bungii Asiatischer Moschusbock pUQS
Choristoneura rosaceana Schräg-gebändeter Wickler UQS
Popillia japonica Japankäfer pUQS
Saperda candida Rundköpfiger Apfelbaumbohrer UQS
Schädlinge, die Symptome schwerpunktmäßig an Früchten verursachen
Insekten
Carposina sasakii Asiatische Pfirsichfruchtmotte UQS
Conotrachelus nenuphar Nordamerikanischer Pflaumenrüssler pUQS
Grapholita prunivora Kleine Apfelwurmmotte UQS
Rhagoletis pomonella Apfelfruchtfliege pUQS
Seite 1 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Erläuterungen und Hinweise
RNQP steht für unionsgeregelter Nicht-Quarantäneschädling. Die Abkürzung leitet sich von dem englischen
Begriff „Regulated Non-Quarantine Pest“ ab. Dabei handelt es sich um Schaderreger, die in der EU bereits weit
verbreitet sind und eine Tilgung in der EU nicht mehr angestrebt wird. Allerdings entstehen erhebliche
wirtschaftliche Schäden, sofern Pflanzmaterial bereits zu Kulturbeginn befallen ist. Deshalb muss Pflanzmaterial
grundsätzlich frei davon sein, d. h. die Ware muss die Baumschule bzw. den Pflanzenhandel befallsfrei
verlassen. Der Schwellenwert ist bei RNQPs an Steinobst 0%. Ein späterer Befall in der Erwerbsobstanlage, im
Hausgarten oder auf der Streuobstwiese wird hingegen von amtlicher Seite toleriert und zieht keine
Quarantänemaßnahmen nach sich, sondern es ist grundsätzlich jedem Bewirtschafter überlassen, ob und ggf. in
welchem Umfang er Maßnahmen ergreift.
Achtung: In der näheren Umgebung von Vermehrungsbeständen (z. B. Reiserschnittgarten,
Baumschulquartieren) können auch für Streuobstbestände, Hausgärten, etc. strengere Vorgaben gelten, um die
Vermehrungsbestände vor einer natürlichen Infektion zu schützen.
UQS steht für Unionsquarantäneschädling. Diese Schaderreger treten in der EU nicht oder nur sehr begrenzt
auf. Sowohl der Verdacht des Auftretens als auch das Auftreten muss dem Pflanzenschutzdienst gemeldet
werden (von Unternehmern und auch von Privatpersonen). Zur Ausstellung des Pflanzenpasses ermächtigte
Unternehmer verfügen zudem über einen betriebsinternen Handlungsplan, in dem wesentliche Schritte zum
betrieblichen Vorgehen im Verdachts- und Auftretensfall dokumentiert sind.
Bei der Einschleppung und Ansiedelung von prioritären Unionsquarantäneschädlingen (pUQS) werden
besonders große und schwerwiegende Schäden erwartet. Die Meldepflichten und Vorgaben für ermächtigte
Unternehmer sind jedoch die gleichen wie bei gewöhnlichen Unionsquarantäneschädlingen.
Allgemeine Grundsätze zur Untersuchung von Vermehrungsmaterial
vor Pflanzenpassausstellung bzw. Inverkehrbringen:
Aufgrund der unterschiedlichen optimalen Zeiträume für die verschiedenen Schädlinge sind bei Steinobst
mindestens zwei Sichtkontrollen notwendig, eine im Frühsommer (ca. Mai bis Juli) und eine im Spätsommer (ca.
September bis Oktober).
Hinweis zur Auswahl der dargestellten geregelten Schädlinge
Im Folgenden sind RNQPs und Unionsquarantäneschädlinge dargestellt, die vom Pflanzenschutzdienst in
Baden-Württemberg für Steinobst als bedeutend angesehen werden. Weitere geregelte Schädlinge an Steinobst
können mit Hilfe der entsprechenden Rechtsnormen recherchiert werden.
Sofern Sie einen für Baden-Württemberg bedeutsamen, geregelten Schädling an Steinobst vermissen, wenden
Sie sich bitte an pflanzengesundheit@ltz.bwl.de.
Hinweis zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
Pflanzenschutzmittel müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen angewendet werden. Der im Folgenden
empfohlene Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird aus biologischer Sicht als hilfreich eingeschätzt. Allerdings
muss der Anwender vor dem Einsatz prüfen, ob eine Anwendung zum geplanten Zeitpunkt an der betreffenden
Kultur rechtlich zulässig ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die amtliche Pflanzenschutzberatung.
Seite 2 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Apple chlorotic leaf spot virus (Chlorotisches Blattfleckenvirus des Apfels)
Regelung: RNQP an Cydonia oblonga, Malus, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P.
dulcis, P. persica, P. salicina, Pyrus
Symptome am Blatt
Foto: Luca Monducci (Unibo), gd.eppo.int Fotos: Luca Monducci, gd.eppo.int
Wirtspflanzen: Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina, Cydonia,
Malus, Pyrus; weitere Obst- und Zierpflanzen (u. a. Chaenomeles japonica, Eriobotrya japonica, Sorbus
aucuparia) dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungbäume, Edelreiser, Unterlagen; vermutlich durch Wurzelverwachsungen; eine
Übertragung durch Vektoren, Pollen und Samen wurde bisher nicht nachgewiesen
Symptome: Blatt-, Knospen- und Rindennekrosen; Triebstauchung; Blattverfärbungen (unregelmäßige,
gelbgrüne, mosaik-, ring- oder linienförmige Flecken); Blattdeformation (einseitige Reduzierung der Blattspreite);
gekräuselte, gewellte Blätter bei starkem Befall; deformierte Früchte und Fruchtringberostung bei anfälligen
Sorten; Absterben des Baumes bei Unverträglichkeit der Unterlage oder besonders anfälligen Sorten möglich;
Symptomausprägung ist sortenabhängig; latenter Befall möglich
Beobachtungszeitraum: vorzugsweise im Frühsommer (Mai bis Juli), da Symptome meist am Laub des
Frühsommers gut ausgeprägt sind
Verwechslung: mit anderen Viruserkrankungen, wie dem Plum pox virus
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus Bestand entfernen,
sofern Wurzelverwachsungen nicht ausgeschlossen werden können
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen); ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragung durch Wurzelverwachsungen zu vermeiden
Symptome am Pfirsichblatt
Foto: M. Petruschke, LTZ Augustenberg
Seite 3 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Candidatus Phytoplasma prunorum (Europäische Steinobstvergilbung)
Regelung: RNQP an Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica,
P. salicina (Samen ausgenommen)
Phloemnekrosen Blattrollsymtome bei Aprikose
Absterbesymptome bei Aprikose
Fotos: G. Morvan, INRA, Montfavet (FR)., gd.eppo.int Fotos: J. Hinrichs-Berger, LTZ Augustenberg
Wirtspflanzen: Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina; weitere
Obst- und Zierpflanzen (u. a. weitere Prunus-Arten sowie Fraxinus exelsior, Rosa canina, Celtis australis)
dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungbäume, Edelreiser, Unterlagen; durch Vektoren, wie z. B. dem Pflaumenblatt-
sauger (Cacopsylla pruni); möglicherweise auch durch Wurzelverwachsungen
Symptome: kleine Blätter, Blattchlorosen, Blatteinrollen, ggf. frühzeitiger Blattfall, ggf. vorzeitiger Austrieb der
Blätter (verkürzte Knospenruhe, Blätter erscheinen vor den Blüten), ggf. Phloemnekrosen, rötliche Verfärbung
zwischen den Blattnerven bei Pfirsich möglich; Symptome treten häufig erst bei älteren Bäumen auf Krankheit
ist daher visuell in Baumschulen kaum erkennbar; latenter Befall bei einigen Prunus-Arten, z. B. bei Prunus
spinosa
Beobachtungszeitraum: bevorzugt im Spätsommer / Frühherbst
Verwechslung: Symptome können teilweise mit anderen Schadursachen (z. B. Wassermangel,
Viruserkrankungen) verwechselt werden
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen und Vektoren zu verringern; Einsatz
von geeigneten Insektiziden während der Vegetationszeit zum Schutz vor Vektoren (Objektschutz); da sich das
Phytoplasma im Winter in die Wurzel zurückzieht, geht von Edelreisern, die Ende Januar / Anfang Februar
geschnitten werden, kaum ein Verbreitungsrisiko aus
Anforderungen für zertifiziertes Material und CAC-Material an die Produktionsfläche (nach RL 2014/98/EU):
Mindestens eine der folgenden besonderen Anforderungen (A1 oder A2) muss erfüllt sein:
A1: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden keine Symptome von Candidatus
Phytoplasma prunorum auf der Produktionsfläche festgestellt, und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe (z. B.
in einer angrenzenden Hecke), die Symptome aufwiesen, wurden entfernt und unverzüglich vernichtet.
A2: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden Symptome von Candidatus Phytoplasma
prunorum an höchstens 1% der Pflanzen auf der Produktionsfläche festgestellt; symptomatische Pflanzen auf
der Produktionsfläche sowie in der Umgebung wurden entfernt und unverzüglich vernichtet; in einer
repräsentativen Probe der symptomfreien Pflanzen der befallenen Partie konnte Candidatus Phytoplasma
prunorum nicht nachgewiesen werden
Seite 4 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Cherry green ring mottle virus (Grünes Ringfleckenvirus der Kirsche)
Regelung: RNQP an Prunus avium, Prunus cerasus
leider kein Foto
verfügbar
Wirtspflanzen: Prunus avium, Prunus cerasus; weitere Prunus-Arten dienen als Wirte (aber keine RNQP-
Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungbäume, Edelreiser, Unterlagen; eine Übertragung durch Vektoren ist bisher nicht
bekannt
Symptome: gelbe Blattflecken, die von unregelmäßigen, grünen Inseln oder Ringen durchzogen werden; eher
selten erfolgt die Gelbfärbung der Seitenvenen, die normalerweise von einer Spitzenverformung begleitet wird;
Entwicklung von unförmigen Früchten, mit korkbraun-verfärbten Dellen, Streifen oder Ringen in der Epidermis,
die sich bis in das Fruchtfleisch erstrecken; zudem schmecken die Früchte bitter;
Symptome sind an Prunus cerasus bekannt; deutliche Symptomausprägung bei der Sauerkirschsorte
‚Montmorency‘; Prunus armeniaca, P. avium, und P. persica sind symptomlose Wirte
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen roden
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen)
Seite 5 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Cherry mottle leaf virus (Blattsprenkelvirus der Kirsche)
Regelung: RNQP an Prunus avium, P. cerasus
Symptome an Blättern
Foto: H.J. Larsen, Bugwood.org (CC BY 3.0 US)
Wirtspflanzen: Prunus avium, P. cerasus; weitere Obst- und Zierpflanzen (u. a. Prunus emarginata, P. persica)
dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungbäume, Edelreiser, Unterlagen; durch Vektoren, wie z. B. die Knospenmilbe
Eriophyes inaequalis; durch Wurzelverwachsungen
Symptome: unregelmäßige Blattflecken („Sprenkelungen“), Blattchlorosen: gelblich-grüne Bereiche und Flecken
erscheinen häufig im intervenalen Gewebe und entlang der Adern, Blattdeformation/Blattverzerrung zu Beginn
der Saison; kleinere Blätter und „Schrotschußeffekt“ möglich; zudem vermindertes Wachstum, rosettenartiges
Aussehen der Triebe, in einigen Fällen Ausbildung kleinerer geschmackarmer Früchte;
deutliche Symptomausprägung bei den Süßkirschsorten ‚Bing‘, ‚Royal Ann‘ und ‚Lambert‘
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen und Vektoren zu verringern; Einsatz
von geeigneten Insektiziden während der Vegetationszeit zum Schutz vor Vektoren (Objektschutz)
Seite 6 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Cherry necrotic rusty mottle virus (Nekrotisches Rostfleckenvirus der
Kirsche)
Regelung: RNQP an Prunus avium, Prunus cerasus
Symptome an Blättern
Foto: M. Petruschke, LTZ Augustenberg
Wirtspflanzen: Prunus avium, P. cerasus; weitere Obst- und Zierpflanzen (u. a. Prunus cerasoides, P. persica,
Rosa brunonii) dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; durch Wurzelverwachsungen; eine Übertragung
durch Vektoren wurde bisher nicht nachgewiesen
Symptome: unregelmäßige und späte Blatt- und Blütenknospenentwicklung, in anderen Fällen öffnen sich
Knospen an den Endtrieben nicht, schwellen an und sterben im Anschluss ab;
Nekrotische Blattflecken zu einem späteren Zeitpunkt gelbliche Zwischenfleckigkeit bei älteren Blättern sowie
Entwicklung von violetten und schokoladenfarbenen Flecken, die sich im Anschluss braun färben final
zerfurchtes und zerrissenes Aussehen von Blättern, aufgrund des Herauslösens nekrotischer Blattrandbereiche
vom Rest des Blattes; in einigen Fällen Absterben von Zweigen und größeren Ästen; Bäume können absterben;
latenter Befall bei P. salicina; deutliche Symptomausprägung bei den Süßkirschsorten ‚Corum‘ und ‚Lambert‘
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode
Verwechslung: mit der Schrotschusskrankheit (verursacht durch den Pilz Wilsonomyces carpophilus), mit
anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen zu verringern
Seite 7 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Little cherry virus 1 und 2 (Viröse Kleinfrüchtigkeit der Kirsche)
Regelung: RNQP an Prunus avium, Prunus cerasus
Befall in Obstanlage gesund
befallen
Foto: M. Kockerols, Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V. Foto: V. Zahn, LWK Niedersachsen Foto: L. Kunze BBA, Dossenheim (DE), gd.eppo.int
Wirtspflanzen: Prunus avium, P. cerasus; weitere Obst- und Zierpflanzen der Gattung Prunus (u. a. Prunus
armeniaca, P. dulcis, P. domestica, P. serrula, P. tomentosa) dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; durch Wurzelverwachsungen; durch Vektoren
(Insekten), wie z. B. der Ahornschmierlaus (Phenacoccus aceris)
Symptome: vorzeitige Rot- oder Bronzefärbung der Interkostalfelder (Blätter) im Spätsommer, Symptome an
Blättern besonders stark nach trockenen Jahren ausgeprägt; einzelne Äste bis hin zum ganzen Baum können
befallen sein; Wuchsminderung; kleine, deformierte (dreieckig geformte) Früchte die leicht bitter schmecken,
Fruchtverkrüppelung; Little cherry virus 1 ist im Gegensatz zum Little cherry virus 2 meist latent, ohne
signifikante Auswirkungen auf Ertrag und Qualität der Früchte zu haben; deutliche Symptomausprägung bei der
Süßkirschensorte ‚Regina‘
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, bevorzugt im Spätsommer/Herbst
Verwechslung: mit Symptomen die aufgrund von Trockenstress entstehen
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen und Vektoren zu verringern; Einsatz
von geeigneten Insektiziden während der Vegetationszeit zum Schutz vor Vektoren (Objektschutz)
Rot- und Bronzefärbungen der Interkostalfelder bei Blättern
Fotos: M. Kockerols, Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V. Fotos: M. Petruschke, LTZ Augustenberg
Seite 8 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Peach latent mosaic viroid (Latentes Pfirsichmosaikviroid)
Regelung: RNQP an Prunus persica
Symptome an Pfirsichbäumen Symptome an Pfirsichblättern
Fotos: R. Flores, Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos, Bugwood.org (CC BY-NC 3.0 US)
Wirtspflanzen: Prunus persica; weitere Gehölze (andere Prunus-Arten, Malus, Pyrus) dienen als Wirte (aber
keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; durch Wurzelverwachsungen; durch Pollen und
Vektoren, wie z. B. der Grünen Pfirsichblattlaus (Myzus persicae)
Symptome: Blattflecken, Blattmosaik, Aderstreifen; rosa gestreifte Blütenblätter; verzögerte Triebentwicklung;
nekrotische Äste; Verfärbung der Rinde; vorzeitiges Altern der Pflanze; Ertragsminderung bei Früchten,
Fruchtdeformation: unförmige, verfärbte Früchte, mit rissigen Nähten und geschwollenen rundlichen Steinen;
latenter Befall bei Mandel und einigen andere Prunus-Arten, sowie bei (Wild-)Birne
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, bevorzugt im Spätsommer/Herbst
Verwechslung: mit Symptomen die aufgrund von Trockenstress entstehen; mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen und Vektoren zu verringern; Einsatz
von geeigneten Insektiziden während der Vegetationszeit zum Schutz vor Vektoren (Objektschutz); Blüten in
Vermehrungsbeständen durch entsprechende Pflegemaßnahmen vermeiden
Symptome an Früchten
Foto: R. Flores, Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos, Bugwood.org
(CC BY-NC 3.0 US)
Seite 9 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Plum pox virus (Scharka-Virus)
Regelung: RNQP an Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasifera, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis,
P. persica, P. salicina; im Fall von Prunus-Hybriden, bei denen Material auf Unterlagen gepfropft wird, andere
Arten von Prunus L.-Unterlagen, die anfällig für Plum pox virus sind.
hellgelbe bis hellgrüne hellgrüne Flecken, Ringe,
Flecken, Ringe, Bänderungen Bänderungen an Pfirsich
an Pflaumen-Blätter
rotbraune Umrandungen
der Flecken
Foto: M. Petruschke, LTZ Augustenberg
Fotos: Biologische Bundesanstalt (DE), gd.eppo.int
Wirtspflanzen: Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasifera, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica,
P. salicina; weitere Obst- und Zierpflanzen der Gattung Prunus (u. a. Prunus japanica, P. pumila, P. sibirica, P.
simonii, P. spinosa, P. tomentosa, P. triloba) dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; möglicherweise durch Wurzelverwachsungen;
durch Vektoren Hauptübertragungsweg, diverse Blattläuse, u. a. Grüne Zitrusblattlaus (Aphis spiraecola),
Kleine und Große Zwetschgenblattlaus (Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus cardui), Grüne Pfirischblattlaus
(Myzus persicae), Hopfenblattlaus (Phorodon humuli)
Symptome: Blätter: verwaschene hellgelbe bis hellgrüne Flecken, Ringe oder Bänderungen, zudem gegen Ende
des Sommers Ausbildung von rotbraunen Umrandungen der Flecken möglich, Verformung der Blattspreiten
und/oder -rändern mit häufig auftretenden braunen, nekrotischen Flecken bei empfindlichen Sorten; in seltenen
Fällen streifenförmige Verfärbung von Blütenblättern bei bestimmten Pfirsichsorten; (längliches) Aufreißen/
Aufplatzen der Rinde Rindennekrosen Absterben des Baumes möglich; Symptome sind häufig auf
bestimmte Teile der Pflanze begrenzt
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, bevorzugt Mitte Juni bis September
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten, wie dem Apple chlorotic leaf spot virus oder Prunde dwarf virus
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen und Vektoren zu verringern; Einsatz
von geeigneten Insektiziden während der Vegetationszeit zum Schutz vor Vektoren (Objektschutz)
Anforderungen für zertifiziertes Material und CAC-Material an die Produktionsfläche (nach RL 2014/98/EU):
Mindestens eine der folgenden besonderen Anforderungen (A1 oder A2) muss erfüllt sein:
A1: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden keine Symptome des Plum pox virus auf
der Produktionsfläche festgestellt, und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe (z. B. in einer angrenzenden
Hecke oder einem angrenzenden Hausgarten), die Symptome aufwiesen, wurden entfernt und unverzüglich
vernichtet.
A2: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden Symptome des Plum pox virus an
höchstens 1% der Pflanzen auf der Produktionsfläche festgestellt; symptomatische Pflanzen auf der
Produktionsfläche sowie in der Umgebung wurden entfernt und unverzüglich vernichtet; in einer repräsentativen
Probe der symptomfreien Pflanzen dieser Produktionsfläche konnte das Plum pox virus nicht nachgewiesen
werden
Seite 10 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Prune dwarf virus (Verzwergungsvirus der Pflaume)
Regelung: RNQP an Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica,
P. salicina
Schrotschuss-
Blattdeformationen hellgrüne ringförmige Blattflecken Symptome
Fotos: M. Petruschke, LTZ Augustenberg Fotos: Darko Jevremovic, Fruit Research Institute (RS), gd.eppo.int
Wirtspflanzen: Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina; weitere
Obst- und Zierpflanzen der Gattung Prunus (u. a. Prunus pumila, P. sibirica, P. simonii, P. spinosa, P.
tomentosa, P. triloba) dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; möglicherweise durch Wurzelverwachsungen;
durch Pollen
Symptome: Blätter: je nach Sorte können verschiedene Symptome hervorgerufen werden u. a. verwaschene
hellgrüne ringförmige Flecken, Blattnekrosen, Blattdeformationen, Absterben von nekrotischem Blattgewebe
bringt schrotschussähnliche Symptome hervor, auch schmale, verlängerte Blätter sind möglich, die mehr oder
weniger gefurcht und gefaltet sind oder unregelmäßig Ränder aufweisen können, häufig verdickte, brüchige
Blattspreiten, rosettenartig angeordnete, verlängerte Blätter, Symptome können auf einen Teil des Baumes
beschränkt sein; auch Triebstauchung und Zwergwuchs sind möglich; reduzierter Ernteertrag, aber keine
Fruchtqualitätsminderung; deutliche Symptomausprägung bei der Zwetschgensorte ‚Fellenberg‘
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, bevorzugt in den Frühlingsmonaten
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten wie Plum pox virus oder Apple chlorotic leaf spot virus
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen), ausreichenden Abstand
von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit Wirtspflanzen)
einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen und Pollenflug zu verringern; Blüten
in Vermehrungsbeständen durch entsprechende Pflegemaßnahmen vermeiden
Seite 11 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Prunus necrotic ringspot virus (Nekrotisches Ringfleckenvirus des
Steinobstes)
Regelung: RNQP an Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica,
P. salicina
hellgrüne Ringe und Flecken nekrotische Blattflecken mit
Schrotschuss-Symptomen
Fotos: M. Petruschke, LTZ Augustenberg
Wirtspflanzen: Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina; weitere
Obst- und Zierpflanzen (u. a. Malus domestica, Morus alba, Morus rubra, Rosa multiflora) dienen als Wirte (aber
keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen, Samen; durch Wurzelverwachsungen; lokal
durch Vektoren (Nematode) Longidorus macrosoma (auch als RNQP gelistet!); durch Pollen
Symptome: hellgrüne und braune Ringe sowie nekrotische Blattflecken, die ausbrechen Schrotschuss-
Symptome bei älteren Blättern; Verkümmern von Blüten- und Blattknospen; Wuchsminderung bei
Mischinfektionen (z. B. bei gleichzeitiger Infektion mit dem Prune dwarf virus); auch: Gummifluss, kleine und
gerollte Blätter, Blatt- und Blütenrosetten, verkürzte Blütenstiele; deutliche Symptomausprägung bei den
Sauerkirschsorten ‚Heimanns Rubinweichsel‘ und ‚Beutelspacher Rexelle‘
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten wie z. B. Prune dwarf virus oder Plum pox virus
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen und benachbarte
Pflanzen sofort roden und mit Wurzeln aus dem Bestand entfernen
vorbeugend: Verwendung von befallsfreiem Ausgangsmaterial (Edelreiser, Unterlagen, Samen); ausreichenden
Abstand von Vermehrungsflächen zu Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen, Hecken mit
Wirtspflanzen) einhalten, um Übertragungswahrscheinlichkeit durch Wurzelverwachsungen, Nematoden und
Pollenflug zu verringern; Blüten in Vermehrungsbeständen durch entsprechende Pflegemaßnahmen vermeiden
hellgrüne Ringe
nekrotische Blattflecken mit
Schrotschuss-Symptomen
Foto: M. Petruschke, LTZ Augustenberg
Fotos: J. Hinrichs-Berger, LTZ Augustenberg
Seite 12 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
American plum line pattern virus (Amerikanisches Pflaumenbandmosaikvirus)
Regelung: Unionsquarantäneschädling
Symptome an Pfirsich Symptome an Pflaume
Fotos: A. Myrta, IAM Bari (IT)., gd.eppo.int
Wirtspflanzen: Prunus, u. a.
Vorkommen: Europa: Albanien, Italien; Argentinien, Libanon, Neuseeland, in einigen Teilen Nordamerikas,
Südkorea
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen
Symptome: bei P. salicina: zunächst chlorotisches Ring- und Eichenblattmuster, dann gelbe Aderbänderung
zudem verblasst die Gelbfärbung im Sommer zu einem Cremeweiß, neugebildete Blätter können symptomlos
sein, in anderen Fällen werden die Blattränder zunächst chlorotisch und färben sich später golden;
bei P. persica zunächst unregelmäßige blassgrüne gewellte Bänder, die sich zu einen Netz aus feinen,
goldfarbenen Linien, zusammenfließenden Ringen, zu Aderstreifen oder einem Eichenblattmuster entwickeln
können Symptome verschwinden unter normalen Umständen im Sommer wieder;
bei P. serrulata weißliche, gelbliche oder rosa verfärbte Blattbereiche, mit großem Ring- oder Eichenblattmuster,
Blattränder können von leicht chlorotisch bis stark golden oder weiß gefärbt variieren
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten, wie z. B. mit dem Apple mosaic virus oder dem Prunus necrotic
ringspot virus
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen:
Der Schädling ist meldepflichtig!
Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Pflanzenschutzdienstes!
Gegebenenfalls befallene Pflanzen in geschlossenen Behältnissen über den Restmüll entsorgen bzw.
verbrennen
Blattsymptome an P. salicina in der Vegetation
im
im Frühling im Sommer Spätsommer
Fotos: A. Myrta, IAM Bari (IT)., gd.eppo.int
Seite 13 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Cherry rasp leaf virus (Rauhblättrigkeit der Kirsche)
Regelung: Unionsquarantäneschädling
gefaltete, verzerrte Enationen - Blattunterseite
Blätter
gefaltete Blätter bei Malus
Foto: R. Stace-Smith, Foto: William M. Brown Jr., Bugwood.org (CC BY 3.0 US) Foto: H.J. Larsen, Bugwood.org (CC BY 3.0 US)
Bugwood.org
(CC BY-NC 3.0 US)
Wirtspflanzen: Cucurbita maxima, Gomphrena globosa, Malus domestica, Malva, Ocimum
basilicum, Prunus avium, P. mahaleb, P. persica, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Solanum
lypersicum, S. tuberosum, u. a.
Vorkommen: Kanada (British Columbia), in einigen Teilen der USA, China (Liaoning, Shandong)
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; lokal auch natürliche Ausbreitung
durch Vektoren, Nematoden der Gattung Xiphinema
Symptome: Enationen auf der Blattunterseite, d. h. belaubte Auswüchse und hervorgehobene
Ausstülpungen zwischen den Seitenadern und entlang der Mittelrippe; Blattoberseite ist im
Gegenzug rau und besitzt eine kieselige Textur mit Vertiefungen; schmale, gefaltete und verzerrte
Blätter; Frühinfektion ist meist auf die unteren Äste beschränkt; stark betroffene Äste und junge
Bäume können absterben; reduzierte Fruchtproduktion
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, Früchte sind im Handel ganzjährig bzw.
saisonal kontrollierbar
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen:
Der Schädling ist meldepflichtig!
Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Pflanzenschutzdienstes!
Gegebenenfalls befallene Pflanzen in geschlossenen Behältnissen über den Restmüll entsorgen
bzw. verbrennen
Seite 14 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Peach mosaic virus (Pfirsichmosaikvirus)
Regelung: Unionsquarantäneschädling
Blattsymptome
Blattsymptome
Fotos: H.J. Larsen, Bugwood.org (CC BY 3.0 US)
Wirtspflanzen: Prunus (v. a. P. persica, befällt jedoch keine Kirscharten)
Vorkommen: Mexiko, USA
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; lokal durch den Vektor
Pfirischknospenmilbe (Eriophyes insidiosus)
Symptome: Blattmosaik, Blattflecken, Blattnekrosen, Blattkräuseln, Knospennekrose,
Stammfurchen/-löcher (Stem Pitting), rosa-gestrichelte Blütenblätter während wärmeren Phasen,
Fruchtanomalien (flachere, farbarme/blasse Früchte mit rissigen Nähten und vergrößerten
Kernen)
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, Früchte sind im Handel ganzjährig bzw.
saisonal kontrollierbar
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen:
Der Schädling ist meldepflichtig!
Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Pflanzenschutzdienstes!
Gegebenenfalls befallene Pflanzen in geschlossenen Behältnissen über den Restmüll entsorgen
bzw. verbrennen.
Rosetten-Symptome
Pfirsich
befallen
gesund
Blütensymptome
Fotos: H.J. Larsen, Bugwood.org (CC BY 3.0 US)
Seite 15 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Peach rosette mosaic virus (Pfirsichrosettenmosaikvirus)
Regelung: Unionsquarantäneschädling
Blattsymptome an Pfirsich befallene Weinrebe
Fotos: W.R. Allen, Agriculture and Agri-Food Canada, Bugwood.org (CC BY-NC 3.0 US)
Wirtspflanzen: Prunus (v.a. P. persica), Rumex crispus, Taraxacum officinale, Vitis
Vorkommen: Ägypten, Türkei, Kanada (Ontario), USA (Michigan, West Virginia)
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; lokal durch Vektoren, diverse
Nematoden-Spezies, u. a. Criconemoides xenoplax, Longidorus elongatus
Symptome: bei Prunus persica: Blattmosaik, Rosettenbildung, verkürzte Internodien;
bei Vitis: Blattdeformation, verkürzte Stockinternodien und schiefes Stockwachstum
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, Früchte sind im Handel ganzjährig bzw.
saisonal kontrollierbar
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen:
Der Schädling ist meldepflichtig!
Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Pflanzenschutzdienstes!
Gegebenenfalls befallene Pflanzen in geschlossenen Behältnissen über den Restmüll entsorgen
bzw. verbrennen.
Seite 16 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Tomato ringspot virus (Tomatenringfleckenvirus)
Regelung: Unionsquarantäneschädling
Inkompatibilität an der Veredlungsstelle Anomalien an Veredlungsstelle bei Pfirsich
bei Aprikose verursacht durch Tomato verursacht durch Tomato ringspot virus
ringspot virus
Fotos: H.J. Larsen, Bugwood.org (CC BY 3.0 US) Foto: I.M. Smith, EPPO, Bugwood.org (CC BY-NC 3.0 US)
Wirtspflanzen: Fragaria x ananassa, Malus, Pelargonium (v. a. Pelargonium x hortorum), Prunus
(v. a. P. persica), Pyrus communis, Rubus (v. a. R. idaeus), Solanum lypersicum, S. tuberosum,
Vaccinium corymbosum, Vitis vinifera, u. a.
Vorkommen: Deutschland, weitere europäische Länder, auf allen Kontinenten
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; lokal auch natürliche Ausbreitung
durch Vektoren, Nematoden der Gattung Xiphinema
Symptome: Eindellungen und Nekrosen an den Veredlungsstellen, Blattnekrosen,
Blattdeformationen, Blattverfärbungen: in speziellen Fällen kreisförmige Blattmuster, u. a. bei
Capsicum, Rubus und Solanum
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, Früchte sind im Handel ganzjährig bzw.
saisonal kontrollierbar
Verwechslung: mit anderen Viruskrankheiten
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen:
Der Schädling ist meldepflichtig!
Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Pflanzenschutzdienstes!
Gegebenenfalls befallene Pflanzen in geschlossenen Behältnissen über den Restmüll entsorgen
bzw. verbrennen.
Blattsymptome an Pelargonium
Fruchtsymptome an Tomate
Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org Foto: State Plant Pathology Institute of Denmark , Bugwood.org
(CC BY-NC 3.0 US) (CC BY-NC 3.0 US)
Seite 17 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Agrobacterium tumefaciens (Wurzelkrebs, Wurzelkropf)
Regelung: RNQP an Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus,
P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina, Pyrus, Vaccinium
krebsartige Wucherungen
Foto: D. Mernke, LTZ Augustenberg Foto: Cheryl Kaiser, University of Kentucky, Foto: E. Moltmann, MRL
Bugwood.org (CC BY-NC 3.0 US)
Wirtspflanzen: Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica,
P. dulcis, P. persica, P. salicina, Pyrus, Vaccinium; weitere Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen (u. a. Brassica
oleracea var. italica, Mangifera indica, Musa x paradisiaca, Rosa, Vitis vinifera) dienen als Wirte (aber keine
RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungpflanzen, Unterlagen; durch Boden; durch Wurzelverwachsungen; durch
Pflegemaßnahmen (Baumschnitt, Veredelungen); Eindringen des Bakteriums hauptsächlich durch Wunden
Symptome: krebsartige (zerklüftete, kropfartige) Wucherungen an den Wurzeln und/oder am Wurzelhalsbereich,
teilweise auch Befall von oberirdischen Pflanzenteilen; Mangelerscheinungen durch unzureichende
Nährstoffversorgung verkümmertes Wachstum
Beobachtungszeitraum: Wucherungen an den Wurzeln / am Stammhals sind ganzjährig sichtbar; in der zweiten
Hälfte der Vegetationsperiode kann ggf. Kümmerwachstum beobachtet werden
Verwechslung: Wucherungen mit Blutlauskrebs, in seltenen Fällen auch mit individuellen atypischen
Wachstumsänderungen möglich; Kümmerwachstum kann zahlreiche andere Ursachen haben
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen sofort roden und mit
Wurzeln aus dem Bestand entfernen; benachbarte Pflanzen ebenfalls sofort roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: Hygienemaßnahmen einhalten (u. a. sachgemäße Desinfektion von Schnittwerkzeug und
Gerätschaften), optimale Kulturbedingungen herstellen, um kräftige und widerstandsfähige Pflanzen zu
gewährleisten; Staunässe und schwere tonreiche Böden meiden, ehemalige Befallsflächen als
Produktionsflächen meiden
Seite 18 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Bakterienbrand des Steinobsts)
Regelung: RNQP an Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica,
P. salicina
Schrotschuss-Symptome Rindennekrose
Foto: J. Hinrichs-Berger, Foto: M. Soltysek, LTZ Augustenberg Foto: J. Hinrichs-Berger, Foto: D. Mernke, LTZ Augustenberg
LTZ Augustenberg LTZ Augustenberg
Wirtspflanzen: Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. persica, P. salicina
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Edelreiser, Jungbäume, Unterlagen; durch Pflegemaßnahmen (Baumschnitt,
Veredelungen); durch Vektoren (Insekten); durch natürliche Infektion: Bakterium, epiphytisch, ist weit verbreitet,
verweilt auf Pflanzenoberflächen ohne zunächst Schäden zu verursachen Übertragung durch Wind, über
Wassertröpfchen Eindringen durch Wunden (Schnitt, Frostrisse, Hagel) und/oder natürliche
Pflanzenöffnungen (Stomata, Blüten)
Symptome: Blätter: Blütensterben; fahlgrüne Blattfärbung, Welke/Verbraunung, Absterben der Blätter meist
ohne Blattfall, zudem Schrotschuss-Symtome
Stamm/Äste: Trieb- und Stammnekrosen (Rindenbrand/Canker) rotbraune Einsenkung der Rinde, zudem
hellgrün-braune Marmorierung im Übergangsbereich des Rindenbrandes zum nicht geschädigten Gewebe (Indiz
für einen aktiven Pseudomonas-Befall), Aufreißen und Absterben der Rinde zudem pergamentartiges
Abheben der äußeren Rindenschicht, verstärkter Gummifluss; Stockausschlag kurz vor dem Absterben;
latenter Befall ist möglich
Beobachtungszeitraum: hauptsächlich während der Vegetationsperiode, Symptome am Holz ganzjährig
Verwechslung: mit Symptomen verursacht durch diverse Pilzarten, wie z. B. durch Monilia („Blüteninfektion“);
oder Neonectria ditissima (Obstbaumkrebs Rindenbrand); mit Symptomen, die bei Trockenstress entstehen;
mit Symptomen, die durch andere Pathovaren von Pseudomonas syringae und/oder durch fungale
Schrotschusserreger hervorgerufen werden
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzenteile großzügig
abschneiden, bei stärkerem Befall (insbesondere am Stamm) ganze Pflanzen roden und aus dem Bestand
entfernen
vorbeugend: sachgemäße Desinfektion von
Schnittwerkzeug und Gerätschaften; weißeln der Stämme,
um Frostrisse am Holz zu vermeiden (über die
Astnekrose
Pseudomonas eindringt); unkrautfreie
Vermehrungsbestände etablieren; Vermehrungsflächen
nicht in frostgefährdeten und feuchten Lagen anlegen;
Schnittmaßnahmen während trockener Phasen
durchführen; angepasste Stickstoffdüngung (eher etwas
weniger); vorbeugender Einsatz von Kupferpräparaten je
nach Infektionsdruck (Objektschutz)
Foto: D. Mernke, LTZ Augustenberg
Seite 19 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Pseudomonas syringae pv. persicae (Bakterienbrand des Pfirsichs)
Regelung: RNQP an Prunus persica, P. salicina (Samen ausgenommen)
Blattflecken Symptome an Frucht
Foto: INRA, Angers (FR), gd.eppo.int Foto: Ebrahim Osdaghi, gd.eppo.int
Wirtspflanzen: Prunus persica, P. salicina
Vorkommen: Frankreich, Kroatien, Neuseeland
Ausbreitungswege: durch Jungpflanzen; durch Pflegemaßnahmen (Baumschnitt, Veredelungen); durch
Vektoren (Insekten); durch natürliche Infektion: Bakterium, epiphytisch, ist weit verbreitet, verweilt auf
Pflanzenoberflächen ohne zunächst Schäden zu verursachen Übertragung durch Wind, über
Wassertröpfchen Eindringen durch Wunden (Schnitt, Frostrisse, Hagel) und/oder natürliche
Pflanzenöffnungen (Stomata, Blüten)
Symptome: Blätter: nekrotische runde Blattflecken (1-2 mm) bei jungen Blättern abgestorbenes Gewebe fällt
raus Schrotschuss-Symptome; Welke; Absterben der Blätter mit frühzeitigem Blattfall
Stamm/Äste: olivgrüne Verfärbung der Rinde von jungen Trieben während der Wintermonate, die sich
anschließend braun färbt; im Frühjahr: Absterben einzelner Knospen und Triebe bis hin zum Welken und
Absterben von Hauptästen oder der gesamten Pflanze; Trieb- und Stammnekrosen (rotbraune Verfärbung des
Gewebes am Stamm erscheinen Läsionen mit undeutlichen Rändern)
Beobachtungszeitraum: hauptsächlich während der Vegetationsperiode, Symptome am Holz ganzjährig
Verwechslung: mit Symptomen, die durch andere Pathovaren von Pseudomonas syringae, die durch
Xanthomonas arbolicola pv. pruni oder die durch fungale Schrotschusserreger hervorgerufen werden
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: bei Befall ganze Pflanzen roden und aus
dem Bestand entfernen
vorbeugend: sachgemäße Desinfektion von Schnittwerkzeug und Gerätschaften; Vermehrungsflächen nicht in
frostgefährdeten und feuchten Lagen anlegen; Schnittmaßnahmen während trockener Phasen durchführen;
angepasste Stickstoffdüngung (eher etwas weniger); vorbeugender Einsatz von Kupferpräparaten je nach
Infektionsdruck (Objektschutz)
Anforderungen für zertifiziertes Material und CAC-Material an die Produktionsfläche (nach RL 2014/98/EU):
Mindestens eine der folgenden besonderen Anforderungen (A1 oder A2) muss erfüllt sein:
A1: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden keine Symptome von Pseudomonas
syringae pv. persicae an Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten auf der Produktionsfläche
festgestellt; jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen wurden entfernt und unverzüglich
vernichtet.
A2: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden an höchstens 2% des
Vermehrungsmaterials und der Pflanzen von Obstarten auf der Produktionsfläche Symptome von Pseudomonas
syringae pv. persicae festgestellt, dieses Vermehrungsmaterial und diese Pflanzen von Obstarten sowie jegliche
Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, wurden entfernt und unverzüglich vernichtet.
Seite 20 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Pseudomonas syringae pv. syringae (Bakterienbrand)
Regelung: RNQP an Cydonia oblonga, Malus, Prunus armeniaca, Pyrus
Rindenbrand Blüteninfektion
Fotos: R. Zühlke, Gartenbau Beratungs GmbH Fotos: J. Hinrichs-Berger und D. Mernke, LTZ Augustenberg
Wirtspflanzen: Cydonia oblonga, Malus, Prunus armeniaca, Pyrus; weitere Obst- und Zierpflanzen (u. a. weitere
Prunus- und Syringa-Arten) dienen als Wirte (aber keine RNQP-Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungpflanzen; durch Pflegemaßnahmen (Baumschnitt, Veredelungen); durch
Vektoren (Insekten); durch natürliche Infektion: Bakterium, epiphytisch, ist weit verbreitet, verweilt auf
Pflanzenoberflächen ohne zunächst Schäden zu verursachen Übertragung durch Wind, über
Wassertröpfchen Eindringen durch Wunden (Schnitt, Frostrisse, Hagel) und/oder natürliche
Pflanzenöffnungen (Stomata, Blüten)
Symptome an Blättern/Blüten: Blütensterben; fahlgrüne Blattfärbung, Welke/Verbräunung, Absterben der Blätter
meist ohne Blattfall
Symptome am Stamm / an Ästen: Trieb- und Stammnekrosen (Rindenbrand/Canker) rotbraune Einsenkung
der Rinde; pergamentartiges Abheben der äußeren Rindenschicht; Aufreißen und Absterben der Rinde;
hellgrün-braune Marmorierung im Gewebe unter der Borke im Übergangsbereich des Rindenbrandes zum nicht
geschädigten Gewebe deuten auf einen aktiven Pseudomonas-Befall hin; verstärkter Gummifluss an Prunus;
Stockausschlag kurz vor dem Absterben; auch latenter Befall ist möglich!
Beobachtungszeitraum: hauptsächlich während der Vegetationsperiode, Symptome am Holz ganzjährig
Verwechslung: mit Symptomen verursacht durch diverse Pilzarten, wie z. B. durch Monilia („Blüteninfektion“);
und Neonectria ditissima („Obstbaumkrebs“ Rindenbrand); mit Trockenschäden
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: befallene Pflanzen roden und aus dem
Bestand entfernen
vorbeugend: sachgemäße Desinfektion von Schnittwerkzeug und Gerätschaften; weißeln der Stämme, um
Frostrisse am Holz zu vermeiden (über die Pseudomonas eindringt); Vermehrungsflächen nicht in
frostgefährdeten und feuchten Lagen anlegen; Schnittmaßnahmen während trockener Phasen durchführen;
angepasste Stickstoffdüngung (eher etwas weniger); vorbeugender Einsatz von Kupferpräparaten je nach
Infektionsdruck (Objektschutz)
welke Triebspitze über Nekrose und rostartige
Nekrose Orangefärbung
Gummifluss
Fotos: Pflanzenschutzdienst Baden-Württemberg
Seite 21 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Fleckenbakteriose an Steinobst)
Regelung: RNQP an Prunus amygdalus, P. armeniaca, p. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica,
P. salicina (Samen ausgenommen)
Blattflecken Schrotschuss- Läsionen Läsionen und
ähnliche Löcher Blattflecken
Blattflecken
Fotos: U. Mazzucchi, Universita degli Studi, Bologna (IT)., gd.eppo.int Fotos: Miguel Cambra Álvarez (CPV-Government of Aragón, Spain),
gd.eppo.int
Wirtspflanzen: RNQP an Prunus amygdalus, P. armeniaca, p. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica,
P. salicina; weitere Prunus-Arten, wie P. davidiana und P. laurocerasus dienen als Wirte (aber keine RNQP-
Regelung)
Vorkommen: Deutschland und weitere Länder
Ausbreitungswege: durch Jungpflanzen; durch Pflegemaßnahmen (Baumschnitt, Veredelungen); durch
Vektoren (Insekten), durch natürliche Infektion: Bakterium, epiphytisch, ist weit verbreitet, verweilt auf
Pflanzenoberflächen ohne zunächst Schäden zu verursachen Übertragung durch Wind, Aerosole oder
Wassertröpfchen Eindringen durch Wunden (Schnitt, Frostrisse, Hagel) und/oder natürliche
Pflanzenöffnungen (Stomata, Blüten, Lentizellen)
Symptome: Blätter: initiale kleine, blassgrüne bis gelbe, kreisrunde und unregelmäßige Flecken an der
Blattunterseite, später erscheinen violette, braune und schwarze Flecken auf der Blattoberseite Gewebe stirbt
ab und es entstehen schrotschussähnliche Löcher in den Blättern; vorzeitiger Laubfall bei geschwächten
Gehölzen möglich; oberflächennahe, längliche, braune Läsionen an Trieben und Ästen, die später einsinken,
zudem Gummifluss Entstehen von Canker an Zweigen, Ästen und Stamm
Beobachtungszeitraum: während der Vegetationsperiode, Symptome am Holz ganzjährig
Verwechslung: u. a. mit Pseudomonas syringae; mit Blattsymptomen, die durch fungale Schrotschusserreger
ausgelöst werden
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen in Vermehrungsbeständen: bei Befall ganze Pflanzen roden und aus
dem Bestand entfernen;
vorbeugend: sachgemäße Desinfektion von Schnittwerkzeug und Gerätschaften, vorbeugender Einsatz von
Kupferpräparaten, Produktionsflächen nicht in der Nähe von Infektionsquellen (Streuobst, Erwerbsobstanlagen)
betreiben
Anforderungen für zertifiziertes Material und CAC-Material an die Produktionsfläche (nach RL 2014/98/EU):
Mindestens eine der folgenden besonderen Anforderungen (A1 oder A2) muss erfüllt sein:
A1: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden keine Symptome von Xanthomonas
arbolicola pv. pruni an Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten auf der Produktionsfläche festgestellt;
jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen wurden entfernt und unverzüglich vernichtet.
A2: Während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden an höchstens 2% des
Vermehrungsmaterials und der Pflanzen von Obstarten auf der Produktionsfläche Symptome von Xanthomonas
arbolicola pv. pruni festgestellt, dieses Vermehrungsmaterial und diese Pflanzen von Obstarten sowie jegliche
Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, wurden entfernt und unverzüglich vernichtet.
Seite 22 von 37Geregelte Schädlinge an Steinobst
Xylella fastidiosa (Feuerbakterium)
Regelung: prioritärer Unionsquarantäneschädling
Blattsymptome an Kirsche
Fotos: Donato Boscia, CNR - Institute for Sustainable Plant Protection, UOS, Bari (IT), gd.eppo.int
Wirtspflanzen: > 300 Arten, darunter Ficus carica, Juglans regia, Morus, Prunus, Vaccinium, Vitis
Vorkommen: Europa: Frankreich, Italien, Portugal, Spanien; Iran, Israel, Nord- und Südamerika,
Taiwan
Ausbreitungswege: zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, im Bestand und lokal durch Vektoren
(z. B. Wiesenschaumzikade); weitere Übertragungswege (z. B. Schnittwerkzeuge) sind denkbar
Symptome: Das Bakterium verstopft die Leitungsbahnen (Xylem) und schränkt so den Transport
von Wasser und Nährstoffen ein. Dadurch kann es zu Vergilbungen, Verbräunungen, Welke und
dem Absterben von Blättern, Trieben und ganzen Pflanzen kommen. Häufig sind die Symptome
nicht direkt nach dem Befall sichtbar, sondern erst Monate später. Bereits in dieser Zeit können
Bakterien von infizierten Pflanzen durch Vektoren auf gesunde Pflanzen übertragen werden.
Beobachtungszeitraum: vorzugsweise Hoch- und Spätsommer
Verwechselung: mit einigen anderen Schadursachen sehr leicht möglich, z. B. mit Symptomen die
durch Wassermangel/Trockenstress hervorgerufen werden
Empfohlene Pflanzenschutzmaßnahmen:
Der Schädling ist meldepflichtig!
Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Pflanzenschutzdienstes!
Gegebenenfalls befallene Pflanzen in geschlossenen Behältnissen über den Restmüll entsorgen
oder verbrennen
Symptome an Mandel (Prunus dulcis) Blattsymptome an Mandel
Foto: Céline Vidal, gd.eppo.int Fotos: Donato Boscia, CNR - Institute for Sustainable Plant Protection, UOS, Bari (IT),
gd.eppo.int
Seite 23 von 37Sie können auch lesen