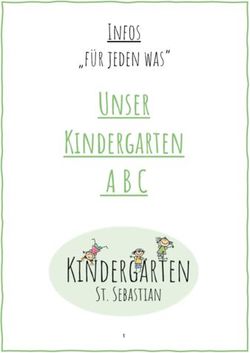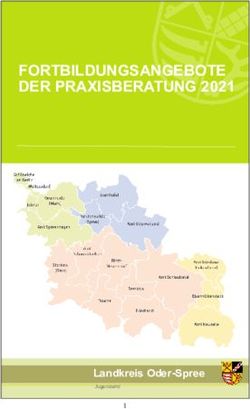Gertrud Hovestadt Wie setzen die Bundesländer den Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen um? Vom Gesetz zur Praxis - Eine Studie im Auftrag ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gertrud Hovestadt
Wie setzen die Bundesländer den Bildungsauftrag der
Kindertageseinrichtungen um?
Vom Gesetz zur Praxis
Eine Studie im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung
November 2003
-1-EDU-CON
Strategic Education Consulting GmbH
Dr. Gertrud Hovestadt
Dr. Peter Stegelmann
Unternehmensberater
Riegelstr. 10
48431 Rheine
Tel. 0049- (0)5971 – 899 54 50
hovestadt@edu-con.de
www.edu-con.de
-2-Inhalt
Einführung Seite 4
Länderberichte 7
Bildungsprogramme 52
Ländervergleich 59
Literatur
-3-Einführung
1990 wurde den Kindertageseinrichtungen mit dem SGB VIII der Auftrag gegeben, Kindern
neben Betreuung und Erziehung auch Bildung anzubieten. Diese Aufgabe ist keineswegs eine
ganz neue. Die Förderung des Kindes war, neben der sozialpolitischen, familienentlastenden
Aufgabe und mit dieser untrennbar verbunden, immer originäre Aufgabe der Kindergärten.
Die Förderungsfunktion soll jedoch stärker betont und deutlicher profiliert werden und die
Kindertageseinrichtungen sollen einen Platz im Bildungssystem einnehmen.
Somit steht der Bildungsauftrag in traditioneller Kontinuität, erfordert gleichwohl eine
grundlegende Reform der Tageseinrichtungen. Der 10. Kinder- und Jugendbericht der
Bundesregierung stellt die Notwendigkeit eines veränderten Leitbildes der
Kindertageseinrichtungen fest (BMFSFJ 1998, S. 189).
§ 22 SGB VIII Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen
Teil des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung des
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert
werden.
(2) Die Aufgabe umfaßt die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der
Kinder und ihrer Familien orientieren.
(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen
Fachkräfte und anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder
zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in
wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen.
Im SGB VIII sind dem allgemeinen Bildungsauftrag zur näheren Bestimmung nur wenige,
ebenfalls allgemein gehaltene Grundsätze beigegeben. Insbesondere soll das
Leistungsangebot pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer
Familien orientiert sein. Damit hebt sich der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen
von dem der Schule deutlich ab. Außerdem war immer unumstritten, dass Betreuung,
Erziehung und Bildung keine additiven Aufgaben, sondern im alltäglichen pädagogischen
Handeln eine Einheit darstellen. Wie aber der Bildungsauftrag darüber hinaus zu definieren
sei hat der Bundesgesetzgeber, der föderalen Aufgabenteilung entsprechend, den
Bundesländern überlassen. Überlassen hat er ihnen auch die Frage, auf welchem Wege der
Bildungsauftrag in den Kindertageseinrichtungen in die Praxis umgesetzt werden soll.
-4-Die Bundesländer bzw. die Landesjugendbehörden und auch die Träger der
Kindertageseinrichtungen waren in den folgenden Jahren überwiegend durch andere
Aufgaben in Anspruch genommen. 1992, also sehr bald nach der Einführung des
Bildungsauftrages, erhielten Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung einen
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser Anspruch erforderte in den alten
Bundesländern unter schwierigen finanziellen Bedingungen den quantitativen Ausbau des
Platzangebotes. In den neuen Bundesländern waren, ebenfalls unter finanziellem Druck, die
Folgen der deutsch-deutschen Vereinigung zu bewältigen. Die sozialpolitische Funktion der
Tageseinrichtungen stand in diesen Jahren im Vordergrund der Entwicklung.
Gegenwärtig sind es vor allem drei Handlungsfelder, mit denen sich die Bundesländer im
Bereich der Kindertagesbetreuung beschäftigen.
Ø Quantitativer Ausbau: Der quantitative Ausbau des Angebotes und seine Finanzierung
beschäftigt weiterhin insbesondere die Länder, die gegenüber dem SGB VIII erweiterte
Rechtsansprüche auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung geschaffen haben.
Damit kann die Kommunalisierung verbunden sein.
Ø Kommunalisierung: In einigen Ländern werden – im Kontext von Reformen in
staatlichen Verwaltungen sowie im Kontext der Leere in den öffentlichen Kassen - die
Zuständigkeiten neu strukturiert. Die Bundesländer verzichten auf die Festlegung
bestimmter Mindeststandards und erweitern damit die Entscheidungsspielräume der
Kommunen. Gleichzeitig schränken die Länder ihre Finanzverantwortlichkeit für die
Kitas zulasten der Kommunen ein.
Ø Realisierung des Bildungsauftrages: Die Realisierung des Bildungsauftrages ist für
sämtliche Bundesländer zu einem Handlungsfeld geworden. Der allgemeine
Bildungsauftrag ist inzwischen in allen Landesgesetzen verankert. In einem zweiten
Schritt richten sich gegenwärtig die Hauptaktivitäten der Bundesländer darauf, den
Bildungsauftrag näher zu bestimmen und zu klären, in welcher Weise er in die Praxis
umgesetzt werden soll. Dabei fällt auf, dass die Länder ganz unterschiedliche Verfahren
gewählt haben, um den Gesetzesauftrag einzulösen.
Die vorliegende Studie gibt einen Überblick über die administrativen Verfahrensweisen der
Bundesländer, mit denen sie den Bildungsauftrag in die Praxis umsetzen wollen.
Im Kapitel I werden die Hauptansatzpunkte der 16 Länder dargestellt. Es wird nicht der
Versuch gemacht, sämtliche Anstrengungen aufzulisten, sondern die Schwerpunkte zu
benennen um somit Strategien erkennbar zu machen.
In Kapitel II werden die bisher vorliegenden Bildungsprogramme mittels formaler Aspekte
vorgestellt. Eine inhaltliche Analyse kann hier nicht geleistet werden.
-5-Kapitel III gibt eine vergleichende Übersicht über die administrativen Verfahrensweisen und
Strategien der Bundesländer.
Die Studie beruht auf der Auswertung von öffentlich zugänglichen Dokumenten sowie
Auskünften der zuständigen Landesministerien, teilweise ergänzt durch Auskünfte anderer
Akteure in den Ländern (Trägerverbände, kommunale Spitzenverbände, Gewerkschaften).
Die Erhebung wurde im Oktober 2003 abgeschlossen.
-6-I. Länderberichte
Die Länderberichte folgen einer gleich bleibenden Systematik. Zunächst werden die
wesentlichen aktuellen Maßnahmen des Landes zur Umsetzung des Bildungsauftrages
genannt. Anschließend werden die Bestimmungen der Kindertagesstättengesetze zur
Ausführung des Bildungsauftrages dokumentiert. Auf die Dokumentation des inzwischen in
Ausführung des SGB VIII in alle Ländergesetze aufgenommenen allgemeinen Auftrages zur
Bildung und seiner Ziele wird verzichtet. Es folgt eine Übersicht über die ministeriellen
Zuständigkeiten im Bereich von Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Schulen
sowie Erzieherinnen- und Lehrerausbildung. Abschließend werden Gesetzestexte und Quellen
genannt.
-7-Baden-Württemberg
Reform der Erzieherinnenausbildung
Die Erzieherinnenausbildung ist neu strukturiert worden: Das Vorpraktikum wird durch den
Besuch des Berufskollegs für Praktikantinnen und Praktikanten ersetzt. Die Praktikantinnen
und Praktikanten erhalten an drei Tagen der Woche Unterricht, an zwei Tagen werden sie in
Einrichtungen praktisch eingesetzt.
Die Lehrpläne für die Erzieherinnenausbildung werden neu gestaltet, u.a. mit dem Ziel, die
Erzieherinnen gezielt auf ihre Bildungsaufgabe vorzubereiten. Der Entwurf ist für das
Frühjahr 2004 zu erwarten.
Bildungsprogramm
Auf Grundlage des §9 Kindergartengesetz ist das aus den 80er Jahren stammende
Förderkonzept „Lebensraum Kindergarten“ in Kraft. Es wird gegenwärtig in Orientierung am
Entwurf des „Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplanes“ durch das Kultusministerium
überarbeitet.
Weitere Entwicklungen
Die Gesetzesnovelle von 2003, die 2004 in Kraft tritt, hatte vor allem die Kommunalisierung
der Finanzierung zum Gegenstand: Die bisherige Förderzuständigkeit des Landes wird auf die
Kommunen übertragen Die Kommunen erhalten künftig vom Land pauschalierte Beträge.
Das Konzept "Kinderfreundliches Baden Württemberg" von 2002 konzentriert sich auf den
Ausbau der Kleinkindbetreuung für Kinder unter drei Jahren, den Ausbau der
Ganztagsbetreuung sowie den Ausbau der Jugendsozialarbeit an den Schulen.
(Sozialministerium, Pressemitteilung vom 27.7.2002)
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Gesetz über die Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen
und der Tagespflege – Kindergartengesetz KGaG vom 26.03.2003 (Inkrafttreten am 1.1.
2004)
§ 9 Verwaltungsvorschriften
(2) Das Kultusministerium entwickelt im Benehmen mit dem jeweils berührten Ministerium
mit Beteiligung der Trägerverbände Zielsetzungen. Dabei spielt die ganzheitliche
Sprachförderung eine zentrale Rolle.
-8-Bereits die Fassung des Gesetzes von 1996, bis Ende 2003 noch in Kraft, enthält eine
entsprechende Vorschrift. Der §9 Abs.2 lautet dort: „Das Kultusministerium entwickelt im
Benehmen mit dem jeweils berührten Ministerium die Lernziele und besonderen Curricula für
die Elementarerziehung und erlässt die dafür erforderlichen Vorschriften.“
Ministerielle Zuständigkeiten
Kindertages-
Kinder- und Jugendhilfe Schulen
einrichtungen
Sozialministerium;
Sozialministerium Zielsetzungen: Kultus- Kultusministerium
ministerium
Gesetzestexte und Quellen
Gesetz über die Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der
Tagespflege – Kindergartengesetz KGaG vom 26.03.2003
Land Baden-Württemberg: Erzieherinnenausbildung: Einigung mit kommunalen
Landesverbänden. Pressemitteilung vom 30.05.2003
Landtag von Baden-Württemberg: Kindertagesbetreuung in Baden-Württemberg. Große
Anfrage der Fraktion GRÜNE und Antwort der Landesregierung. 28.01.2002. Drucksache
13/680
Landtag von Baden-Württemberg: Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung für fünfjährige
Kinder. Antrag der Fraktion der SPD und Stellungsnahme des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport. 23.07.2002. Drucksache 13/1220
Sozialministerium: Pressemitteilung vom 27.7.2002
-9-Bayern
Rahmenpläne
Für die Kindergärten und künftig auch andere Kindertageseinrichtungen gibt es in Bayern
Rahmenpläne, die neben verschiedenen Mindeststandards (u.a. Personal und organisatorischer
Aufbau) die „Mindestanforderungen für die Erziehungs- und Bildungsziele“ enthalten
müssen. Grundlage ist das Kindergartengesetz (Art.9 BayKiG); die Rahmenpläne haben den
Rang einer Durchführungsverordnung (Art.28 BayKiG).
Die gegenwärtig gültigen Rahmenpläne (4. DVBayKiG in der 4. Fassung vom 6. August
1979) enthalten einen Abschnitt mit insgesamt acht Paragraphen zu den
„Mindestanforderungen für die Erziehungs- und Bildungsziele. Die
Durchführungsverordnung wird durch „Empfehlungen zur Umsetzung der Verordnung über
die Rahmenpläne für anerkannte Kindergärten in der Praxis“ ergänzt.
Die Rahmenpläne werden gegenwärtig überarbeitet. Die „Mindestanforderungen für die
Erziehungs- und Bildungsziele“ der 4. Durchführungsverordnung sollen durch den
„Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan“ ersetzt werden. Das Staatsinstitut für
Frühpädagogik (München) wurde mit der Entwicklung beauftragt, ein erster Entwurf wurde
im März 2003 veröffentlicht und wird im Jahr 2003/2004 (in der fassung vom oktober 2003)
erprobt. Dazu wird in 100 Krippen und Kindergärten unter wissenschaftlicher Begleitung des
Staatsinstitutes ein Modellversuch durchgeführt. Im Anschluss an die einjährige Erprobung
soll die überarbeitete Fassung verabschiedet werden. Ziel des Planes ist, „den Fachkräften
eine Orientierung zu geben, wie der gesetzliche Erziehungs- und Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen bestmöglich umgesetzt werden kann.“ (BEP S.5) Weiter heißt es im
Entwurf: „Der BEP versteht sich als Orientierungsrahmen, dessen Rahmenvorgaben
verbindlich zu beachten sind und bei deren Umsetzung pädagogische Gestaltungsspielräume
bestehen“ (ebd., Hervorhebungen im Orig.).
Reform der Erzieherinnenausbildung
Parallel zur Reform der Rahmenpläne für die Kindergärten wird gegenwärtig eine Reform der
Erzieherinnenausbildung durchgeführt. Im Auftrag des Staatsministeriums für Bildung und
Schule wurde vom Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung ein neuer
Lehrplan entworfen, der 2003 bis 2006 erprobt wird. Der Entwurf orientiert sich bereits an
dem Entwurf des „Bildungs- und Erziehungsplans“.
Nachfrageorientierung
Eine weitere Reformstrategie betrifft die Einführung von Elementen der Nachfragesteuerung,
vornehmlich bei der Finanzierung der Kindertagesstätten. Die Tageseinrichtungen werden zu
- 10 -einer transparenten Darstellung ihres Angebotes und zur Durchführung von
Elternbefragungen verpflichtet.
Dieses Modell wurde vom Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit (ISKA), Nürnberg,
entwickelt und begleitet, es wird seit 2002 erprobt. Zu erwarten ist eine entsprechende
Novelle des Bayerischen Kindergartengesetzes.
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Bayerisches Kindergartengesetz (BayKiG) vom 25.Juli 1972 in der Fassung vom
10.08.1982
Art. 8 Anerkennung
(1) Die Anerkennung wird auf Antrag durch die Aufsichtsbehörde ausgesprochen, wenn
(…)
c) die Gewähr dafür gegeben ist, daß für die Erziehungs- und Bildungsarbeit der auf Grund
dieses Gesetzes zu erlassende Rahmenplan beachtet wird,(…)
(2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn eine der Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchst. a bis e nicht gegeben ist. (…) Über den Antrag eines freigemeinnützigen Trägers
wird im Einvernehmen mit der Gemeinde, in den Fällen des Art. 5 Abs. 1 Satz 3 im
Einvernehmen mit dem Landkreis entschieden.
(3) Kindergärten, bei denen die Voraussetzungen für die Anerkennung noch nicht voll
erfüllt sind, kann die vorläufige Anerkennung unter der Bedingung erteilt werden, daß die
noch fehlenden Voraussetzungen innerhalb einer festzusetzenden Frist erfüllt werden
(vorläufige Anerkennung). Die vorläufige Anerkennung kann nur ausgesprochen werden,
wenn die Erziehung und Bildung der Kinder hinreichend gewährleistet sind.
Art. 9 Rahmenpläne
(1) Für die Erziehungs- und Bildungsarbeit in den Kindergärten sind die Träger
verantwortlich.
(2) Das zuständige Staatsministerium erläßt Rahmenpläne, in denen Mindestanforderungen
für die Erziehungs- und Bildungsziele, die personelle Ausstattung, den organisatorischen
Aufbau und die Gesundheitsfürsorge der Kindergärten festzulegen sind. Es hört vor dem
Erlaß des Rahmenplanes die Spitzenverbände der freigemeinnützigen Träger, die
kommunalen Spitzenverbände und die Berufsverbände der Erzieher und Sozialpädagogen
mit dem Ziel, eine Verständigung über den Inhalt des Planes zu erreichen.
- 11 -Art. 16 Anzeigepflicht
Die Träger anerkannter Kindergärten haben der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen
bzw. vorzulegen:
(…) 6. den Jahresbericht über Inhalt und Gestaltung der vorschulischen Erziehungs- und
Bildungsarbeit.
Art. 28 Durchführungsvorschrift
(1) Zuständiges Staatsministerium ist das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Es
wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung
durch Rechtsverordnung nähere Regelung zu treffen über
1. den Rahmenplan (Art. 9) (…)
Ministerielle Zuständigkeiten
Kinder- und Jugendhilfe Kindertageseinrichtungen Schulen
Staatsministerium für Staatsministerium für
Staatsministerium für
Arbeit, Sozialordnung Arbeit, Sozialordnung,
Unterricht und Kultus
Familie, Frauen Familie, Frauen
Gesetzestexte und Quellen
BayKiG - Bayerisches Kindergartengesetz vom 25.Juli 1972 in der Fassung vom 10.08.1982
4. DVBayKiG - Verordnung über Rahmenpläne für anerkannte Kindergärten vom 25.
September 1973, geändert durch Verordnung vom 6. August 1979
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen /
Staatsinstitut für Frühpädagogik: BEP - Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung – Entwurf für die Erprobung. Oktober
2003
Empfehlungen zur Umsetzung der Verordnung über die Rahmenpläne für anerkannte
Kindergärten (4. DVBayKiG) in der Praxis. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen (Hg.) erstellt vom Staatsinstitut für Frühpädagogik,
München 1997
Lehrplan für die Fachakademie für Sozialpädagogik. 1. und 2. Studienjahr. Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Staatsinstitut für Schulpädagogik und
Bildungsforschung (Hg.), August 2003
Informationen des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen zur Kindertagesbetreuung: http://www.stmas.bayern.de/familie/kinderbetreuung/
Informationen zum neuen Finanzierungsmodell: http://www.iska-nuernberg.de/kita-
bayern/index.htm
- 12 -Berlin
Bildungsprogramm
Im Sommer 2003 wurde der Entwurf für das „Berliner Bildungsprogramm für die Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“
veröffentlicht. Es wurde im Auftrag des Senats an der FU Berlin (Leitung Dr. Christa
Preissing) unter Beteiligung von Praxisberatern und –beraterinnen erarbeitet. Der Entwurf soll
nun mit den Verbänden, Trägern und der Fachöffentlichkeit erörtert und zu einem
„verbindlichen Orientierungsrahmen“ (Pressemitteilung des SenBJS vom 4.6.2003) für die
pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt werden.
Beim Entwurf des Bildungsprogramms handelt es sich um ein pädagogisch-inhaltliches
Programm, es wird von den Autorinnen auch als „offenes Curriculum“ bezeichnet.
Vereinbarung zur Qualitätsentwicklung
Auf Grundlage des Bildungsprogramms soll zwischen Senat und Trägern eine, die bereits
geltende Finanzierungsvereinbarung ergänzende Qualitätsentwicklungsvereinbarung getroffen
werden (vgl. Senator Böger, Vorwort zum Entwurf für das Berliner Bildungsprogramm, S.3).
Sprachförderung
Kinder mit besonderem Förderbedarf, etwa im Bereich der Sprachfähigkeiten, können bereits
als Zweijährige einen Platz in einer Kindertageseinrichtung beanspruchen.
Die allgemeine Sprachförderung findet sich als Bildungsbereich „Sprachen Kommunikation,
Schriftkultur“ im Entwurf des Bildungsprogramms für die Kindertageseinrichtungen. Hierzu
liegt außerdem bereits ein Konzept der Senatsverwaltung vor. In Kooperation mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung wurde ein „Sprachförderkoffer“ entwickelt,
der das Fachpersonal insbesondere in Kitas mit erhöhtem Migrantenanteil bei der Förderung
im Bereich der deutschen Sprache unterstützen soll. Der Koffer enthält ein Handbuch und
didaktisches Material. Sprachlerntagebücher sollen die Sprachentwicklung der Kinder
dokumentieren.
Das Land bietet schwerpunktmäßig Fortbildungen für Erzieherinnen zur Sprachförderung an.
Erzieherinnenaus- und -weiterbildung
Die Erzieherinnenausbildung für Berlin erhält ab Februar 2004 einen neuen Rahmenplan, in
dem der Bildungsauftrag und speziell die Sprachförderung einen erheblichen Platz einnehmen
soll. Der Rahmenplan liegt noch nicht vor.
Das Angebot zur Fortbildung wurde erweitert. Dem Personal steht Fachberatung zur
Verfügung.
- 13 -Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung und
Tagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz – KitaG) in der Fassung vom 4. September
2002
§ 8 Pädagogische Konzeption, Aufgaben des Personals
In jeder Tageseinrichtung ist eine pädagogische Konzeption zu erarbeiten, die die
Umsetzung der Aufgaben nach § 3 in der täglichen Arbeit der Einrichtung beschreibt. (…)
§ 9 Leitung und Fachberatung
(2) Die Jugendämter und die zentralen Träger der freien Jugendhilfe halten in
angemessenem Umfang interdisziplinäre Fachberatung vor.
(3) Die Fachberatung koordiniert die Zusammenarbeit mit allen am Erziehungsprozeß
beteiligten Diensten, Einrichtungen und Stellen. Sie unterstützt und berät das pädagogische
Fachpersonal der Kindertagesstätte in allen für die Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen.
Bei der konzeptionellen und strukturellen Weiterentwicklung der Kindertagesstätten hat sie
den Träger zu beraten.
§ 26 Förderung von Modellversuchen
Das Landesjugendamt kann mit dem Träger einer Einrichtung Vereinbarungen über die
Erprobung pädagogischer und anderer Modelle treffen. Entstehende zusätzliche
Betriebskosten kann das Landesjugendamt übernehmen.
Ministerielle Zuständigkeiten
Kinder- und Jugendhilfe Kindertageseinrichtungen Schulen
Senatsverwaltung für Senatsverwaltung für Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport Bildung, Jugend und Sport Bildung, Jugend und Sport
- 14 -Gesetzestexte und Quellen
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung und Tagespflege
(Kindertagesbetreuungsgesetz – KitaG) in der Fassung vom 4. September 2002
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: Bildungsoffensive für die Kitas geht weiter.
Pressemitteilung vom 10.09.2003
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: Das Berliner Bildungsprogramm für die
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem
Schuleintritt“ (erarbeitet von INA gemeinnützige Gesellschaft für innovative Pädagogik,
Psychologie und Ökonomie an der Freien Universität Berlin) Entwurf Juni 2003
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: Konzept zur Sprachförderung in
Kindertagesstätten. 04. April 2003
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: Sprachförderung Deutsch. Maßnahmen in
Kitas und in der Grundschule. Pressekonferenz am 16. Mai 2003
- 15 -Brandenburg
Konzeptentwicklung und Umsetzung
In den Jahren 1997 bis 2000 wurde das Modellprojekt „Zum Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen“ in Kooperation mit den Ländern Sachsen und Schleswig-Holstein
durchgeführt. Aufgabe des Projektes war die Grundlegung des Bildungsauftrages und eine
konzeptionelle Orientierung. Das Projekt wurde von dem Institut Infans (Leitung: Hans-
Joachim Laewen) begleitet.
Auf der Grundlage der Ergebnisse wurde gemeinsam mit Baden-Württemberg in 2002 ein 10-
Stufen-Projekt-Bildung begonnen. In 10 Modulen werden die beteiligten Erzieherinnen
qualifiziert und bei der Entwicklung „ihrer“ Kindertageseinrichtungen begleitet und
unterstützt.
Normativer Rahmen
2002 wurde im Auftrag des Landes ein „Entwurf eines normativen Rahmens für die
Bildungsarbeit in Brandenburger Kindertagesstätten“ vorgelegt (Autor: Ludger Pesch). Im
ersten Teil enthält das Gutachten Grundlagen und Begründungen der Bildungsarbeit, im
zweiten Teil „Bausteine für die Weiterentwicklung von Kindergärten als Bildungsorte“. Es
wurde ein, der den „Stand der Kunst“ darlegt und zu einem normativen Rahmen für die
Kindertagesstätten
Ein zweiter Entwurf mit dem Titel „Grundsätze der Bildungsarbeit in brandenburgischen
Kindertageseinrichtungen“ liegt seit Sommer 2003 vor.
Das Land strebt auf dieser Grundlage eine Vereinbarung mit den Trägern an.
Evaluation
2003/2004 wurde zum zweiten Mal ein Qualitätswettbewerb unter den
Kindertageseinrichtungen durchgeführt. Es handelt sich um eine externe Evaluation, die von
der FU Berlin (Leitung: W. Tietze) durchgeführt wird. Angewendet wird eine erweiterte
Variante des international und auch in Deutschland erprobten Messinstrumentes KES. Von
den Tageseinrichtungen, die sich bewerben, können 50 teilnehmen.
Diese Form der Evaluation soll zwar nicht flächendeckend, aber doch dauerhaft fortgeführt
werden.
Qualifikation und Beratung
Zur Qualifikation und Beratung der Fachkräfte stehen Konsultationskitas sowie Praxisberater
und –beraterinnen zur Verfügung.
- 16 -Zweimal jährlich gibt das Landesjugendamt die Zeitschrift „KitaDebatte“ heraus, die sich seit
mehreren Jahren überwiegend mit Fragestellungen im Zusammenhang des Bildungsauftrags
befasst.
In einem Projekt wird den beteiligten Kindertageseinrichtungen und Fachkräften ein
Handlungskonzept zur Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der
Kindertageseinrichtungen angeboten, das 10 Module enthält.
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialhilfegesetzbuches –
Kinder- und Jugendhilfe – Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 in der
Fassung vom 1. Januar 2002
§ 3 Aufgaben und Ziele der Kindertagesstätte
(3) Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben wird in einer pädagogischen Konzeption
beschrieben, die in jeder Tagesstätte zu erarbeiten ist.
§ 4 Grundsätze der Beteiligung
(1) (…) Der Übergang zur Schule und die Betreuung und Förderung schulpflichtiger Kinder
soll durch eine an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zusammenarbeit mit der
Schule erleichtert werden.
§19 Modellversuch
Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bietet gemäß § 82 und § 85 Abs. 2
Nrn. 7 und 8 des Achten Sozialgesetzbuches Fortbildungsmaßnahmen an und trägt durch
Beratungsangebote und Modellversuche zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuung bei.
§23 Durchführungsvorschriften
(3) Die zuständige oberste Landesbehörde kann im Einvernehmen mir den beteiligten
obersten Landesbehörden, mit den kommunalen Spitzenverbänden und den
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie den Kirchen Grundsätze über die
Bildungsarbeit der Kindertagesstätten und die Fortbildung der pädagogischen Kräfte
vereinbaren.
- 17 -Ministerielle Zuständigkeiten
Kindertages-
Kinder- und Jugendhilfe Schulen
einrichtungen
Ministerium für Bildung, Ministerium für Bildung, Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport Jugend und Sport Jugend und Sport
Gesetzestexte und Quellen
Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialhilfegesetzbuches – Kinder-
und Jugendhilfe – Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 in der Fassung vom 1.
Januar 2002
Andres, Beate / Laewen, Hans-Joachim: Das 10-Stufen-Projekt-Bildung
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/1231/projekt_beschreib.pdf
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport: Grundsätze der Bildungsarbeit in
brandenburgischen Kindertageseinrichtungen. 2. Entwurf, erarbeitet von L. Pesch u.a. August
2003
Pesch, Ludger: Entwurf eines normativen Rahmens für die Bildungsarbeit in Brandenburger
Kindertagesstätten (Teil 1 bis 3); Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend
und Sport des Landes Brandenburg. Dezember 2002
PädQUIS gGmbH: Einladung zum Kita-Qualitätswettbewerb in Brandenburg. o.O., o.J.
Zeitschrift „KitaDebatte“, herausgegeben vom Landesjugendamt Brandenburg
http://www.lja.brandenburg.de/publikationen/kitadebatte/index.htm?template_id=2346
- 18 -Bremen
Sprachförderung
Die Kindergärten führen für Fünfjährige, deren Sprachstand noch nicht hinreichend
entwickelt ist, Maßnahmen zur Sprachförderung durch. Zu diesem Zweck werden
Erzieherinnen speziell fortgebildet. Die Maßnahmen werden nach der Einschulung in den
Grundschulen fortgesetzt.
Der Sprachstand der Fünfjährigen wird flächendeckend erhoben. Die Erhebung, erstmals
durchgeführt in 2003, ist ein gesonderter Teil der ärztlichen Schuleingangsuntersuchung.
Unterstützung der Familien
Die Kindertageseinrichtungen sollen künftig stärker an das bereits durchgeführte
Förderprogramm HIPPY gebunden werden. Das Programm wurde 2003 in fünf Kindergärten
in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Grundschulen erprobt. Die Erweiterung ist
geplant.
HIPPY (Home Instruction Program for Preschool Youngsters) wird in Bremen bereits seit
1992 durchgeführt, es handelt sich um ein international erprobtes den Kindergarten
ergänzendes Vorschulprogramm. Ein deutsches Modellprojekt unter Beteiligung Bremens
wurde 1992 – 1994 vom DJI, München, wissenschaftlich begleitet.
Das Ziel ist, die kognitiven und die Lernfähigkeiten der Kinder zu erweitern und Grundlagen
für erfolgreichen kindergarten- und Schulbesuch zu legen. Die Förderung wird zu Hause
durchgeführt und besteht vor allem in der Anleitung der Mütter bzw. Eltern, die damit
gleichzeitig in ihrer Erziehungs- und Sprachkompetenz gestärkt werden.
Rahmenbildungsplan
Für den Elementarbereich ist ein Rahmenbildungsplan in Vorbereitung.
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Bremisches Tageseinrichtungs- und Tagespflegegesetz – BremKTG – Neufassung vom
19. Dezember 2000
§ 3 Auftrag der Tageseinrichtungen und der Tagespflege
(5) Für jede Tageseinrichtung ist unter Berücksichtigung der Absätze 1 bis 4 eine
Konzeption zu entwickeln.
§8 Träger der Tageseinrichtungen
(2) Die Träger sind verpflichtet, die Erfüllung des pädagogischen Auftrages ihrer
Tageseinrichtungen durch die regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der
Qualität ihrer Tageseinrichtungen sowie durch die Ermöglichung der Fortbildung ihrer
- 19 -Qualität ihrer Tageseinrichtungen sowie durch die Ermöglichung der Fortbildung ihrer
Fachkräfte zu sichern.
§ 14 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und sozialen Diensten
(…) Mit den Schulen sollen sie (die Tageseinrichtungen, Anm. GH) im Hinblick auf den
Übergang der Kinder vom Kindergarten zur Schule und im Hinblick auf die Betreuung und
Förderung von Schulkindern zusammenarbeiten.
Ministerielle Zuständigkeiten
Kindertageseinrichtungen
Kinder- und Jugendhilfe Schulen
Senat für Arbeit, Frauen Senat für Arbeit, Frauen
Senat für Bildung und
Gesundheit, Jugend und Gesundheit, Jugend und
Wissenschaft
Soziales Soziales
Gesetzestexte und Quellen
Bremisches Tageseinrichtungs- und Tagespflegegesetz – BremKTG – Neufassung vom 19.
Dezember 2000
HIPPY Begleitforschung: http://cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=51
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales: Rahmenplan für den
Kindergarten und Programm zur Sprachförderung beschlossen. Pressemitteilung vom
10.07.2003
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales: Den Kindern den Weg zu
erfolgreichem Schulbesuch ebnen. Pressemitteilung vom 22.05.2002
- 20 -Hamburg
Nachfragesteuerung
Im Mai 2003 wurde in Hamburg für die Kindertageseinrichtungen eine neue Steuerungs-
struktur in Kraft gesetzt, die auch die Bildungsaufgabe betrifft. Das neue Steuerungssystem
stärkt die Nachfrage und regelt durch Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
die Grundlage, auf der öffentliche Subventionen an Kindertageseinrichtungen vergeben
werden.
Leistungsvereinbarung und Qualitätsentwicklungsvereinbarung
Das Land hat mit den Trägerverbänden der Kindertageseinrichtungen eine Leistungs- und
eine Qualitätsentwicklungsvereinbarung getroffen. Nur Träger, die diesen Vereinbarungen
beigetreten sind, können von Eltern Gutscheine annehmen und dafür öffentliche
Kostenerstattung erhalten.
Die Einhaltung beider Vereinbarungen durch die Tageseinrichtungen kann – etwa nach einer
behördlichen Beschwerde durch Eltern – überprüft werden. Wenn die Kindertageseinrichtung
die vereinbarten Leistungen und Qualitätsentwicklungsmaßnahmen nicht im vollen Umfang
erbringen, kann das den Anspruch auf Kostenerstattung durch das Land mindern.
Die Leistungsvereinbarung wurde nach §13 des HmbKitaG getroffen. Darin werden neben
verschiedenen Standards (u.a. Öffnungszeiten, Personalausstattung und –qualifikation) in §6
auch Ziele und Grundsätze für Bildungs- und Erziehungsleistungen festgelegt.
Folgende Bildungsaufgaben erhalten in dieser Vereinbarung eine hervorgehobene Bedeutung:
• die Sprachförderung von Kindern nicht-deutscher Herkunft (siehe unten)
• die Vorbereitung auf den Schuleintritt in Kooperation mit den Grundschulen
• bei Nachmittagsbetreuung von Schulkindern insbesondere sachkundige Hausaufgaben-
hilfe in Abstimmung mit der Schule (für Schularbeitenhilfe und Interessengruppenleitung
werden je Kind zusätzliche Mittel gewährt)
Die Qualitätsentwicklungsvereinbarung wurde auf Grundlage des §14 HmbKitaG getroffen.
Die Träger entwickeln demnach für jede Tagseinrichtung ein schriftliches pädagogisches
Konzept und sind zur Qualitätsentwicklung verpflichtet. Das Konzept wird der
Landesbehörde und der Elternvertretung übergeben und ist öffentlich zugänglich. (§2
Qualitätsentwicklungsvereinbarung)
Sprachförderung
Die Sprachförderung, insbesondere auch der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, gehört
zu den allgemeinen Aufgaben der Kindertageseinrichtungen. Die Behörde für Bildung und
Sport hat hierzu pädagogische Hinweise veröffentlicht. Ob und welche Formen und Methoden
- 21 -entwickelt werden, liegt in der Autonomie der Einrichtungen. Tageseinrichtungen, die einen
hohen Anteil von Kindern nicht-deutscher Herkunftssprache haben, erhalten zur
Intensivierung der Sprachförderung zusätzliche Ressourcen. (§6 Abs.4
Leistungsvereinbarung)
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Gesetz zur Angebotsentwicklung und Finanzierung der Kindertagesbetreuung in der
Freien und Hansestadt Hamburg (HmbKitaG) vom 14. April 2003
§ 2 Aufgaben und Ziele von Tageseinrichtungen für Kinder
(3) Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben wird in einer pädagogischen Konzeption
beschrieben, die vom Träger für jede von ihm betriebene Tageseinrichtung zu erarbeiten ist.
§ 10 Anspruch auf Beratung und Unterstützung
(1) Die Kinder und ihre Sorgeberechtigten haben einen Anspruch auf Information durch die
zuständige Behörde über die zur Verfügung stehenden Angebote der Kindertagesbetreuung.
Sie haben ferner einen Anspruch auf Beratung über alle für ihre Entscheidung wichtigen
pädagogischen Aspekte und über ihre Rechte und Pflichten nach §§ 4 – 11.
§ 12 Vereinbarungen
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg schließ mit den Verbänden der Träger der freien
Jugendhilfe in Hamburg, der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten e.V. und mit den
Verbänden sonstiger Leistungserbringer in Hamburg auf Landesebene die
Leistungsvereinbarung nach § 13, die Qualitätsentwicklungsvereinbarung nach § 14 und die
Grundsatzvereinbarung über die Leistungsentgeltermittlung nach § 15 Absatz 1.
§ 13 Leistungsvereinbarung
(1) Die Vereinbarung über die Leistungsarten muss die wesentlichen Leistungsmerkmale
beinhalten. Sie bestimmt für die zu erbringenden Leistungsarten, die nach dem Alter der zu
fördernden Kinder und dem Förderungsumfang zu differenzieren sind, insbesondere die
jeweils hierzu erforderliche personelle Ausstattung sowie die erforderliche Qualifikation des
pädagogischen Personals.
(2) Die Träger müssen sicherstellen, dass die von ihnen erbrachten Leistungsarten zur
Förderung von Kindern geeignet sowie ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind.
§ 14 Qualitätsentwicklungsvereinbarung
In der Qualitätsentwicklungsvereinbarung ist festzulegen, auf welche Art und Weise die
Träger die fachliche Qualität der Arbeit sichern können und welche Maßnahmen getroffen
werden können, um sie regelmäßig zu überprüfen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
- 22 -Ministerielle Zuständigkeiten
Kindertages-
Kinder- und Jugendhilfe Schulen
einrichtungen
Behörde für Soziales und Behörde für Bildung und Behörde für Bildung und
Familie Sport Sport
Gesetzestexte und Quellen
Gesetz zur Angebotsentwicklung und Finanzierung der Kindertagesbetreuung in der Freien
und Hansestadt Hamburg (HmbKitaG) vom 14. April 2003
Vereinbarung über die Leistungsarten (Leistungsvereinbarung) nach § 13 HmbKitaG
Qualitätsentwicklungsvereinbarung nach § 14 HmbKitaG
Verordnung über die Bedarfskriterien und Prioritäten bei der Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege (Kinderförderungsverordnung – KFVO) vom 25. April
2003
Kita – Info-System der Behörde für Bildung und Sport http://www.kitainfo-
hamburg.de/kita/contents/both/public/start.htm
Behörde für Bildung und Sport – Amt für Kindertagesbetreuung: Sprachförderung in
Kindertagesstätten: Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung. Autorin: Sybille Neuwirth. Juni
2002
- 23 -Hessen
Bildungsprogramm
Die Landesregierung hat im Mai 2003 einen „Erziehungs- und Bildungsplan für Kinder von 0
bis 10 Jahren“ angekündigt. Er wird im Ministerium entwickelt.
Sprachförderung
Hessen fördert die Sprachkompetenz von Kindern im Kindergartenalter ohne ausreichende
Deutschkenntnisse in Form von Projektförderung. Die Kindertageseinrichtungen sind an
dieser Aufgabe nicht unmittelbar beteiligt. Träger können aber kommunale, kirchliche und
freigemeinnützige Institutionen, somit auch die Kindertageseinrichtungen sein.
Weitere Entwicklungen
Das Land konzentriert seine Anstrengungen gegenwärtig auf eine „Offensive für
Kinderbetreuung“, die den quantitativen Ausbau des Angebotes für Kinder unter drei Jahren
und für Schulkinder zum Ziel hat.
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Hessisches Kindergartengesetz vom 14. Dezember 1989
§2 Aufgaben
(2) Für die Erziehungs- und Bildungsarbeit in den Kindergärten sind die Träger unter
Mitwirkung der Eltern verantwortlich
Ministerielle Zuständigkeiten
Kindertages-
Kinder- und Jugendhilfe Schulen
einrichtungen
Hessisches Sozial- Hessisches Sozial- Hessisches Kultus-
ministerium ministerium ministerium
- 24 -Gesetzestexte und Quellen
Hessisches Kindergartengesetz vom 14. Dezember 1989
Hessisches Sozialministerium: Kindergarten soll Bildungsgarten werden. Presseinformation
vom 28.05.2003
Hessisches Sozialministerium: Frühzeitig das Lernen lernen und den Bildungshunger stillen.
Presseinformation vom 07.05.2003
Hessisches Sozialministerium: Fach- und Fördergrundsätze zur Förderung der
Sprachkompetenz von Kindern im Kindergartenalter ohne ausreichende Deutschkenntnisse.
Februar 2002
- 25 -Mecklenburg-Vorpommern
Vorschuljahr in den Kindertageseinrichtungen
Bei der Umsetzung des Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen konzentriert sich das
Land zunächst auf die Fünfjährigen. Im Jahr vor der Einschulung soll ihnen eine
zielgerichtete Vorbereitung auf die Schule angeboten werden. Das Angebot soll täglich vier
Stunden umfassen und gebührenfrei sein. Im Mittelpunkt soll die individuelle Förderung des
Kindes stehen, die möglichst in der Gruppe der Gleichaltrigen erfolgen soll. Die Vorbereitung
auf die Schule soll nur von Fachkräften durchgeführt werden, die die erfolgreiche Teilnahme
an einer vorgeschrieben Weiterbildungsmaßnahme nachweisen können. Ein entsprechender
Gesetzentwurf liegt vor.
In einer Rechtverordnung soll das Sozialministerium hierzu im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur den Inhalt, die Ausgestaltung und die
Durchführung regeln.
Ein Curriculum wird gegenwärtig an der Universität Rostock (Prof. Antonius Hansel)
vorbereitet. Ein Entwurf liegt noch nicht vor.
Sprachförderung
Kinder in Kindertagesstätten, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, sollen Anspruch auf die
Förderung ihrer Sprachkenntnisse erhalten. Der örtliche Träger der Jugendhilfe soll hierzu mit
den Personensorgeberechtigten und der Leitung der Kindertageseinrichtung einen Förderplan
vereinbaren. (§10 Abs.4 Gesetzesentwurf KiföG)
Fach- und Praxisberatung
Die Fachkräfte in den Tageseinrichtungen erhalten Fach- und Praxisberatung.
Weitere Entwicklungen
Mit der Gesetzesnovelle sind weitere Veränderungen vorgesehen. Der Gesetzesentwurf sieht
keinen Personalschlüssel und keine Festsetzung von Gruppengrößen vor. Vorgesehen sind
dagegen Vorschriften zur Qualifikation der Fachkräfte sowie Regelungen zur täglichen Dauer
der Betreuung. Die Qualifikation des Personals soll geregelt bleiben.
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz soll in zwei Stufen auf Zweijährige erweitert
werden.
Die Finanzierung soll neu geregelt werden. Künftig tragen das Land und die Kreise bzw.
kreisfreien Städte jeweils festgesetzte Summen. Die Restfinanzierung soll durch die
Kommunen und die Eltern erfolgen.
- 26 -Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (KitaG)
vom 19.Mai 1992; zuletzt geändert am 11. Dezember 1995.
§20 Modellversuche (eingefügt 1995)
Das Land kann (…) in den Kindertageseinrichtungen Modellvorhaben nach Maßgabe seines
Haushaltes fördern.
Ein Entwurf für eine Gesetzesnovelle liegt vor. Das „Gesetz zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (KiföG)“ war bis Herbst 2003 in der Anhörung
und soll nach Absicht der Landesregierung zum 01.01.2004 in Kraft treten.
Auszug aus dem Entwurf zum Gesetz zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG
M-V)
§5 Vorbereitung auf die Schule
Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr vor
ihrem Eintritt in die Schule einen Anspruch auf eine zielgerichtete Vorbereitung auf die
Schule in einer Kindertageseinrichtung. Dieses Angebot orientiert sich am Schuljahr,
umfasst einen Zeitraum von zehn Monaten mit einer Förderung von vier Stunden am
Vormittag und ist für die Eltern entgeltfrei.
§10 Standards für Kindertageseinrichtungen
(4) Kinder, die deutsch als Fremdsprache erlernen, haben einen besonderen Anspruch auf
die Förderung ihrer Kenntnisse der deutschen Sprache. Der örtliche Träger der öffentlichen
Jugendhilfe vereinbart hierzu mit den Personenberechtigten und der Leitung der
aufnehmenden Kindertageseinrichtung einen Förderplan über die notwenigen und
geeigneten Hilfen im Hinblick auf eine altersgerechte Sprachkompetenz als Voraussetzung
für die umfassende Wahrnehmung von Bildungschancen. Dies gilt auch, wenn diese Kinder
wegen nicht ausreichender Sprachkompetenz von der Einschulung zurückgestellt werden.
§ 11 Fachkräfte
(4) Zur Durchführung der Vorbereitung auf die Schule für Kinder im Jahr vor Schuleintritt
dürfen nur solche (…) Fachkräfte eingesetzt werden, die über eine für die vorschulische
Bildungs- und Erziehungsarbeit spezifische Qualifikation verfügen. Diese ist durch eine
erfolgreiche Teilnahme an der vorgeschriebenen Fort- und Weiterbildungsmaßnahme
nachzuweisen.
- 27 -nachzuweisen.
(7) Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben für die Teilnahme der Fachkräfte an
Fort- und Weiterbildung und Fach- und Praxisberatung zu sorgen sowie ihnen angemessene
Zeit für Dienstberatungen, Vor- und Nachbereitungen und die Zusammenarbeit mit den
Personensorgeberechtigten einzuräumen. Als angemessen gelten in der Regel wöchentlich
zweieinhalb Stunden. Die Fachkräfte sollen sich ständig fortbilden.
(8) Aufgaben der Fach- und Praxisberatung dürfen nur von den in Absatz 1 genannten
Fachkräften wahrgenommen werden, die über eine abgeschlossene fachbezogene
Ausbildung an einer Fachhochschule oder Hochschule oder über langjährige Erfahrung
aufgrund einer Tätigkeit auf diesem Gebiet bei regelmäßiger beruflicher Fort- oder
Weiterbildung verfügen.
(9) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat für je 1 200 belegte Plätze in
Kindertageseinrichtungen eine Vollzeitkraft mit der Fach- und Praxisberatung zu betrauen,
soweit diese Aufgabe nicht durch die Träger der Kindertageseinrichtungen selbst
wahrgenommen wird.
§ 12 Aufgaben der Fachkräfte
(3) Die Fach- und Praxisberater haben die Aufgabe, die Qualitätsstandards im Rahmen des
Bildungs- und Erziehungsauftrages in den Kindertageseinrichtungen zu sichern und
weiterzuentwickeln. Sie sollen die Fachkräfte und Träger von Kindertageseinrichtungen bei
der Konzeptionsentwicklung, bei Konfliktlösungen, Projekten und Modellen sowie bei der
Umsetzung des Angebotes der Vorbereitung auf die Schule in einer
Kindertagesseinrichtung beraten und begleiten.
Ministerielle Zuständigkeiten
Kinder- und Jugendhilfe Kindertages- Schulen
einrichtungen
Sozialministerium Sozialministerium Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur
- 28 -Gesetzestexte und Quellen
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (KitaG) vom
19.Mai 1992; zuletzt geändert am 11. Dezember 1995
Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege
(Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) - Entwurf der Landesregierung vom Oktober
2003
Sozialministerium: Auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit für Kinder. Kabinett gibt Kita-
Novelle in die Verbandsanhörung. Pressemitteilung vom 01.07.2003
- 29 -Niedersachsen
Bildungsplan
Seit dem Herbst 2003 wird an einem Bildungsplan für die Kindertageseinrichtungen
gearbeitet. Beauftragt ist eine Arbeitsgruppe von Vertretern der kommunalen
Spitzenverbände, der Träger und des Ministeriums. Ein Entwurf soll im Sommer 2004
vorliegen.
Praxisberatung
In einem auf ein Jahr befristeten Modellprojekt sollen künftig 12 „Konsultationskitas“ den
Kindertageseinrichtungen zur Beratung zur Verfügung stehen. Das Antragsverfahren wird im
Herbst 2003 durchgeführt.
In 2003 wird zum 2. Mal die Messe „Kindergarten bildet … von A bis Z“ durchgeführt. Dort
präsentieren niedersächsische Kindertageseinrichtungen für Fachleute ihre Bildungsansätze.
Sprachförderung
Die „Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich“ wurde durch die
Förderrichtlinien dem Bildungsauftrag der Kindertagesstätten zugeordnet.
Zuwendungsempfänger können nur Kindertagesstätten sein. Sie erhalten Mittel für die
Beschäftigung von zusätzlichem geeignetem Personal.
Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Bildungsauftrages
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 7. Februar
2002
§3 Arbeit in der Tageseinrichtung
(1) Die Tageseinrichtung hat unter Berücksichtigung ihres Umfeldes und der
Zusammensetzung ihrer Gruppen auf Grundlage der Konzeption des Trägers unter Mitarbeit
der Fachkräfte Schwerpunkte und Ziele der Arbeit in der Tageseinrichtung und deren
Umsetzung festzulegen. Die Konzeption ist regelmäßig fortzuschreiben.
(4) Die Tageseinrichtung bezieht das örtliche Gemeindewesen als Ort für lebensnahes
Lernen in die Gestaltung des Alltags mit ein.
- 30 -(5) Die Tageseinrichtung soll mit solchen Einrichtungen ihres Einzugsbereichs,
insbesondere mit den Grundschulen, zusammenarbeiten, deren Tätigkeit im Zusammenhang
mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Tageseinrichtungen steht.
Ministerielle Zuständigkeiten
Kindertages-
Kinder – und Jugendhilfe Schulen
einrichtungen
Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie und Kultusministerium Kultusministerium
Gesundheit
Gesetzestexte und Quellen
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 7. Februar 2002
http://www.mfas.niedersachsen.de/functions/downloadObject/0,,c1163349_s20,00.doc
Verordnung über Mindestanforderungen an Kindertagesstätten (1. DVO-KiTaG) vom 28. Juni
2002 http://www.mfas.niedersachsen.de/functions/downloadObject/0,,c616801_s20,00.pdf
Richtlinien zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich vom
3.2.2003
Niedersächsisches Kultusministerium: Kindergarten bildet. Konzept zur Weiterentwicklung
und Qualitätssteigerung von Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen in
Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der Sprach- und
Sprechkompetenzentwicklung. Hannover 2003
- 31 -Nordrhein-Westfalen
Bildungsvereinbarung
Im August 2003 wurde zwischen dem Land und den Wohlfahrtsverbänden, den kommunalen
Spitzenverbände und den Kirchen als Träger der Kindertageseinrichtungen erstmals nach §26
GTK eine Bildungsvereinbarung getroffen. Die Vereinbarung umfasst inhaltliche
Bestimmungen des Bildungsauftrages, vor allem aber Verfahrensgrundsätze. Sie enthält in der
Anlage eine „Handreichung zur Entwicklung träger- oder einrichtungsspezifischer
Bildungskonzepte“. Das Land wurde von der Universität Köln (Leitung: G. Schäfer) beraten;
die Handreichung wurde dort entwickelt.
Die Vereinbarung betrifft „vor allem die Bildungsprozesse in Tageseinrichtungen für Kinder
vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung“; „Insbesondere die Kinder im letzten
Jahr vor der Einschulung bedürfen einer intensiven Vorbereitung auf einen gelingenden
Übergang zur Grundschule. Die ist ein Beitrag zur Erlangung von Schulfähigkeit.“
Wesentliche Inhalte der Vereinbarung sind das träger- oder einrichtungsspezifischen
Bildungskonzept, die individuelle Bildungsdokumentation, die Aufgaben der
Tageseinrichtungen beim Übergang zur Grundschule sowie die interne Evaluation.
Ø träger- oder einrichtungsspezifischen Bildungskonzept
Die Bildungsarbeit wird nach einem träger- oder einrichtungsspezifischen
Bildungskonzept durchgeführt Die Bildungsvereinbarung enthält in der Anlage eine
„Handreichung zur Entwicklung träger- oder einrichtungsspezifischer
Bildungskonzepte“. Zur Aufgabe dieser Handreichung heißt es: „Die in dieser
Handreichung beispielhaft aufgeführten Bildungsbereiche dienen der Hilfestellung und
Orientierung für die Entwicklung eigener Konzepte. Sie sollen Denkanstöße sein und
als offene Ausgangspunkte zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Pädagogik
der frühen Kindheit beitragen.“
Ø individuelle Bildungsdokumentation
Es wird angestrebt, dass die Tageseinrichtungen - auf der Grundlage beobachtender
Wahrnehmungen und gerichtet auf die Möglichkeiten des jeweiligen Kindes - die
individuellen Bildungsprozesse dokumentieren. Die Eltern haben umfassende Rechte an
der Dokumentation. Erforderlich ist zunächst die schriftliche Einwilligung der Eltern;
wird diese nicht erteilt oder widerrufen, dürfen Eltern und Kindern dadurch keine
Nachteile entstehen. Die Dokumentation darf nur mit Einwilligung der Eltern an Dritte
gegeben werden, die Eltern haben das Recht zur Einsicht und können die Herausgabe
fordern. Sie erhalten die Dokumentation, wenn das Kind die Einrichtung verlässt.
- 32 -Ø Übergang in die Grundschule
Die Vereinbarung schreibt den Kindertageseinrichtungen Aufgaben für das Gelingen
des Übergangs zur Grundschule zu. Für die Zusammenarbeit mit der Grundschule ist
demnach die Bildungsdokumentation wesentlich; ob und wie sie beim Übergang zur
Grundschule genutzt wird, bleibt aber den Eltern überlassen. Ein Schwerpunkt wird
außerdem bei der Kooperation der Fachkräfte von Kindertageseinrichtungen und der
Lehrkörper der Grundschulen gelegt. Vorgesehen werden regelmäßige gegenseitige
Besuche und Hospitationen, gemeinsame Weiterbildungen und gemeinsame
Einschulungskonferenzen.
Ø Interne Evaluation
Die Träger der Kindertageseinrichtungen verpflichten sich zur internen Evaluation. Zur
Mindestgrundlage gehören die schriftliche Konzeption der Einrichtung, die Leitlinien
für die Arbeit und ein Einrichtungsprofil enthalten muss, das träger- oder
einrichtungsspezifische Bildungskonzept sowie die individuellen
Bildungsdokumentationen.
In den Durchführungsvorschriften des GTK ist die Möglichkeit einer Bildungsvereinbarung
vorgesehen (§ 26 Abs.2 GTK). In der Vereinbarung wird in dieser Hinsicht auf das GTK
jedoch nicht Bezug genommen. In einer Protokollnotiz wird für „andere Träger“ die volle
Verbindlichkeit festgestellt „Die Oberste Landesjugendbehörde wird sicherstellen, dass die
Grundsätze dieser Vereinbarung vom überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im
Rahmen der Betriebserlaubnisverfahren nach §§ 45 ff. SGB VIII auch gegenüber den anderen
Träger von Tageseinrichtungen Geltung erlangen.“ (Protokollnotiz zur Bildungsvereinbarung
NRW) Äußerungen des Ministeriums zufolge hat die Bildungsvereinbarung jedoch ebenso
wie das Schulfähigkeitsprofil lediglich „empfehlenden Charakter“ (vgl. etwa Vorwort der
Ministerin zum Schulfähigkeitsprpofil, S.2)
Schulfähigkeitsprofil
Das Land hat ein „Schulfähigkeitsprofil“ herausgegeben, das den pädagogischen Fachkräften
in den Kindergärten sowie den Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen und
Sonderschulen des Primarbereichs in der Übergangsphase vom Kindergarten in die
Schuleingangsphase Orientierung geben soll.
Sprachförderung
Die Sprachförderung von Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen wurde nicht in den
allgemeinen Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen gelegt. In den Förderrichtlinien
von 2002 werden aber Kindertageseinrichtungen als mögliche durchführende Institutionen
hervorgehoben. Zuwendungsempfänger im vorschulischen Bereich sind die örtlichen Träger
- 33 -Sie können auch lesen