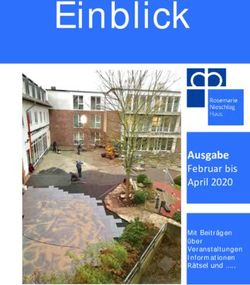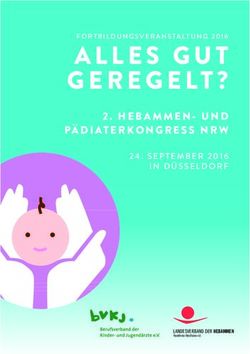GZO-Weiterbildungskonzept für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte Allgemeine Innere Medizin 01.01.2019 - SIWF Register
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
GZO-Weiterbildungskonzept für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte Allgemeine Innere Medizin 01.01.2019 Klinik Innere Medizin, GZO Spital Wetzikon 1. Einleitende Bemerkungen 1.1. GZO Spital Wetzikon Die GZO AG betreibt das Spital Wetzikon, ein regionales Spital in Wetzikon mit kantonalem Leistungsauftrag, das Ende der 90-er Jahre aus der Zusammenlegung der Spitäler Rüti, Bauma und Wald entstand und mittlerweile zu einem grossen Schwerpunktspital des Kantons Zürich gewachsen ist. Der Leistungsauftrag umfasst die erweiterte Grundversorgung der am stärksten wachsenden Region des Kantons Zürich. Das Spital Wetzikon erbringt zusätzlich Zentrumsleistungen für die nahegelegenen, infrastrukturell im akutmedizinischen Bereich
weniger breit ausgestatteten Spitäler Zürcher Höhenklinik Wald (ZH), Linth (Uznach) (SG),
die Clienia Schlössli AG (ZH) und das Geburtshaus Bäretswil sowie in ausgewählten
Spezialgebieten im Auftrag des Universitätsspital Zürich.
Aktionäre der GZO AG sind die 12 Gemeinden Bäretswil, Bauma, Bubikon, Dürnten,
Fischenthal, Gossau, Grüningen, Hinwil, Rüti, Seegräben, Wald und Wetzikon. Die Aktionäre
sind über einen Aktionärsbindungsvertrag im Falle eines Aktienverkaufs verpflichtet, diese
primär den anderen Aktionären anzubieten. Der Kanton Zürich ist nicht Aktionär, hat aber im
Falle eines Aktienverkaufs eines Aktionärs ein subsidiäres Vorkaufsrecht sofern keine
anderen Aktionäre übernehmen. Erst an dritter Stelle könnten Private Aktien erwerben.
Das Spital Wetzikon besteht aus den Departementen Innere Medizin und Chirurgie, der Klinik
für Gynäkologie/Geburtshilfe und den Instituten für Anästhesiologie und Radiologie. Als
eigenständige, aber administrativ der Inneren Medizin angegliederte Abteilung verfügt das
GZO über eine Stroke Unit, die gemeinsam mit 3 Belegärzten Neurologie betreut wird.
Die Medizinische Klinik
Die Medizinische Klinik ist Weiterbildungsstätte der Kategorie A für den Facharzttitel FMH
Allgemeine Innere Medizin. Die Innere Medizin betreut jährlich ca. 4‘000 stationäre Patienten.
Interdisziplinär stehen 12 Betten auf der ambulanten Tagesklinik. Auf der Intensivstation
stehen 7 Betten mit maximal 4 Beatmungsplätzen zur Verfügung. Die interdisziplinär geführte
Notfallstation ist administrativ dem Departement Chirurgie angegliedert; die Innere Medizin ist
aber fachlich und organisatorisch für den internistischen Notfalldienst zuständig. Zur
Notfallstation gehören der Schockraum, 3 Gips/Behandlungszimmer sowie 9 interdisziplinäre
Notfallkojen (ohne die Klinik für Gynäkologie/ Geburtshilfe, die einen eigenen Notfall betreibt).
Der Dienst auf der Notfallstation der Kategorie IV kann für insgesamt 12 Monate als
ambulante Medizin angerechnet werden.
Team Klinik Medizin
1 Chefarzt und ein Co-Chefarzt
5 Abteilungsleiter/-innen
2 Leitende Ärzte
9 Kader- und Oberärztinnen/-ärzte
2 Oberärztinnen/-ärzte in Vertretung
25 Assistenzärztinnen/-ärzte
Fachspezialitäten Department Innere Medizin
Angiologie (Durch die Klinik für Angiologie des Universitätsspital Zürich betreut)
Clinical trial unit und Forschung (Prof. U. Eriksson)
Endokrinologie & Diabetologie (Dr. U. Knobel, Dr. D. Möller)
Gastroenterologie (Dr. B. Magdeburg, Dr. C. Hess, Dr. S. Kenngott, Dr. C. Schuster)
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 2/12 Infektiologie & Spitalhygiene (Dr. C. Rüegg)
Kardiologie & Rhythmologie (Dr. Nazmi Krasniqi, Dr. H. Y. Yakupoglu, Prof. U.
Eriksson, Konsiliarärzte; Prof. F. Tanner und Prof. F. Duru)
Nephrologie & Dialyse (Dr. C. Etter)
Neurologie (Konsiliarärzte: Dr. U. Peter, Dr. W. Dinner, Dr. C. Zeller)
Onkologie & Hämatologie (Prof. U. Kapp, Dr. M. Schnitzler, Dr. R. Racila, Dr. S.
Huggle & Konsiliarärzte KSW)
Palliative Care (Dr. A. Weber, Dr. B. Loupatatzis)
Pneumologie & Somnologie (Dr. R. Fiechter, Dr. M. Huber, med. pract. S. Wyden,
med. pract. P. Heeb )
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Intensivmedizin (Dr. P. Gerstl, Dr. P. Baur, Dr. A. Kündig, Anästhesie; Prof. U.
Eriksson)
Klinische Notfallmedizin SGNOR (Dr. F. Kube und PD Dr. D. Frey, Chirurgie; Prof. U.
Eriksson)
Schwerpunkte internistisch sind
Endokrinologie & Diabetologie, welche gemeinsam mit der chirurgischen Klinik auch
bariatrische Patienten betreut,
Weiterbildungskategorie Arztpraxis für Endokrinologie & Diabetologie (bis 12 Monate)
Gastroenterologie mit Spezialgebiet Interventionen, die sich mit jährlich über 4‘000
Endoskopien - davon gut 200 ERCP - im Kanton Zürich ausgezeichnet positioniert
hat
Kardiologie, welche neben der kardiologischen Grundversorgung über die stationären
Leistungsaufträge in invasiver Elektrophysiologie und im Bereich
Herzinsuffizienztherapie überregional positioniert hat
Weiterbildungskategorie C für Kardiologie
Nephrologie & Dialyse, welche über 13 Dialyseplätze verfügt (über 4‘400 Dialysen
jährlich) und das gesamte Spektrum der der nephrologischen Diagnostik und
Therapie abdeckt
Weiterbildungskategorie C für Nephrologie
Onkologie & Hämatologie, die ein gemeinsames Tumorboard mit der Pathologie,
Onkologie und Radioonkologie des Kantonsspitals Winterthur betreibt und gut 2‘600
Chemotherapien jährlich durchführt
Weiterbildungskategorie B für Onkologie
Pneumologie mit dem zusätzlichen Leistungsauftrag Schlafmedizin, einem
ambulanten Rehabilitationsprogramm, Tauchmedizin und Allergologie
Weiterbildungskategorie C für Pneumologie und Somnologie
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 3/12Neben der Klinik sind dem Departement Innere Medizin das Labor und die Stroke-Unit
angegliedert. Dem Departement Medizin obliegt zudem die fachliche Leitung der
Spitalapotheke. Die Spezialgebiete Rheumatologie und Tropenmedizin sind über Beleg- und
Konsiliarärzte vertreten. Der Chefarzt ist mit den Kaderärzten für die Umsetzung des
Weiterbildungsprogramms der Medizinischen Klinik und der ambulanten Bereiche
Notfallstation und Tagesklinik verantwortlich. Der Chefarzt Innere Medizin ist (Titular)-
Professor für Innere Medizin der medizinischen Fakultät Basel für Kardiologie der
medizinischen Fakultät Zürich. Er betreibt ein Forschungslabor für Kardioimmunologie am
Zentrum für molekulare Kardiologie der Universität Zürich, Standort Schlieren. Das GZO
Spital Wetzikon ist ein Lehrspital der Universität Zürich und beteiligt sich aktiv an der
klinischen Ausbildung der Studierenden (klinischer Untersuchungskurs 6. Jahr, Leitung Prof.
Eriksson und 3. Jahr, Leitung Dr. Rüegg).
2. Das Weiterbildungskonzept Allgemeine Innere Medizin
2.1. Assistenzarztstellen
24 Stellen werden mit Anwärtern für die Basisweiterbildung Allgemeine Innere Medizin, bzw.
Kandidaten für die Aufbauweiterbildungscurricula Hausarzt bzw. Spitalinternist besetzt. Eine
Stelle wird im Turnus für ein Jahr mit einem fortgeschrittenen Assistenten des Instituts für
Anästhesie des Universitätsspitals Zürich besetzt, der ein Jahr Innere Medizin zur Erfüllung
des Curriculums Klinische Notfallmedizin braucht. Eine zweite - 2 Jahres - Rotationsstelle,
wird mit einem fortgeschrittenen Anwärter für den Facharzttitel Kardiologie besetzt, der im
Rahmen eines Austauschprogramms mit der Klinik für Kardiologie des Universitätsspitals
Zürich an unsere Klinik rotiert.
2.2. Weiterbildungsinhalte (vergleiche Anhang)
Fachlich kompetente Betreuung von stationären (Klinik) und ambulanten
(Notfallstation & internistische Tagesklinik) Patienten mit Krankheitsbildern aus dem
gesamten Spektrum der Inneren Medizin.
Kompetenz im Management der häufigsten und wichtigsten internistischen Notfälle.
Kompetenz in der Durchführung der wichtigsten allgemein-internistischen
Interventionen.
Durchführung und Auswertung häufiger internistischer Spezialuntersuchungen und
Kenntnis der Indikationen, technischen Prinzipien und Grenzen der wichtigsten
apparativ-technischen diagnostischen & therapeutischen Verfahren der Inneren
Medizin und ihrer Fachgebiete.
Profunde Kenntnisse in Abdomen-, Nieren-, Lungen-, Schilddrüsen- und
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 4/12Pleurasonographie.
Kostenbewusstsein im Umgang mit den präventiven, diagnostischen und
therapeutischen Ressourcen.
Schulung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Hausärzten, Ärzten anderer
Fachbereiche, anderen Berufsgruppen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Schulung der psychosozialen und kommunikativen Kompetenz im Umgang mit den
Bedürfnissen des Kranken und seiner Angehörigen.
Schulung der konstruktiven Selbst- und Fremdkritikfähigkeit durch strukturierte
Visitenfeedbacks, Teilnahme an klinikinternen CIRS Veranstaltungen und an den
klinisch-pathologischen Konferenzen.
Erwerbung von Führungskompetenz durch Anleitung von Unterassistierenden und
die ärztlich-fachliche Supervision der zugeteilten Pflegefachkräfte auf den
Abteilungen.
Fertigkeit in der Nutzung und kritischen Wertung der medizinischen Fachliteratur und
Datenbanken.
Schulung in Präsentations- und Vortragstechnik im Rahmen des Journal Clubs, der
Assistenzarzt-Fortbildung,, der CAT (critical appraisal of a topic) und der klinisch-
pathologischen Konferenz.
Durchführung internistischer Konsilien mit einem Kaderarzt in den letzten 6 Monaten
der Weiterbildungsperiode.
Bei minimal 2-jähriger Anstellung kann bei Eignung eine 6-monatige Fachrotation
(Kardiologie, Pneumologie, Hausarztmedizin, Nephrologie, Onkologie) absolviert
werden.
Fakultativ: Teilnahme an klinischen Forschungsprojekten
2.3. Einführung neuer Assistenzärzte
Alle neuen Mitarbeiter werden im Rahmen eines Einführungstages in die
Organisationsstruktur des Gesamtspitals eingeführt und mit der Betriebsphilosophie
und der Informatikstruktur vertraut gemacht. Der Einführungstag endet mit einer
Betriebsbesichtigung und der Begrüssung und Vorstellung der neuen Mitarbeiter an
der Klinik für Innere Medizin.
Alle neueintretenden Assistenzärzte erhalten eine administrative und
organisatorische Wegleitung der Klinik Innere Medizin.
Während der ersten 2 Wochen führt der neueingetretene Assistenzarzt mit einem
fortgeschrittenen Assistenzarzt zusammen eine Bettenstation und bekommt einen
Kaderarzt als direkten Ansprechpartner zugeteilt.
Jeder Assistenzarzt wird während der ersten 2 Monate auf der allgemeinen
Bettenstation eingesetzt und arbeitet während dieser Phase besonders eng mit dem
Kaderarzt zusammen. Diese Phase wird nach 2 Monaten durch ein Standortgespräch
mit der Klinikleitung und dem Weiterbildungsbeauftragten abgeschlossen.
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 5/122.4. Gliederung des Weiterbildungsprogramms
Jeder Assistenzarzt kann auf den Bettenstationen, dem Notfall (ambulant), der
internistischen Tagesklinik und auf der interdisziplinären Intensivstation eingesetzt
werden. Die Klinikleitung staffelt die Rotationen nach den betrieblichen Bedürfnissen
und berücksichtigt Vorkenntnisse und die individuelle Entwicklung. Die Rotation auf
die interdisziplinäre Intensivstation wird in der Regel gegen Ende der
Weiterbildungsperiode eingeplant.
Theoretische Aspekte der Weiterbildung werden im Rahmen unseres strukturierten
Wochenprogramms (CIRS, Konsiliarvisiten, CAT, Journal Club,
Assistenzarztfortbildungen), den monatlichen Hausarztkolloquien sowie an der
Online- Intensivmedizinfortbildung des USZ und der quartalsweise stattfindenden
Klinisch-pathologischen Konferenz (zusammen mit der Radiologie GZO und der
Pathologie des Kantonsspitals Winterthur) vermittelt.
Für wissenschaftlich interessierte Assistenzärzte besteht die Möglichkeit, an
klinischen Studien teilzunehmen.
2.5. Elemente der Weiterbildung
Die Weiterbildung wird „on the job“ durch stufengerecht supervisierte ärztliche Tätigkeit an
unserer Klinik vermittelt.
In Ergänzung bilden wir unsere ärztlichen Mitarbeiter an folgenden Veranstaltungen weiter:
Intern
Strukturiert
Dienstag 07:45 – 08:00 alternierend CIRS oder Unterassistentenvortrag
Mittwoch 07:45 - 08:15 Uhr Journal-Club, critical appraisal of a topic (CAT),
Konsiliarvisite
Mittwoch 12:45 - 13:30 Uhr Intensivmedizin (Videokonferenz aus dem
Universitätsspital Zürich)
Donnerstag 07:30 - 08:00 Uhr interdisziplinäres Assistenzarzt –
Weiterbildungsseminar für chirurgische und medizinische Assistenzärzte
Freitag 07:45 – 08.00 Uhr alternierend EKG des Tages, Lungenfunktion oder multiple
choice Fragen für die Facharztprüfung (MKSAP)
Jeden 1. Donnerstag im Monat 12:15 - 15:15 Uhr Donnerstagskolloquium mit
niedergelassenen Ärzten, internen und externen Referenten
Donnerstag 13:15 – 14:45 Uhr Kardiologie / Rhythmologie
1 x pro Quartal Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr klinisch-pathologische Konferenz:
zusammen mit der Radiologie und der Pathologie des Kantonsspitals Winterthur
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 6/12Unstrukturiert
Täglich von 07:30 - 07:45 Uhr: Morgenrapport mit Kurzvorstellung der Eintritte des
Vortages und der Nacht (Ausnahme Donnerstag: nach interdisziplinärer
Weiterbildung s. u.)
Täglich von 08:00 - 08:15 Uhr: Visitenvorbereitung und Besprechung von Problemen
auf den Stationen mit dem zuständigen Oberarzt
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 08:15– 10:00 Uhr Visite Assistenzarzt
Dienstag und Freitag von 08:15 – 10:00 Uhr Visite Chefarzt / Oberarzt (alternierend)
Täglich von 16:00 – 16:30 Uhr: Röntgenrapport
Montag und Mittwoch 16:30 – 17:00 Uhr Fallbesprechung Pneumologie
Donnerstag 08:15 – 10:00 Uhr Tumorboard und Kolloquium mit der Onkologie, der
Radioonkologie Winterthur, Chirurgie & Frauenklinik
Extern
Jedem Assistenzarzt stehen pro Jahr 3 Fortbildungstage zu, welche er frei wählen kann
(Voraussetzung: Bezug Innere Medizin), wobei sich das GZO mit bis zu 500 CHF beteiligt.
Die Kosten der Ultraschallkurse Abdomen (Grundkurs, Aufbaukurs, Abschlusskurs) werden
zu vom GZO übernommen, falls nach dem jeweiligen Kurs 50 supervisierte Sonographien
vorgewiesen werden (am GZO durchgeführt).
Zusätzlich verlangen wir obligatorisch den Besuch entweder eines ACLS- oder ALS-Kurs
(inkl. Bestehen der Prüfung) innerhalb 6 Monate nach Stellenantritt (entfällt, falls bereits vor
Stellenantritt absolviert). Falls der Kurs während der Anstellungsperiode absolviert wird,
werden die Kosten vollumfänglich übernommen.
2.6. Überprüfung des Weiterbildungserfolges
Der Stand der Weiterbildung wird alle 3 Monate anhand eines arbeitsplatzbasierten
Assessments überprüft; die Resultate der Assessments werden im Rahmen eines
persönlichen Mitarbeitergesprächs mit dem zuständigen Kaderarzt anhand einer
Checkliste besprochen.
Ergänzende Standortgespräche mit der Klinikleitung und dem
Weiterbildungsbeauftragten finden nach 2 Monaten, nach 6 Monaten und dann
jährlich statt. Diese dienen vor allem der Planung der weiteren Karriereschritte und
der Schwerpunktbildung (Spitalinternist oder Hausarzt). Es ist ein zentrales Anliegen
der Klinikleitung Assistenzärzte in ihren Weiterbildungs- und Berufszielen über die
Anstellung an unserer Klinik hinaus zu fördern und zu unterstützen.
Nach jeder Chefarztvisite wird im Team eine gegenseitige Visitenfeedbackrunde
durchgeführt.
Lernziele/-inhalte inkl. Eingriffe und Interventionen werden in einem Log Buch erfasst
(vergleiche Weiterbildungsprogram Allgemeine Innere Medizin vom 01.01.2011
www.fmh.ch/bildung-
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 7/12siwf/weiterbildung_allgemein/weiterbildungsprogramme/allgemeine_innere_medizin.h
tml).
Der Besuch externer Veranstaltungen wird über die Teilnahmebescheinigung des
Veranstalters bestätigt.
Videovisiten und- feedback werden auf Veranlassung des zuständigen
Abteilungskaderarztes durchgeführt.
Wetzikon, 01.09.2018
Prof. Dr. med. et dipl. chem. ETH, FESC, FHFA
Urs Eriksson
Weiterbildungsverantwortlicher Chefarzt Innere Medizin
Vorsteher Departement Medizin
CMO GZO AG
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
Facharzt für Intensivmedizin
Facharzt für Kardiologie
Fähigkeitsausweis Klinische Notfallmedizin SGNOR
Fähigkeitsausweis Abdomensonographie SGUM
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 8/12Anhang: Detaillierte Weiterbildungsinhalte
1. Allgemeiner Weiterbildungsinhalt
Der Weiterbildungsinhalt entspricht den von der Fachgesellschaft definierten Lernzielen
Basisweiterbildung, Hausarztmedizin und Spitalinternist (www.fmh.ch/bildung-
siwf/weiterbildung_allgemein/weiterbildungsprogramme/allgemeine_innere_medizin.html)
Die Klinik für Innere Medizin der GZO AG garantiert, dass das gesamte
Weiterbildungsspektrum Allgemeine Innere Medizin an unserem Haus absolviert werden
kann.
Folgende Werte stehen an unserer Klinik im Zentrum
1. Verpflichtung zur Qualität und Evidenz
2. Engagement für den Patienten und Bekenntnis zur ethischen Verantwortung
3. Kenntnis eigener fachlicher und kommunikativer Möglichkeiten und Grenzen
4. Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen
2. Spezifische praktische Fertigkeiten
2.1. Arbeit auf der Station und im Ambulatorium
Die Betreuung von stationären und ambulanten Patienten erfolgt unter Supervision eines
Kaderarztes.
Im Vordergrund der Arbeit am Patienten stehen die Erhebung einer problemorientierten und
fundierten Anamnese und die Durchführung der korrekten physikalischen Untersuchung,
auch bei unkooperativen, verwirrten und polymorbiden Menschen. Es folgt die Integration und
Interpretation von Anamnese und Untersuchungsbefunden mit Erstellen einer gewichteten
Problemliste mit Differentialdiagnosen.
Die Problemliste mündet in der Einleitung von medizinisch, ethisch und ökonomisch
sinnvollen diagnostischen und therapeutischen (pharmakologischen oder interventionellen)
Massnahmen. Parallel mit der laufenden Interpretation und Integration von Laborresultaten
und apparativ-technischen Untersuchungsbefunden erfolgt die Erstellung eines kurz- und
längerfristigen Betreuungsplanes inklusive dem gezielten Beiziehen von Fachspezialisten und
Konsiliarärzten. Dabei legen wir grossen Wert auf die Fähigkeit zur Abschätzung der
Hospitalisationsbedürftigkeit bzw. der voraussichtlichen stationären Aufenthaltsdauer.
Die Betreuung des Patienten erfolgt unter Miteinbezug der Pflege und anderer Berufsgruppen
des Gesundheitswesens und legt hohen Wert auf den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses
zum Patienten und seinen Angehörigen. Dementsprechend ist für uns die Schulung der
Gesprächsführung, der Kommunikationskompetenz und der Erkennung des individuellen
psychosozialen Hintergrundes unserer Patienten ein zentrales Weiterbildungsanliegen.
Bei stationären und ambulanten Patienten ist die Nachsorge zentral. Wir schulen unsere
Ärzte darauf, bei unseren Patienten Pflege- und Unterstützungsbedürftigkeit, sowie das
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 9/12realistische Rehabilitationspotential zu erkennen und die entsprechenden Massnahmen zu
veranlassen. Hier spielt die Kommunikation mit Kollegen anderer Fachrichtungen am Spital
und in der Praxis, sowie anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen erneut eine wichtige
Rolle.
2.2. Arbeit auf der Intensivpflegestation unter kaderärztlicher Supervision
Aufnahme und Betreuung von kritisch-kranken Patienten mit unter anderem Kreislauf- und
Rhythmusinstabilität, schwerer Sepsis, verschiedenen Schockzuständen, akutem
Koronarsyndrom, respiratorischer Insuffizienz bis zum Multiorganversagen und ARDS,
zerebralen Ereignissen, Intoxikationen, schweren metabolischen und endokrinen Störungen,
Säure/Basen- und Elektrolytentgleisungen usw.
Kenntnis der Grundlagen des Kreislauf- und Ventilationsmonitoring
Kenntnis der Grundlagen der enteralen und parenteralen Ernährung, sowie der
adäquaten Substitution von Flüssigkeit und Elektrolyten
Kenntnis der Notfall - Transfusionsprinzipien und des Vorgehens bei bedrohlichen
Blutungs-, Gerinnungs- und Blutbildungsstörungen
Kenntnis der Grundlagen der invasiven und nichtinvasiven maschinellen Beatmung.
Kenntnis der Grundlagen des akuten Nierenersatzverfahrens (Hämofiltration)
Kenntnis der Grundlagen der Behandlung von Patienten mit spezifischen
Krankheitsbildern wie Intoxikationen, Hypo- und Hyperthermie, Stromunfall, etc.
Betreuung von potentiellen Organspendern und Kenntnis der Möglichkeiten und
(ethischen/technischen) Grenzen der Intensivmedizin
Einblicke in die Triage, Bewirtschaftung und das Verlegungsprozedere einer
Intensivstation
2.3. Arbeit auf der Notfallstation unter kaderärztlicher Supervision
Effiziente Triage von Bagatellnotfällen und potentiell lebensgefährlichen Krankheiten.
Erheben einer situationsangepassten gezielten Anamnese und Einleitung von
problemorientierten diagnostischen und therapeutischen Massnahmen bei
stationären und ambulanten Notfallpatienten
Beherrschung der Sofortmassnahmen bei lebensbedrohlichen internistischen
Notfällen, inklusive der Reanimation bei Herz-Kreislaufstillstand
Kenntnisse der organisatorischen Voraussetzungen zum Betreiben einer
Notfallstation
Betreuung ambulanter Tagesklinikpatienten
2.4. Interventionen und Eingriffe
Urineinmal- und Dauerkatheter
Periphere Venenverweilkanülen
Arterielle Punktionen (radial, femoral, brachial)
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 10/12 Knochenmarkspunktion und Knochenmarksbiopsie in Lokalanästhesie und
Analgosedation
Zentrale Venenkatheter – Subclaviazugang & ultraschallgesteuert jugulär
Einlage arterieller Drucksonden radial und femoral
Diagnostische und therapeutische Pleurapunktionen
Diagnostische und therapeutische Aszitespunktionen
Lumbalpunktionen, intrathekale Medikamentenapplikationen
Thoraxdrainagen (immer mit Pneumologen oder Intensivmediziner)
Elektrokonversionen (immer mit Kardiologen oder Intensivmediziner)
Diagnostische & therapeutische Punktion von Knie, Schulter und Zehengrundgelenk
Feinnadelpunktionen (immer mit dem Oberarzt)
Kleine Wundversorgung (mit dem chirurgischen Konsiliararzt)
Beherrschung der Reanimationsabläufe
2.5. Internistische Spezialuntersuchungen
Ruhe-EKG
24-Stunden Blutdruck
24-Stunden EKG
Belastungs-EKG (Fahrrad und Laufbandergometrie)
Spiroergometrie (immer mit dem Kardiologen oder Pneumologen)
Blutgasanalysen, Sauerstofftitrationen
Nächtliche Pulsoxymetrien
Kleine Lungenfunktion
Grosse Lungenfunktion (mit dem Pneumologen)
Blutbild Urinsediment (im Labor)
Grampräparate (Sputum, Punktat, ev. Liquor im Labor)
APAP / CPAP / BiPAP Geräteanpassungen (immer mit dem Pneumologen)
Transkutane CO2-Messungen (immer mit dem Pneumologen)
2.6. Sonographie
Ziel ist die Basiskompetenz in Sonographie, die mit dem Erwerb des
Fähigkeitsausweises SGUM erreicht wird.
Restharnbestimmung (Supervision durch internistische Oberärzte).
Abdomenultraschall (Supervision durch Gastroenterologen / internistische Kaderärzte
(SGUM Tutoren).
Pleura-/Lungenultraschall (Supervision durch Pneumologen / internistische
Kaderärzte (SGUM Tutoren)).
2.7. Umgang mit der medizinischen Fachliteratur/ Evidence Based Medicine
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 11/12 Der effiziente und kritische Umgang mit der medizinischen Literatur ist zentral. Alle
Arztbüros sind mit PC-Arbeitsplätzen ausgerüstet die den Zugang ins Internet und
damit eine moderne Literatursuche ermöglichen. Folgende
Datenbanken/Suchmaschinen stehen unseren Mitarbeitern von jedem PC und Laptop
jederzeit zur Verfügung: Pubmed, Uptodate, Documed, Notfallstandards (in
Zusammenarbeit mit der interdisziplinären Notfallstation des Universitätsspitals
Basel).
Zusätzlich haben unsere Ärzte online Volltextzugriff auf die wichtigsten Zeitschriften
der Allgemeinen Inneren Medizin und ihrer Spezialgebiete.
Journal-Club, bei dem ein Assistenzarzt eine entweder kürzlich publizierte oder sehr
wegweisende Arbeit den anwesenden Kollegen und Kaderärzten kritisch erörtert.
Dabei legen wir besonderen Wert auf das Verständnis der Terminologien der
Evidence –Based-Medicine (absolute, relative Risikoreduktion, Signifikanz,
Konfidenzintervalle, NNT, etc...).
CAT (critical appraisal of a Topic), bei dem jeweils zwei Assistenzärzte eine klinische
Fragestellung systematisch anhand der aktuellen Literatur nach definierten Kriterien
kritisch betrachten und ihre Konklusion präsentieren.
Die Erstellung von Fallberichten und klinischen Forschungsarbeiten wird aktiv
gefördert bzw. unterstützt. Die Arbeiten sollen entweder als Abstracts an den
Jahrestagungen der schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin,
oder als Artikel in nationalen oder internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht
werden.
GZO-Weiterbildungskonzept Departement Innere Medizin 01.01.2019 12/12Sie können auch lesen