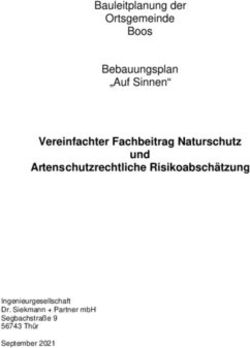IN DER HOFFNUNG AUF DAS EWIGE LEBEN WÜRDIG LEBEN - UND STERBEN1
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
IN DER HOFFNUNG AUF DAS EWIGE LEBEN
WÜRDIG LEBEN – UND STERBEN1
Kurt Cardinal Koch
„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke
in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ In dieser weisen und sensiblen
Anweisung des französischen Piloten und Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry kommt
seine tiefe Lebensüberzeugung zum Ausdruck, dass es viel besser ist, in den Menschen die
Sehnsucht nach dem weiten Meer zu wecken als die Arbeit zu organisieren. Saint-Exupéry
war dabei natürlich ebenso der Überzeugung, dass, wenn die Sehnsucht nach dem weiten,
endlosen Meer in den Menschen einmal geweckt ist, sie von selbst unverzüglich an die Arbeit
gehen und das geplante Schiff bauen werden. Wenn wir diese Weisheit auf den christlichen
Glauben und seinen Lebensvollzug übertragen, muss man sie sinngemäss dahingehend
abwandeln: Es ist viel wichtiger und auch lebensdienlicher, in den Menschen heute die
Sehnsucht nach dem weiten Meer des ewigen Lebens zu wecken als das gegenwärtige Leben
zu organisieren. Auch hier muss freilich die Kehrseite dieser Weisheit ebenso wahrgenommen
werden, dass der Ausblick der Hoffnung auf das ewige Leben keineswegs den Einblick in das
gegenwärtige irdische Leben trübt oder gar verhindert, sondern erst recht neues Licht auf das
gegenwärtige Leben fallen lässt und ihm seine tiefste Würde schenkt. Dies gilt zumal, da der
christliche Glaube unter dem ewigen Leben nicht nur jenes Leben versteht, das später einmal,
nämlich nach dem Tod, kommen wird, sondern auch und sogar in erster Linie das wirkliche
Leben, das deshalb ewig ist, weil kein Tod es mehr zerstören kann und es deshalb nicht
untergeht.
1. Vertröstung auf das Jenseits und Diesseitsvertröstung
Der christliche Glaube ist überzeugt, dass die Hoffnung auf das ewige Leben hilft, das
irdische Leben würdig zu gestalten und auch, wenn es Zeit ist, in Würde zu sterben. Diese
Glaubensüberzeugung steht freilich quer zu einer breiten Strömung im neuzeitlichen Denken,
von dem selbst viele Christen massgeblich geprägt sind. In ihnen steckt die Angst vor den
religionskritischen Vorwürfen der Weltflucht und der Jenseitsvertröstung sehr tief. Diese
Angst haben den modernen Christen vor allem Ludwig Feuerbach und Karl Marx massiv
eingeimpft. Sie haben ihnen vorgeworfen, sie würden mit ihrer Hoffnung auf das ewige Leben
das gegenwärtige Diesseits verraten und sie seien deshalb diesseitsvergessene „Kandidaten
des Jenseits“. Es würde zu weit führen, wollte man untersuchen, inwieweit diese Vorwürfe in
der damaligen Zeit berechtigt gewesen sind. Heute jedoch pflegen nicht wenige Christen die
Hoffnung über den Tod hinaus auf das ewige Leben zugunsten der Einsicht in die reale
Situation des menschlichen Lebens vor dem Tod preiszugeben, so dass ihnen kaum mehr
jemand vorwerfen kann, sie seien diesseitsblinde „Kandidaten des Jenseits“. Sie sind vielmehr
auf weiten Strecken selbst zu jenseitsvergessenen Studenten des Diesseits geworden. An die
Stelle einer früheren Jenseitsvertröstung ist weithin die Vertröstung mit dem Diesseits
getreten, wie der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner sensibel diagnostiziert: „Uns
Heutigen bleibt der Himmel die meiste Zeit verschlossen. Der Jahrhunderte lang zu Recht
befürchteten Vertröstung auf das Jenseits ist eine anstrengende Vertröstung auf das Diesseits
gewichen.“2
In der Zwischenzeit ist freilich stets offensichtlicher geworden, dass eine solche
Diesseitsvertröstung keineswegs lebensdienlich ist und das irdische Leben nicht mit mehr
1
Vortrag bei der 16. Quartner-Tagung 2012 im Bildungszentrum Neu-Schönstatt in Quarten am 25. August 2012.
2
P. M. Zulehner, Ein Obdach der Seele. Geistliche Übungen – nicht nur für fromme Zeitgenossen (Düsseldorf 1994) 18.2 Sinn und Freude zu erfüllen vermag, und zwar aus einsichtigen Gründen. 3 Wenn nämlich der Himmel als Inbegriff des ewigen Lebens dem Menschen verschlossen bleibt, dann drängt sich ihm unweigerlich der Versuch und die Versuchung auf, den Himmel nun gleichsam auf Erden zu suchen und zu finden. Für dieses Bemühen stehen in der heutigen gesellschaftlichen Lebenswelt freilich nur wenige Betätigungsfelder zur Verfügung, genauerhin drei: das Amüsement, die Arbeit und die Liebe. Es ist aber kein Zufall, dass prominente Fachexperten des modernen Lebens davon sprechen, dass die Menschen sich heute zu Tode amüsieren, dass sie sich zu Tode arbeiten und dass sie sich sogar zu Tode lieben. 4 Mit dieser angestrengten Diesseitigkeit wird eine alte Weisheit ausgeblendet, die besagt: „Wer die Erde zum Himmel machen will, macht sie zuverlässig zur Hölle.“5 Nicht wenige Probleme des menschlichen Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der heutigen Zeit hängen damit zusammen, dass die christliche Hoffnung auf das ewige Leben ausbleibt. Dies zeigt sich, um nur ein besonders bedrängendes Phänomen zu benennen, vor allem daran, dass für viele Menschen ihre Lebenszeit zum grossen Problem geworden ist. Dieses hat seinen Grund darin, dass wir heute zwar immer länger, faktisch jedoch viel kürzer leben. Diesen grossen Unterschied im Zeitempfinden hat die deutsche Soziologin Marianne Gronemeyer in ihrem Buch mit dem signifikanten Titel „Das Leben als letzte Gelegenheit“ so ausgedrückt: Die Menschen lebten früher vierzig Jahre plus ewig. Heute jedoch leben sie nur noch neunzig Jahre. Und dies ist ungemein viel kürzer. 6 Diese Feststellung kann verdeutlichen, dass die Gehetztheit des heutigen Lebens weitestgehend damit zusammenhängt, dass wir zuwenig von der Ewigkeit und damit vom Ausblick auf den Himmel her leben. Wenn wir nämlich auf das ewige Leben hin leben und in der Hoffnung auf das ewige Leben unsere Gegenwart gestalten, dann ist uns mehr Zeit gegeben. Es wird uns dann zwar vollends bewusst, dass unser Leben ein befristetes und durch Anfang und Ende begrenztes Leben ist. Wenn wir aber dem biblischen Urteil vertrauen, dass die Befristetheit des menschlichen Lebens eine dem Menschen zugute kommende Wohltat ist, und wenn wir im hoffnungsvollen Blick über den Tod hinaus im Glauben darum wissen, dass unser Leben gerade nicht die „letzte Gelegenheit“ ist, sondern eine gute Gelegenheit, unser irdisches Leben zu gestalten und uns dabei auf die endgültige Begegnung mit dem ewigen Gott vorzubereiten, dann werden wir uns nicht krampfhaft an unserer irdischen Lebenszeit festkrallen und dabei versuchen, aus dem Leben das Maximum – natürlich für uns selbst – herauszupowern. Der Blick über den Tod hinaus und damit das Leben unter dem geöffneten Himmel schenken uns vielmehr die christliche „Entdeckung der Langsamkeit“ (Sten Nadolny), die nur im Horizont der Ewigkeit Gottes aufzuscheinen vermag. Nur wer des ewigen Lebens bei Gott gewiss ist, hat viel Lebenszeit und wird die Erfahrung machen, dass die Lebensintensität eines einzigen Augen-Blicks in der Gegenwart Gottes mehr ist als das extensive Durcheilen unserer Lebenszeit, wie der reformierte Theologe Jürgen Moltmann mit Recht hervorhebt: „Die Erfahrung der Gegenwart des ewigen Gottes bringt unser zeitliches Leben wie in einen Ozean, der uns umgibt und trägt, wenn wir in ihm schwimmen.“7 Solches Schwimmen in der Gegenwart des ewigen Gottes nimmt dem menschlichen Leben keineswegs seinen Ernst, sondern gibt ihm vielmehr die Gelassenheit des Glaubens zurück. 3 Vgl. K. Koch, Jenseitsvertröstung oder Jenseitsverdrängung? Theologischer Zwischenruf in das heutige Schweigen über das ewige Leben, in: Ders., Konfrontation oder Dialog? Brennpunkte heutiger Glaubensverkündigung (Freiburg / Schweiz - Graz 1996) 96-104. 4 Vgl. N. Postman, Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie (Frankfurt a. M. 1985); D. Fassel, Wir arbeiten uns zu Tode. Die vielen Gesichter der Arbeitssucht (München 1991); U. Beck – E. Beck-Gernsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe (Frankfurt a. M. 1990). 5 O. Marquard, Moratorium des Alltags. Eine kleine Philosophie des Festes, in: W. Haug und R. Warning (Hrsg.), Das Fest = Poetik und Hermeneutik XIV (München 1969) 684-691, zit. 689. 6 A. Gronemeyer, Das Leben als letzte Gelegenheit. Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit (Darmstadt 1993). 7 J. Moltmann, Christlicher Glaube im Wertewandel der Moderne, in: Ders., Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Relevanz der Theologie (Gütersloh 1997) 73-88, zit. 87.
3
Denn wer sein jetziges Leben in der Hoffnung auf ein Leben, das nie mehr vergehen wird,
verankert weiss, wird nicht nur zu einem neuen Umgang mit seinem irdischen Leben befreit,
sondern wird auch der tiefen Würde seines jetzigen Lebens ansichtig. Dass die christliche
Hoffnung auf das ewige Leben ein entscheidendes Fundament für die Würde des
menschlichen Lebens bildet, kann man bereits ablesen an der geschichtlichen Entwicklung
der biblischen Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott. Wie sehr es uns heutige Christen
immer wieder überraschen mag, so erweist sich der Glaube an ein Leben nach dem Tod als
ein in der biblischen Tradition relativ spät gewachsene Überzeugung. Ihre Entstehung hängt
vor allem mit der Vereinzelung des Individuums gegenüber dem Volksganzen in der
nachexilischen Zeit zusammen. Der entscheidende Ausgangspunkt für das Erwachen der
Auferstehungshoffnung ist die „Verselbständigung des einzelnen gegenüber der Gesellschaft,
eine Einstellung zum Leben, die den einzelnen nicht aufgehen lässt im gesellschaftlichen
Lebenszusammenhang, sondern einen eigenen Lebenssinn für das individuelle Dasein fordert,
einen Sinn, der sich am einzelnen selbst erfüllt“ 8. Mit dieser Überzeugung bahnte sich die
revolutionäre Wende zu jener Auffassung vom unendlichen Wert des einzelnen Menschen vor
Gott an, die eine unzerstörbare Würde des einzelnen auch gegenüber der Gesellschaft
begründet. Diese Überzeugung hängt auf das Engste zusammen mit der biblischen Hoffnung
auf ein Leben über den Tod hinaus.
Der geschichtliche Zusammenhang zwischen der biblischen Auferstehungshoffnung und der
Überzeugung von der unzerstörbaren Würde des einzelnen Menschenlebens provoziert
umgekehrt das bedrängende Urteil, dass das heutige Verdunsten des Glaubens an ein Leben
nach dem Tod und damit die Abwendung von den urreligiösen Lebensfragen nach Tod und
ewigem Leben ein auch für die Entwicklung der gegenwärtigen Gesellschaft alarmierendes
Phänomen darstellen und gefährliche Erosionen der Grundlagen der individuellen Freiheit des
einzelnen Menschen und seiner Würde implizieren. Denn letztlich vermag nur die Hoffnung
auf ein ewiges Leben ein tragfähiges Fundament für die Respektierung der Würde des
menschlichen Lebens abzugeben; und letztlich erweist sich nur die Hoffnung auf ein ewiges
Leben als die zureichende Entsprechung zu den menschlichen Grundfragen nach Leben und
Sterben in dieser vergänglichen Welt.
2. Der Tod als Ernstfall der christlichen Lebenshoffnung
Damit sind die Wirklichkeit des Todes und die Unumgänglichkeit unseres Sterbens vor
Augen getreten, die das bisher über den positiven Wert und Sinn des menschlichen Lebens
Gesagte wieder in Frage zu stellen drohen. Denn der Tod wartet nicht nur unausweichlich am
Ende jedes Menschenlebens; der Tod bildet vielmehr das Ende aller für das Gedeihen des
menschlichen Lebens so grundlegenden Beziehungen. Das Wesen, beziehungsweise das
Unwesen des Todes ist die Verhältnislosigkeit. 9 Hinzu kommt das Wissen, dass der Tod
allgegenwärtig ist und sogar in die Mitte des Lebens einbricht, wie es in einem der grossen
und alten Choräle der Christenheit heisst: „Mitten im Leben sind wir mit dem Tod
umfangen.“ Dieser kurze, aber inhaltschwere Satz formuliert eine unbestreitbare
Lebenserfahrung von uns Menschen. „Mitten im Leben“ reisst der Tod klaffende Lücken in
unserem Lebenskreis auf im Wegstreben von uns nahen und lieben Menschen. Auch im
eigenen Leben erfahren wir Vorboten des Todes in Krankheit und Schmerz, im Leiden und
Älterwerden, aber auch auf der psychisch-geistigen Ebene in den Erfahrungen der Nichtigkeit
eines leer gewordenen Lebens, das manchmal mehr einem Schatten von Leben gleicht, als
dass es wirkliches Leben ist. Mit solchen Erfahrungen werden wir auf die harte Wahrheit auch
unseres eigenen Lebens zurückgeworfen. Die konstante Anwesenheit des Todes „mitten im
8
W. Pannenberg, Tod und Auferstehung in der Sicht christlicher Dogmatik, in: Ders., Grundfragen systematischer Theologie. Band 2
(Göttingen 1980) 146-159, zit. 147.
9
Vgl. E. Jüngel, Tod (Stuttgart 1971).4
Leben“ gemahnt uns hautnah unserer eigenen Endlichkeit, Hinfälligkeit und Sterblichkeit.
Dies ist die harte Wahrheit und die nackte Realität in unserem Leben, angesichts derer wir zur
Rechenschaft darüber herausgefordert sind, wie wir uns zu dieser Wirklichkeit unseres
Lebens verhalten.
Eine solche Rechenschaft drängt sich zumal in der heutigen Gesellschaft auf, in der eine recht
zwiespältige, wenn nicht gar widersprüchliche Einstellung zu Sterben und Tod festzustellen
ist. Auf der einen Seite ist eine geradezu voyeuristische Zur-Schau-Stellung des Sterbens und
des Todes in Fernsehen, Film und Kino gleichsam omnipräsent. Allein an einem
Fernsehabend werden unzählige Tode gezeigt, wobei es sich zumeist um gewaltsame Tode
durch Unglücksfall oder Verbrechen, Terror oder Krieg handelt. Der tägliche Tod jedenfalls
gehört zur Unterhaltung im Fernsehen; und in ihr geniesst die Darstellung von Gewaltakten
eine hohe Priorität. Die Gewaltthematik verbindet sich in den Medien zudem sehr oft mit der
Vermarktung des erotischen Bildes, so dass die Gewalt in der Sexualität eine besonders hohe
Anziehungskraft in der medialen Öffentlichkeit erhält.10
Dieser banalisierenden Zur-Schau-Stellung von Sterben und Tod gegenüber ist auf der
anderen Seite in der heutigen Gesellschaft eine weitgehende Tabuisierung von Sterben und
Tod festzustellen, die als unpassende Realitäten so gut wie möglich versteckt und aus dem
alltäglichen Leben und Bewusstsein verdrängt werden: Wir pflegen unseren Blick vom
menschlichen Todesgeschick abzuwenden, soweit und solange es irgendwie geht. Wir
schminken sogar die Vorboten des Todes aus unseren Gesichtern weg, damit ja niemand
entdecken kann, wie unerbittlich wir uns auf der Einbahnstrasse zum Sterben befinden.
Schliesslich verbannen wir unsere kranken und leidenden, alten und sterbenden Menschen
hinter die Mauern von Altersheimen und Kliniken, so dass das Sterben gleichsam nur noch
hinter den weissgelackten Tüchern der hoch technisierten Medizin stattfinden kann. Wenn der
Tod überhaupt in unser Blickfeld gerät, dann betrifft er jedenfalls immer – die anderen.
Bereits der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts
ebenso treffsicher wie sensibel beobachtet, dass jeder Mensch jeden Menschen für sterblich
hält – ausgenommen sich selbst. Der Tod ist zwar die todsicherste Tatsache unseres Lebens;
während unseres Lebens halten wir ihn jedoch oft genug für dessen unwahrscheinliche
Zukunft.
Sowohl die banalisierende Zur-Schau-Stellung von Sterben und Tod als auch deren
tabuisierende Verdrängung in der heutigen Gesellschaft drohen das Sterben – und damit
natürlich auch das Leben – zu entmenschlichen. Denn das Sterben ist nicht nur das Ende des
Lebens und es findet schon gar nicht jenseits der Grenze des Lebens statt; es gehört vielmehr
zum Leben hinzu und ist gleichsam sein letzter Vollzug. Wir sterben nicht nur, solange wir
leben, sondern wir leben auch, solange wir sterben. Diese Zusammengehörigkeit von Leben
und Sterben hat zur Konsequenz, dass wir mit unserer Einstellung zu Sterben und Tod
zugleich über die Einstellung zum Leben mitentscheiden, wie Papst Benedikt XVI. in seinem
frühen Buch über „Tod und ewiges Leben“ sensibel diagnostiziert hat: „Der Tod wird so zum
Schlüssel für die Frage, was eigentlich der Mensch ist.“11
Dass das Problem des Todes die Frage nach dem Menschsein des Menschen wachruft, ist vor
allem darin begründet, dass der Mensch das einzige Lebewesen in der ganzen Schöpfung ist,
das um seinen Tod weiss: „Ein Hund, der stirbt, und der weiss, dass er stirbt, und der sagen
kann, dass er weiss, dass er stirbt, ist ein Mensch.“ Es gibt gewiss würdevollere Definitionen
des Menschen als diejenige des Dichters Erich Fried. Sie ist aber die grundlegende, insofern
10
Vgl. W. Huber, Die tägliche Gewalt. Gegen den Ausverkauf der Menschenwürde (Freiburg i. Br. 1993).
11
J. Ratzinger, Eschatologie. Tod und ewiges Leben (Regensburg 1977) 68.5
das Wissen um Sterben und Tod das menschliche Sterben vom Verenden eines Tieres
unterscheidet und einen wichtigen Teil der menschlichen Würde ausmacht. Denn der Mensch
stirbt nicht einfach; er weiss vielmehr darum, dass er sterben muss und dass er sich deshalb zu
seinem eigenen Sterben verhalten muss. Sein Sterben ragt als eine ständige und bedrohliche
Möglichkeit mitten in sein Leben hinein: „Mitten im Leben sind wir mit dem Tod umfangen.“
Jeder Mensch lebt, ob er sich nun dessen immer bewusst ist oder nicht und ob er es will oder
nicht, im Angesicht seines Todes; und die Frage nach dem Sinn von Sterben und Tod stellt
sich unabweisbar. Doch genau darin besteht das noble Grundwesen des Menschen. Jeder
Mensch ist von adeliger Natur, nämlich „von und zu“. Er lebt von der Geburt zum Tod, vom
Kindesbett zum Todesbett.
3. Das Sterben als eigene Tat oder als Erleiden
Im Wissen um das eigene Sterben und den Tod liegt freilich nur die eine Seite des noblen
Grundwesens des Menschen. Wie sehr der Mensch mit Gewissheit weiss, dass er einmal
sterben muss und sterben wird, so sehr bleibt er auf der anderen Seite bis zuletzt im
Ungewissen über Zeit, Art und Umstände seines Sterbens. Diese zwiespältige Einstellung des
Menschen zu Sterben und Tod hat die Tradition mit der alten Weisheit zum Ausdruck
gebracht, dass der Tod ganz sicher, die Todesstunde hingegen ungewiss ist: „Mors certa –
hora incerta“.
Diese alte Weisheit hat in der heutigen gesellschaftlichen Situation eine ganz neue Aktualität
und Brisanz gewonnen. Die gestiegene Lebenserwartung der Menschen führt dazu, dass die
Zahl der chronisch kranken Menschen, die über lange Jahre hinweg pflegebedürftig sind, im
Steigen begriffen ist, so dass die mögliche Aussicht, das eigene Leben später einmal unter
derartigen Belastungen und Einschränkungen führen zu müssen, nicht nur in den Augen von
jungen Menschen als erschreckend erscheint. Die Entwicklungen in der modernen
Intensivmedizin wecken bei vielen Menschen Befürchtungen und Ängste angesichts der
technischen Möglichkeiten, menschliches Leben zu verlängern und möglicherweise gegen
den eigenen Willen aufgrund von künstlich am Leben erhaltenden Massnahmen am eigenen
Sterben gehindert zu werden. Angesichts der enormen Möglichkeiten der modernen
Hochleistungsmedizin wollen immer mehr Menschen den Zeitpunkt ihres Sterbens selbst
bestimmen und töten sich selbst oder lassen sich beim Suizid assistieren, weil sie im Grunde
Angst vor dem Sterben haben. Angesichts der Entwicklung der medizinischen Techniken
scheint sich jene Paradoxie zu wiederholen, die in der Zeit zwischen den Weltkriegen in
Amerika festgestellt werden musste. Als damals ein Hörspiel über das Weltende produziert
worden war, hat dieses auf nicht wenige Menschen offensichtlich so realistisch gewirkt, dass
sie gedacht haben, das Ende der Welt stünde wirklich bevor. Dies hat damals zur Konsequenz
gehabt, dass das Hörspiel eine ganze Reihe von Selbsttötungen ausgelöst hat: Menschen
haben sich das Leben genommen, um nicht sterben zu müssen. In ähnlicher Weise wollen
angesichts der medizinischen Techniken der Lebensverlängerung Menschen sich selbst das
Leben nehmen, um nicht sterben zu müssen. Von daher kann man bei nicht wenigen
Menschen den Wunsch verstehen, über Zeitpunkt, Art und Umstände des Sterbens selbst
bestimmen zu wollen. Mit aktiver Sterbehilfe oder mit Beihilfe zur Selbsttötung, die
schönfärberisch „Freitodhilfe“ genannt wird, will der Mensch das Sterben selbst in die Hand
nehmen und aus dem verhängten Schicksal des Sterbens einen Akt der menschlichen
Selbstbestimmung machen. Dabei pflegt man sich gerne auf den vom Dichter Rainer Maria
Rilke in seinem Gedichtzyklus „Das Stunden-Buch“ geäusserten Wunsch zu berufen: „O
Herr, gib jedem seinen eigenen Tod.“
Die Überzeugung, dass der Mensch in der Lage und im Recht ist, aus dem Tod als dem Ende
des Lebens und als dem Abbruch allen Handelns nun selbst einen Akt der eigenen6
Selbstbestimmung zu machen, ist freilich nicht eine neue Erscheinung, sondern lässt sich nur
verstehen auf dem Hintergrund einer breiten philosophischen und theologischen Tradition, die
in dieser Richtung vorgedacht hat. Vor allem der deutsche Philosoph Martin Heidegger hat
die Überzeugung vertreten, dass sich das menschliche Dasein im Tode zum Ganzen vollende
und der Tod somit die Ganzheit des menschlichen Daseins begründe. Heidegger lässt zwar
den Tod selbst ungedeutet, da es ihm nur um die Bedeutung des Todes für das
Selbstverständnis des menschlichen Daseins geht, und zwar dahingehend, dass das Wissen um
den eigenen Tod und das Vorlaufen auf den Tod hin das Ganzseinkönnen des Daseins
erschliessen. Dennoch erweist sich die diesem philosophischen Ansatz zugrunde liegende
Überzeugung als fraglich, der Tod vermöge das Leben in seine Ganzheit zu bringen und das
individuelle Leben zu vollenden. Die menschliche Erfahrung legt vielmehr die umgekehrte
Annahme nahe, dass der Tod gerade alle mögliche Vollendung so sehr zunichte macht, „dass
Vollendung – wenn überhaupt – nur jenseits des Todes möglich wäre und nur im Lichte
solcher jenseitigen Vollendung ihr Abglanz im gegenwärtigen Leben wahrnehmbar werden
kann“12.
Als besonders problematisch ist es zu beurteilen, dass die Vorstellung vom Tod als einer Tat
des Menschen auch in die katholische Theologie eindringen konnte. Am ehesten
nachvollziehbar ist dabei die Theologie des Todes bei Karl Rahner, der den Tod als „Einheit
von Ende und Vollendung“ des menschlichen Lebens versteht 13. Auch wenn es ihm letztlich
um den Doppelcharakter des menschlichen Todes geht, der für ihn zugleich ein Widerfahrnis
von aussen und tätige Vollendung von innen, also zugleich passives Erleiden und eigene freie
Tat ist, so ist mit dem Theologen Joseph Ratzinger dennoch die entscheidende Rückfrage an
Rahner zu stellen, ob bei ihm nicht die Aktivität des Menschen beim Tod zu stark betont wird
und ob nicht deutlicher gesehen werden müsste, „dass die christliche eben wesentlich
Hinnahme, die Hinnahme von Gottes Tun ist“14. Diese Rückfrage ist vor allem an jene
Tendenzen in der katholischen Theologie zu richten, die den Tod als entscheidende und
höchste Tat im Menschenleben, gleichsam als Aufgipfelung der menschlichen
Lebensmöglichkeiten, verstehen. Gegen diese Übersteigerung des menschlichen Tuns im
Sterben spricht freilich bereits die Erfahrung. Wer je einen Menschen im Sterben begleitet
hat, hat erfahren können, dass der Tod gerade keine Tat ist, sondern das genaue Gegenteil
davon, nämlich das Aufhören allen Tuns. Der Tod besteht gerade darin, „dass uns endgültig
alles Tun aus der Hand geschlagen wird, dass wir aus Tuenden zu Erleidenden werden“: „Der
Tod ist keine Tat, sondern ein Erleiden, das Ende aller Taten.“15
Der christliche Glaube jedenfalls deutet den Tod nicht in ein Tun um, weil er das Höchste des
Menschen nicht in seiner Selbstbehauptung, sondern im „Sich-Fallen-Lassen in Gottes Hand
hinein“ wahrnimmt16. Im Licht des Glaubens ist deshalb das Urteil fällig, dass die
Behauptung, die der modernen Betonung des menschlichen Rechts auf Selbstbestimmung
über Leben und Sterben zugrunde liegt und besagt, der Tod sei eine Tat des Menschen, den
Tod von Grund auf verkennt und, weil sie den Tod verkennt, auch den Menschen verkennt.
Denn der Mensch ist nie nur ein Wesen der Aktivität und des Tuns, sondern immer auch ein
Wesen der Passivität und des Erleidens. Beim Menschen, der mit Schmerzen das Licht der
Welt erblickt und sich mit Schmerzen von dieser Welt wieder verabschiedet, gehören das
Leiden und die Fähigkeit des Leidens so sehr zu seinem Menschsein hinzu, dass man den
12
W. Pannenberg, Tod und Auferstehung in der Sicht christlicher Dogmatik, in: Ders., Grundfragen systematischer Theologie. Band 2
(Göttingen 1980) 146-159, zit. 155.
13
K. Rahner, Zur Theologie des Todes (Freiburg. i. Br. 1958) 31.
14
J. Ratzinger, Rezension zu: Karl Rahner, Zur Theologie des Todes (= QD 2), Freiburg i. Br. 1958, in: Wissenschaft und Weisheit 13
(1958) 644-646.
15
J. Ratzinger, Der Tod und das Ende der Zeiten, in: Ders., Auferstehung und ewiges Leben = Gesammelte Schriften 10 (Freiburg i. Br.
2012) 336-350, zit. 343.
16
Ebda. 348.7
Menschen abschaffen müsste, wollte man Leiden und Schmerz aus dem menschlichen Leben
verbannen. Ein Mensch, der sich dem Leiden, dem eigenen wie dem fremden, nicht stellt,
verweigert sich deshalb dem Leben, weil Leidensflucht letztlich Lebensflucht ist. Vielmehr
heilt, wie Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung hervorhebt,
nicht die „Vermeidung des Leidens“ und nicht die „Flucht vor dem Leiden“ den Menschen,
sondern die „Fähigkeit, das Leiden anzunehmen und in ihm zu reifen, in ihm Sinn zu finden
durch die Vereinigung mit Christus, der mit unendlicher Liebe gelitten hat“17.
4. Passive oder aktive Sterbehilfe
Mit dieser positiven Sicht des Leidens, das in das menschliche Leben integriert werden soll,
ist keineswegs ausgeschlossen, dass menschliches Leiden so gut wie möglich begrenzt und
bekämpft werden kann und soll. Dass sich auch und gerade beim Problem des Leidens die
Frage der Zumutbarkeit und der Verhältnismässigkeit stellt, hat bereits mit besonderer
Sensibilität Papst Pius XII. wahrgenommen. Angesichts der Möglichkeiten der modernen
Medizin, selbst in der Situation eines irreversibel gewordenen Sterbeprozesses das Sterben
eines Menschen in unverhältnismässiger Weise hinauszuzögern, sah sich der Papst veranlasst,
in seinen ethischen Reflexionen über die Möglichkeit eines Behandlungsverzichts oder
Behandlungsabbruchs zwischen ordentlichen und ausserordentlichen medizinischen Mitteln
zu unterscheiden. Dabei kam er zum Schluss, dass in jedem Fall die ordentlichen Mittel
eingesetzt werden und vor allem Grundpflege und Schmerzbekämpfung gewährleistet sein
müssen, wohingegen man auf die ausserordentlichen Mittel gegebenenfalls verzichten dürfe.18
Angesichts der medizinischen Möglichkeiten, für den Menschen unerträgliches Leiden zu
lindern, die aber eine Lebensverkürzung bewusst in Kauf nehmen, hat Papst Pius XII. sogar
geurteilt, ein Arzt dürfe seine Pflicht, die Schmerzen eines Sterbenden zu lindern, selbst dann
befolgen, wenn er dabei eine Verkürzung des Lebens des Betroffenen riskieren müsse. Denn
auch in diesem schwierigen Grenzfall hat als oberste ethische Maxime die Wahrung der
Menschenwürde im Sterben zu gelten, wie der Katechismus der Katholischen Kirche festhält:
„Schmerzlindernde Mittel zu verwenden, um die Leiden des Sterbenden zu erleichtern selbst
auf die Gefahr hin, sein Leben abzukürzen, kann sittlich der Menschenwürde entsprechen,
falls der Tod weder als Ziel noch als Mittel gewollt, sondern bloss als unvermeidbar
vorausgesehen und in Kauf genommen wird.“19
Das Lehramt der Katholischen Kirche hat damit unmissverständlich ausgesprochen, dass es
auch in der Sicht des christlichen Glaubens keine Verpflichtung zur Lebensverlängerung um
jeden Preis gibt und auch keine Verpflichtung, alle therapeutischen Möglichkeiten der
modernen Medizin bis zum Letzten auszuschöpfen, wie nochmals der Katechismus der
Katholischen Kirche ausführt: „Die Moral verlangt keine Therapie um jeden Preis.
Ausserordentliche oder zum erhofften Ergebnis in keinem Verhältnis stehende aufwendige
und gefährliche medizinische Verfahren einzustellen, kann berechtigt sein. Man will dadurch
den Tod nicht herbeiführen, sondern nimmt nur hin, ihn nicht verhindern zu können.“ 20 Mit
dieser Leitlinie wird nicht nur der Endlichkeit und Hinfälligkeit des menschlichen Lebens
Rechnung getragen, zu der es gehört, das Herannahen des Todes zuzulassen, wenn seine Zeit
gekommen ist. Diese Leitlinie verlangt aber auch vom Arzt, seine eigene Ohnmacht
angesichts des nahenden Todes des Patienten anzuerkennen und deshalb dessen Wunsch zu
respektieren, in Ruhe und Würde sterben zu dürfen. Denn die medizinische Kunst hat nicht
einer Lebensverlängerung um jeden Preis zu dienen, sondern dem Wohl eines konkreten
17
Benedikt XVI., Spe salvi, Nr. 37.
18
Pius XII., Rechtliche und sittliche Fragen der Wiederbelebung. Ansprache an eine Gruppe von Ärzten am 24. November 1957.
19
Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2279.
20
Ebda. 2278.8 Menschen, der auch in der letzten Phase seines Sterbeprozesses der ärztlichen Fürsorge bedarf. Damit dürfte deutlich sein, dass die Katholische Kirche in keiner Weise, wie es oft in der Öffentlichkeit verbreitet wird, jede Form von Sterbehilfe ablehnt. Sie anerkennt vielmehr die so genannte passive Sterbehilfe, die im Verzicht auf lebenserhaltende Massnahmen bei einem schwerkranken und sterbenden Menschen, um ihn in Ruhe sterben zu lassen, besteht. Die Katholische Kirche anerkennt auch die so genannte indirekte aktive Sterbehilfe, die die Linderung unerträglicher Schmerzen und Leiden zum Ziel hat, dabei aber eine mögliche Lebensverkürzung bewusst in Kauf nimmt. Denn bei beiden Formen handelt es sich um Hilfen beim Sterben, nicht hingegen um Hilfen zum Sterben. Die letzte Form liegt eindeutig bei der so genannten direkten aktiven Sterbehilfe vor, die in der gezielten und absichtlichen Tötung eines Menschen besteht, um dadurch dessen Leiden zu verkürzen und zu beenden, und bei der Beihilfe zum Suizid, die sich von der direkten aktiven Sterbehilfe nur dadurch unterscheidet, dass die finale Handlung, beispielsweise die Einnahme eines den Tod bringenden Mittels, vom Sterbewilligen selbst vorgenommen wird, während alle vorbereitenden Handlungen von einem Sterbebegleiter organisiert werden. Als besonders gravierend kommt hinzu, dass die Beihilfe zum Suizid oft lange vor einem finalen Sterbeprozess gewählt wird, beispielsweise als Reaktion auf eine schlechte Diagnose oder Prognose, vor allem im Zusammenhang mit schwer belastenden Krankheiten wie Krebs oder AIDS, und wenn eine längere Leidenszeit zu erwarten ist. Direkte aktive Euthanasie und assistierter Suizid kommen darin überein, dass sie einem Menschen nicht beim Sterben helfen, sondern ihm zuvorkommen. Sie verletzen in schwerwiegender Weise das Tötungsverbot und damit die grundlegende, alles menschliche Zusammenleben sichernde Norm. Sie können in ethischer Sicht nie erlaubt sein, und zwar auch dann nicht, wenn sie auf Verlangen des Leidenden oder aus Mitleid geschehen. Die absichtliche Tötung eines Menschen ist niemals mit dem ärztlichen Beruf zu vereinbaren, sondern widerspricht der grundlegenden Schutzpflicht gegenüber allem menschlichen Leben. Wie es nicht menschenwürdig ist, mit medizinischer Technik einen Menschen am Sterben gewaltsam dadurch zu hindern, dass sein Leben sinnlos verlängert wird, so darf dem Menschen sein Sterben auch dadurch nicht genommen werden, dass er durch aktive Euthanasie oder Suizidbeihilfe am eigenen Sterben als der letzten Lebensphase gewaltsam gehindert wird. Wenn menschliches Leben weder gewaltsam verlängert noch gewaltsam verkürzt werden darf, dann sind der medizinischen Gewaltsamkeit in beider Richtung Grenzen gesetzt. Als sehr problematisch müssen zudem die gesellschaftlichen Konsequenzen eingeschätzt werden, wenn aktive Euthanasie und assistierter Suizid staatlich und rechtlich zugelassen werden. Eine solche Gesetzgebung würde alten und leidenden, behinderten und chronisch kranken Menschen, die sich ohnehin oft als minderwertig vorkommen, noch mehr nahe legen, ihr als nicht mehr wertvoll empfundenes Leben selbst beenden zu sollen. Eine Legalisierung der Euthanasie würde den gesellschaftlichen, unterschwelligen oder expliziten Druck auf alte und schwerkranke Menschen und deren Angehörige erhöhen, mit dem Weiterleben die ohnehin angespannten Gesundheits- und Sozialsysteme nicht zusätzlich zu belasten. Wenn nämlich das Weiterleben eines alten und kranken Menschen nur noch eine von zwei legalen Optionen darstellen würde, müsste sich derjenige, der die Last seines Sterbeprozesses anderen zumutet, zur Rechenschaft verpflichtet fühlen, ob er dies darf. Dies würde die Angst von alten und kranken Menschen zusätzlich vergrössern, sie könnten ihres Rechts auf Leben verlustig gehen. Eine solche Einstellung würde sich auf die gesellschaftliche Anerkennung der alten und gebrechlichen Menschen als Glieder unsere Gesellschaft in ruinöser Weise auswirken.
9
Diese gefährlichen Konsequenzen bringen es an den Tag, dass sich das Mass der Humanität
einer Gesellschaft gerade an ihrer Einstellung zum Leiden und zu den leidenden Menschen
bemisst. Denn der Testfall für den Respekt vor der Würde des Menschen besteht darin, dass
die Würde jedes Menschen auch in seinen erbärmlichen Situationen anerkannt wird. Denn
„wer das beschädigte menschliche Leben nicht erträgt, der erträgt in Wahrheit die Würde
nicht, die der Mensch auch in den erbärmlichsten Lebensumständen unwiderruflich hat“ 21 Für
den christlichen Glauben kann es deshalb so genanntes „lebensunwertes Leben“ prinzipiell
nicht geben. Denn überall dort, wo Leben ist, ist und bleibt es bei allen Verschattungen Gabe
Gottes, die freilich die Mitmenschen verpflichtet.
5. Jenseitshoffnung und Diesseitsverantwortung
Menschenwürdig leben und in Würde sterben zu können ist das Geschenk der christlichen
Hoffnung auf ein ewiges Leben. Der christliche Glaube an ein ewiges Leben nach dem Tod
erweist sich sogar als radikaler Ernstfall für die Tragfähigkeit der menschlichen Hoffnung
überhaupt. Was wäre dies denn für eine Hoffnung, die allein für unser irdisches Leben tragen
würde und deren alleinige Kraft letztlich darin bestünde, uns dem todsicheren Ende unseres
Lebens im Grab näher zu bringen? Dann freilich wären wir, wie Paulus mit Recht sagt,
„erbärmlicher dran als alle anderen Menschen“ (1 Kor 15, 19). Christliche Hoffnung
hingegen, die diesen Namen wirklich verdient, hat den viel längeren Atem und bewährt sich
auch und erst recht über den Tod hinaus. Da es in der Sicht des christlichen Glaubens beim
ewigen Leben um die Vollendung des irdischen Lebens selbst durch die Zukunft Gottes geht,
weist die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod den Christen aber zugleich zurück auf das
gegenwärtige Leben. Das eigentliche Pathos der christlichen Hoffnung auf das ewige Leben
liegt in der Eröffnung eines befreiten und befreienden Lebens bereits vor dem Tod. Der
hoffnungsvolle Ausblick über die Todesgrenze hinaus auf die jenseitige Vollendung des
Lebens bei Gott motiviert die Christen, sich entschieden um das irdische Leben zu kümmern.
Denn die wirkliche Verantwortung für das Diesseits erwächst primär aus der echten
Jenseitshoffnung; und aus der Jenseitsverantwortung erwächst umgekehrt auch die echte
Diesseitshoffnung.
Dass es sich beim unlösbaren Zusammenhang zwischen Ewigkeitshoffnung und
Diesseitsverantwortung um keinen weltfremden Wunschtraum handelt, wird von jenen
kulturdiagnostischen Untersuchungen dokumentiert, die in den vergangenen Jahrzehnten
durchgeführt worden sind und das Ergebnis zu Tage gefördert haben, dass auf der einen Seite
der heutige Mensch einen hohen Anspruch auf Autonomie und freiheitliche
Selbstbestimmung für sich reklamiert, dass dieser Anspruch auf der anderen Seite aber
keineswegs einhergeht mit einem Zuwachs an zwischenmenschlicher Solidarität, sondern mit
einem katastrophalen Mangel an belastbarer Solidarität. 22 Nimmt man das weitere Ergebnis
hinzu, dass der festgestellte Desolidarisierungsschub am meisten durch die angestrengte
Diesseitskonzeption des modernen Lebens gefördert wird, dann drängt sich jene Konsequenz
auf, die der Wiener Pastoraltheologie Paul M. Zulehner zieht: „Solidarische Liebe wächst nur
aus der Erfahrung zuvorkommender Liebe. In ihrem bergenden Erfahrungsraum kann jene
(erbsündliche) Angst gezähmt werden, die uns nötigt, um uns selbst zu kreisen und
krampfhaft unser eigenes Leben mehren zu wollen. So gesehen mindert die Liebe die Angst
vor der Endlichkeit, den Tod, in dessen Umkreis die Solidarität nachweislich nur schwer
aufkommt und fortbesteht.“23 Wenn folglich in der christlichen Hoffnung auf ein ewiges
21
E. Jüngel, Meine Zeit steht in Deinen Händen (Psalm 31, 16). Zur Würde des befristeten Menschenlebens, in: Ders., Indikative der Gnade
– Imperative der Freiheit = Theologische Erörterungen IV (Tübingen 2000) 58-83, zit. 82.
22
Vgl. P. M. Zulehner – H. Denz – M. Beham – Ch. Friesl, Vom Untertan zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose anhand der
Untersuchungen „Religion im Leben der Österreicher 1970-1990“ – „Europäische Wertestudie – Österreichteil 1990“ (Wien 1991); P.M.
Zulehner – H. Denz, Wie Europa lebt und glaubt. Europäische Wertestudie (Düsseldorf 1993).
23
P. M. Zulehner, Religion und Autoritarismus. Inkulturation des Evangeliums in den Kontext der Freiheitlichkeit, in: Stimmen der Zeit 209
(1991) 597-608, zit. 604.10
Leben eine lebendige Quelle sprudelt, der verbindende und verbindliche Solidarität zu
entspringen vermag, dann entsteht Solidarität vor allem „im Unkreis der
Auferstehungshoffnung“ und dann impliziert die christliche Sendung, Solidaritätsquellen zu
erschliessen, „den Menschen im lebendigen Gott zu verwurzeln und aus dem Gefängnis purer
Diesseitigkeit frei zu machen“24.
Dazu lädt der christliche Glaube ein, zumal sein zentrales Symbol der Hoffnung auf ewiges
Leben, nämlich der Himmel, in sich eine elementare solidarische Dimension enthält, die Papst
Benedikt XVI. in einem seiner frühen Werke sehr schön erschlossen hat. In seiner
Beschreibung des theologischen Wesens des Himmels ereignet sich dieser nicht nur zwischen
dem einzelnen Menschen und Gott, sondern öffnet sich vielmehr in der Begegnung des
Einzelnen mit Gott auch für die anderen Menschen: „Der Himmel kennt keine Isolierung; er
ist die offene Gemeinschaft der Heiligen und so auch die Erfüllung alles menschlichen
Miteinanders, die nicht Konkurrenz zu, sondern Konsequenz aus dem reinen Geöffnetsein für
Gottes Angesicht ist.“ Dies gilt so sehr, dass das Heil des einzelnen Menschen eigentlich erst
ganz und voll sein wird, wenn das Heil des Alls und aller Erwählten vollzogen sein wird, „die
ja nicht einfach nebeneinander im Himmel, sondern miteinander als der eine Christus der
Himmel sind“25.
Im Licht dieser befreienden Kraft der Hoffnung auf das ewige Leben für das gegenwärtige
Leben gilt es nun danach zu fragen, worin der Beitrag des christlichen Glaubens für ein
würdiges Sterben des Menschen besteht. Im Gang der bisherigen Überlegungen dürfte vor
allem deutlich geworden sein, dass Sterbehilfe in christlicher Sicht nur Lebenshilfe sein kann,
die genauerhin darin besteht, den Menschen in der letzten Phase seines Lebens, nämlich in
seinem Sterben, menschlich zu begleiten.26 Menschenwürdige Sterbehilfe kann nur Hilfe beim
Sterben und darf nicht Hilfe zum Sterben sein, denn sie bedeutet, nicht durch die Hand,
sondern an der Hand anderer Menschen sterben zu dürfen. Eine ganzheitliche menschliche
und christliche Begleitung von Menschen im Sterben vollzieht sich genauerhin auf den drei
Ebenen der menschlichen Zuwendung, der seelsorgerlichen Begleitung und der medizinischen
Betreuung.
6. Sterbehilfe in christlicher Sicht
Sterbehilfe in christlicher Sicht bedeutet an erster Stelle menschliche Zuwendung zu
schwerkranken und sterbenden Menschen. Da der harte Kern des Leidens und des Sterbens in
der Einsamkeit besteht, richtet sich die Grundsehnsucht der betroffenen Menschen darauf,
nicht allein gelassen zu werden. Die Erfahrung zeigt freilich, dass das Pflegepersonal in
Kliniken und Spitälern normalerweise nicht genügend Zeit hat, sich in Ruhe diesen
menschlichen Diensten zu widmen. Sie können aber - und werden es auch – von
ehrenamtlichen Sterbegleiterinnen und Sterbebegleitern wahrgenommen werden. Solcher
Sterbebeistand ist zweifellos eines der wichtigen und schönen Werke der Barmherzigkeit, die
gläubige Menschen für ihre Mitmenschen vollbringen können.
Sterbebegleitung hat in christlicher Sicht immer auch eine seelsorgerliche Dimension. Denn
viele Menschen, die dem Sterben entgegen gehen, stellen mit besonderer Sensibilität die
Frage nach dem Sinn des Sterbens und damit auch des ganzen Lebens. Sie fragen nach dem
Sinn ihres Leidens und nach dem, was nach dem Tode kommen wird. Nicht selten werden sie
von Vorkommnissen aus ihrer Vergangenheit, die sie aufarbeiten möchten, gequält, und
24
Ebda.
25
J. Ratzinger, Eschatologie. Tod und ewiges Leben (Regensburg 1977) 191.
26
Vgl. Die Würde des sterbenden Menschen. Pastoralschreiben der Schweizer Bischöfe zur Frage der Sterbehilfe und der Sterbebegleitung
(Freiburg / Schweiz 2002); Die Herausforderung des Sterbens annehmen. Gemeinsames Hirtenwort der Bischöfe von Freiburg, Strasbourg
und Basel (2006).11 suchen Gesprächspartner, die sie ernst nehmen und ihnen ihr Ohr leihen. Von daher erhält die pastorale und spirituelle Dimension der Sterbebegleitung ihr besonderes Gewicht. Sie besteht vor allem darin, den christlichen Sinn des Sterbens zu besprechen und die Sterbenden auf die endgültige Begegnung mit Gott vorzubereiten. Dies kann freilich nicht nur in Dialog und Gespräch geschehen, sondern auch in Gebeten und Segnungen. Das besonders schöne Geschenk, das die Katholische Kirche sterbenden Menschen bereiten kann, besteht in den Sterbesakramenten wie der Krankensalbung, dem Sakrament der Versöhnung und der Wegzehrung als dem eigentlichen Sterbesakrament. Die Kirche zeigt damit in einer sakramental vermittelten Weise, dass sie in den Situationen des menschlichen Sterbens gegenwärtig sein und vor allem Gottes Gegenwart in den bedrängendsten Stunden im Leben eines Menschen bezeugen will, wie Jesus selbst sie mitten in der Erfahrung der Verborgenheit und Abwesenheit Gottes auf dem Ölberg und auf Golgotha erfahren hat. Menschliche Zuwendung und seelsorgerliche Betreuung können freilich den Beitrag der Medizin nie ersetzen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in den medizinischen Wissenschaften ein neuer Zweig herausgebildet, der Palliativmedizin („palliative care“) heisst gemäss dem englischen Wort „to palliate“, was bedeutet „einen Mantel umlegen“. Wie diese Bezeichnung anzeigt, verfolgt die Palliativmedizin das Ziel, in jenen Situationen, in denen eine zum Tode führende Krankheit nicht mehr geheilt werden kann und der Sterbeprozess irreversibel eingetreten ist, wenigstens die quälenden Auswirkungen der Krankheit und des Sterbens auf den Patienten einzudämmen. An erster Stelle handelt es sich dabei um die so genannte Schmerztherapie, bei der so weit wie möglich das Bewusstsein des Patienten erhalten bleiben soll und die mit der Überzeugung angewendet wird, dass der Mensch mit verminderten Schmerzen und deshalb gefasster seinem Sterben entgegen gehen kann. Die palliative Betreuung von sterbenden Menschen besteht freilich nicht nur aus medizinischen Massnahmen. Zu ihr gehören vielmehr auch die aufmerksame Körperpflege und die psychosoziale wie spirituelle Begleitung. Als besonders vorteilhaft erweist sich dabei der Einbezug der Angehörigen des Sterbenden in die palliative Betreuung. Um den glücklicherweise wieder im Wachsen begriffenen Wunsch, zu Hause sterben zu dürfen, zu ermöglichen, wären mobile Palliativpflege-Teams einzurichten, die die Angehörigen eines sterbenden Menschen bei der Betreuung zu Hause unterstützen. Dort jedoch, wo ein Sterben in der Familie nicht möglich ist, ist an Sterbehospize und andere spezialisierte Kliniken zu denken, in denen schwerkranke und sterbende Menschen in einer familiären Atmosphäre gepflegt werden. Solche Palliativmedizin würde gewiss die Anzahl jener Menschen reduzieren, die nach aktiver Euthanasie oder assistiertem Suizid verlangen. Denn die Erfahrung zeigt, dass der Tötungswunsch von schwerkranken und sterbenden Menschen nur in seltenen Fällen einem freien Willensentscheid entspringt, sondern vom Druck der Schmerzen, vom Gefühl der Sinn- und Aussichtslosigkeit und von der Rücksichtnahme auf die Belastung der Angehörigen erzwungen ist. Wissenschaftliche Untersuchungen haben zeigen können, dass bei Patienten der Tötungswunsch in den Hintergrund tritt, sobald ihre Schmerzen gelindert sind, ihre Angst vor der Ungewissheit im Sterben und nach dem Tod besprochen werden kann und ihnen die Mitbestimmung bei der Behandlung zugestanden wird. Eine solche umfassende Hilfe kann die palliative Betreuung leisten, weshalb sie die humanste und glaubwürdigste Reaktion auf die heutige Euthanasiebewegung darstellt. Papst Benedikt XVI. hat deshalb mit Recht betont, dass die richtige Antwort auf das Leiden und Sterben des Menschen am Ende seines Lebens „Zuwendung, Sterbebegleitung – besonders auch mit Hilfe der Pallativmedizin – und nicht “ ist27. 27 Benedikt XVI., Ansprache bei der Begegnung mit den Autoritäten und dem Diplomatischen Korps in der Wiener Hofburg am 7. September 2007.
12
Ich betone die Notwendigkeit der Palliativmedizin auch deshalb, weil der Zugang zur
palliativen Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen in der Schweiz leider
noch äusserst lückenhaft ist und wegen der hohen Kosten und der mangelnden
Kostendeckung auch Sterbehoszipe in der Schweiz noch relativ selten sind. In der Schweiz
drängt sich deshalb bei der Bewältigung der ganzen Euthanasieproblematik der Ausbau von
palliativmedizinischen Zentren und ausserklinischen Pflegehospizen als eine politisch
besondere Priorität auf. Solche Massnahmen stellen den richtigen Weg dar, auf dem eine
moderne humane Gesellschaft mit den sterbenden Menschen in ihrer Mitte umgehen sollte.
Denn die Würde von unheilbar kranken und sterbenden Menschen wird erst dort wirklich
respektiert, wo für sie eine angemessene menschliche und auch räumliche Umgebung
geschaffen wird, die ihnen ein würdevolles Abschiednehmen vom Leben und das Vollbringen
des eigenen Sterbens ermöglicht.
7. Selbstbestimmung über Leben und Sterben ?
Solches Sterben hat übrigens der Dichter Rainer Maria Rilke mit seinem Gebet um den
eigenen Tod gemeint. Ihm ging es nicht um den „eigenen Tod“ durch das gewaltsame
Beenden des Lebens, sondern um das Sterben im Sinne des Ausreifens des Lebens, wie seine
eigenen Worte zeigen: „Denn dieses macht das Sterben fremd und schwer, dass es nicht unser
Tod ist; einer der uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen.“ Für Rilke liegt die wahre
Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen darin, das Erleben des eigenen Sterbens nicht
durch ein vorzeitiges Beenden zu verhindern, sondern das Sterben als Ausreifen des Lebens
zu vollbringen.
Von daher drängt es sich auf, in christlicher Sicht über das angebliche Recht auf
Selbstbestimmung über Leben und Sterben nachzudenken, das in der öffentlichen
Auseinandersetzung immer wieder als Argument für die staatliche Legalisierung von aktiver
Euthanasie und assistiertem Suizid ins Feld geführt wird. Die Berufung auf ein Recht auf
Selbstbestimmung ist zunächst gewiss als Reaktion auf die Erfahrung einer vielfältigen
Abhängigkeit zu verstehen, die als Gegensatz zur Autonomie empfunden wird und die der
Philosoph Friedrich Nietzsche in besonders zugespitzter Weise mit den Worten bekämpft hat:
„Das feige Existieren in Abhängigkeit von einem anderen muss geächtet werden.“ In der
Folge ist die Selbstbestimmung des Menschen über sein eigenes Leben und Sterben so sehr
zum höchsten Wert avanciert, dass die Menschen auch Art und Weise und den Zeitpunkt ihres
Sterbens selbst bestimmen möchten.
Auf den ersten Blick kann man diese Einstellung durchaus verstehen. Angesichts der enormen
Möglichkeiten der modernen Medizin möchte der Mensch lieber gleichsam sich selbst
„ausgeliefert“ sein als der medizinischen Technik. Es stellt sich aber bereits von der
Erfahrung her die besorgte Frage, ob schwerkranke und sterbende Menschen wirklich so frei
sind, wie die Forderung nach Selbstbestimmung voraussetzt. Zudem kann nicht verdrängt
werden, dass unser Leben nie nur selbstbestimmt, sondern immer auch fremdbestimmt ist.
Wir haben nicht nur unser Leben, sondern auch viele unserer Lebensinhalte von anderen
Menschen erhalten und kommen erst auf diesem Weg der Anerkennung dessen, was uns
gegeben ist, zur eigenen Selbstbestimmung. Dies zeigt sich auch und gerade beim Sterben.
Die Würde des kranken, alternden und sterbenden Menschen liegt deshalb darin, dass er sich
selbst in seiner Hinfälligkeit annehmen und auch seine fremdbestimmten Grenzen bejahen
kann. Menschliche und christliche Sterbehilfe besteht deshalb darin, dem Sterbenden den
Übergang in die letzte und endgültige Fremdbestimmung des Sterbens zu erleichtern und zu
helfen, dass Sterbende in Freiheit ihren eigenen Tod ausreifen können. In diesem Sinne des13
Vollbringens des eigenen Sterbens und gerade nicht seines Verdrängens oder gar seines
gewaltsamen Beendens macht sich der christliche Glaube für die Freiheit des Sterbens stark.
Für den christlichen Glauben ist es aber nicht möglich, die Selbstbestimmung als isolierten
Höchstwert zu betrachten; er fordert vielmehr dazu heraus, auch die Grenzen der
Selbstbestimmung wahrzunehmen. Die elementarste Grenze besteht dabei in der
Selbstbestimmung anderer Menschen. Der Mensch ist nie ein isoliertes Individuum, sondern
immer Mit-Mensch. Die Freiheit des einen ist deshalb immer durch die Freiheit des anderen
begrenzt. Die Fremdbestimmung ist folglich für die Würde des Menschen nicht weniger
grundlegend als die Selbstbestimmung. Das ganze Leben ist im Grunde ein Ringen darum,
wie der Mensch im Rahmen einer grundlegenden Fremdbestimmung über sich selbst in
Freiheit verfügen kann. Das Zusammenspiel von Fremdbestimmung und Selbstbestimmung
zeigt sich dabei bereits darin, dass sich kein Mensch selbst das Leben geben kann. Das
Einzige, was der Mensch sich selbst geben kann, ist der Tod; dies aber setzt gerade voraus,
dass ihm das Leben gegeben ist, dass er Frucht der Liebe seiner Eltern und darin Gottes
Geschöpf ist. Dass der Mensch nur eine begrenzte Freiheit hat, wird somit im christlichen
Glauben vertieft. Erst dank seiner Geschöpflichkeit, in der er sein Leben Gott verdankt, hat
der Mensch auch seine Fähigkeit zur Freiheit und Selbstbestimmung. Die menschliche
Freiheit lebt deshalb immer in Relation zu ihrem Schöpfer, auf ihn bezogen und von ihm
herkünftig und ist somit verdankte Freiheit.
In dieser verdankten Freiheit liegt letztlich auch die Zerbrechlichkeit jener Synthese
begründet, die der Mensch selbst ist. Denn von Gott ist der Mensch dazu berufen, die wahre
Verwirklichung seines Wesens in der Gross-Mut (magnanimitas) zu suchen und zu finden,
genauerhin in jenem Mut zum Grossen, der sich durch Klugheit und Gerechtigkeit im Kleinen
des Alltags je neu zu bewähren hat. Der Mensch ist aber immer wieder der doppelten
Versuchung ausgesetzt, entweder durch Klein-Mut (acedia) seine unendliche Bestimmung
träge zu dementieren oder durch Hoch-Mut (superbia) überheblich und stolz seine Endlichkeit
zu leugnen. Jenseits von Klein-Mut und Hoch-Mut die Gross-Mut, in der die menschliche
Synthese von Endlichkeit und Unendlichkeit aufscheint, zu bewähren, ist eine lebenslange
Herausforderung für den Menschen, die eine letzte Zuspitzung im Sterben findet. Sie schenkt
dem Menschen vor allem die Gewissheit, dass er nicht als vollkommener und vollendeter
Mensch in den Tod gehen muss, sondern als endliches und deshalb auch fragiles Fragment
leben und sterben darf, in der Zuversicht, dass Gott selbst ausheilen wird, was verwundet ist,
und dass Gott selbst vollenden wird, was nicht ganz und damit schalom ist. In dieser Einsicht
liegt die unverbrauchte Aktualität der katholischen Lehre vom Fegefeuer, die eine derart
tröstliche Botschaft enthält, dass man sie eigentlich erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe,
und die eine wichtige Botschaft besonders in die heutige Zeit und ihre Problematik im
Umgang mit Sterben und Tod ist.
8. Lebenslanges Einüben in Sterben und Tod
Hilfreiche Sterbehilfe leisten zu können setzt voraus, dass man sich selbst mit dem Tod
beschäftigt, sich in das eigene Sterben einübt und sich ein Leben lang auf den eigenen Tod
vorbereitet. Darin liegt der tiefe Sinn der christlichen Tradition der „ars moriendi“, der „Kunst
des Sterbens“.28
Es ist kein Zufall, dass sie vor allem im Schlafen ein Symbol und eine besondere
Vorerfahrung des eigenen Sterbens sieht. In früheren Zeiten ist es vor allem in der
klösterlichen Spiritualität üblich gewesen, dass den Mönchen empfohlen worden ist, vor dem
Einschlafen die Kapuze über den Kopf zu stülpen, die Hände über den Leib zu falten und das
28
Vgl. H. Wagner, Ars moriendi. Erwägungen zur Kunst des Sterbens (Freiburg i. Br. 1989).14
Kreuz zu umfassen, so als läge man bereits im Sarg. Diese auf den ersten Blick recht
äusserlichen Riten sollten einfach an den inneren Sinn erinnern, dass sich die Mönche beim
Einschlafen am Abend vorstellen sollten, dass ihr Einschlafen endgültig ist und dass sie aus
dem Schlaf niemals mehr erwachen werden.29 Auch wenn die konkrete Art und Weise dieser
„ars moriendi“ für uns einer vergangenen Zeit angehören dürfte, so ist in ihr dennoch die
bleibende Wahrheit aufbewahrt, dass das Einschlafen am Abend in einer symbolischen Weise
unser in einer heute noch ungewissen Zukunft einmal endgültiges Eingehen in den Tod
vorweg erfahren lässt. Je mehr wir deshalb das abendliche Zubettgehen bewusst erleben und
spirituell vollziehen, uns beispielsweise beim Einschlafen von unserer Welt verabschieden,
uns von der alltäglichen Umklammerung durch Arbeit und Leistung lösen und uns selbst
gelassen Gott übergeben, desto mehr kann für uns das Einschlafen zu einer Vorerfahrung des
eigenen Sterbens werden. Und je mehr wir Menschen es während unseres Lebens lernen,
unsere verkrampften Hände zu lösen und uns selbst loszulassen im glaubenden Vertrauen auf
den für uns hellwachen Gott, desto leichter werden sich unsere Hände am Ende auch von
unserem Leben selbst lösen.
Wie das Einschlafen eine Vorerfahrung des Sterbens ist, so kann auch das Aufwachen am
Morgen eine Vorerfahrung des Auferwecktwerdens zu neuem Leben werden. Denn in der
Auferstehung begegnen wir jener Macht Gottes, die die Kraft in sich trägt, die Wahrheit
unseres alltäglichen Lebens, dass wir „mitten im Leben mit dem Tod umfangen sind“,
gleichsam auf den Kopf zu stellen mit der befreienden Zusage, dass wir mitten im Tod vom
Leben umfangen sind, vom ewigen Leben Gottes selbst. Diese Zusage ist in Jesus Christus
endgültig Wirklichkeit geworden. In ihm ist Gott selbst in den Machtbereich des Todes
eingetreten und hat damit den Raum der absoluten Einsamkeit und Kommunikationslosigkeit
in den Raum seiner erlösenden Gegenwart verwandelt. Seitdem Christus an den Ort des Todes
als der letzten Einsamkeit, in die das Wort der Liebe nicht mehr zu dringen vermag, gegangen
ist und an diesem Ort in seiner grenzenlosen Liebe alle toten Menschen umgriffen und mit
seiner wärmenden Liebe in die Totenstarre der Unterwelt Lebensbewegung gebracht hat, gibt
es Leben mitten im Tod und sind wir mitten im Tod vom Leben umfangen.
Eingedenk dieses christlichen Zentralgeheimnissses von Tod und Auferstehung Christi wird
uns neu bewusst, dass die tiefste Einübung in das eigene Sterben und die wichtigste
Bewährung unserer Hoffnung auf Auferstehung die Erinnerung an unsere eigene Taufe sind,
die den Beginn eines zweiten und neuen Lebens darstellt und bewirkt, das den Tod des vorauf
gehenden Lebens voraussetzt. Für den Heiligen Basilius von Caesarea beispielsweise ist die
Taufe „sowohl ein Bild des Todes als auch ein Bild des Lebens“ 30. Er bringt damit zum
Ausdruck, dass die Taufe die radikale Wende des alten zu einem neuen Leben markiert. In
diesem Sinn deutet bereits Paulus den liturgischen Ritus des Untertauchens des Täuflings in
das Wasser der Taufe als Untertauchen in das abgründige Wasser des Todes, und zwar in
solidarischer Gemeinschaft mit Jesus Christus, der selbst zuvor in dieses dunkle Wasser
getaucht worden ist. Und die Erfrischung durch das Bad der Taufe betrachtet Paulus als
Auferweckung zu einem neuen und unvergänglichen Leben, und zwar wiederum in
solidarischer Gemeinschaft mit Jesus Christus, der in der Kraft des Heiligen Geistes aus dem
Grab des Todes in das ewige Leben Gottes auferweckt worden ist. Getauft werden bedeutet
deshalb, als alter Mensch zusammen mit Christus zu sterben, um ebenso mit Christus durch
das Bad der Taufe als neuer Mensch auferweckt zu werden.
Uns Christen ist zugemutet, die eigentliche Scheidelinie in unserem Leben nicht erst in
unserem biologischen Tod, den wir noch vor uns haben, wahrzunehmen, sondern in der Taufe
29
Vgl. A. Rotzetter, Beseeltes Leben. Briefe zur Spiritualität (Freiburg i. Br. 1986), bes. 147-152.
30
Basilius von Caesarea, De Spiritu Sancto, 35.Sie können auch lesen