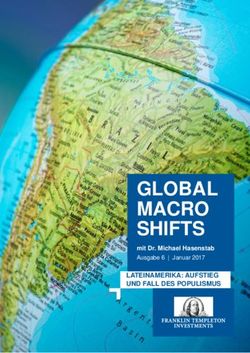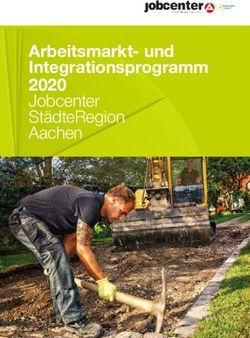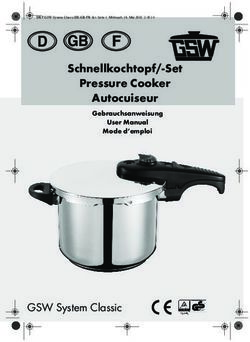Integral Change Lens - Hilmar Linse
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
White Paper
Integral Change Lens
Entwicklung eines systemisch-integralen Modells
für den organisationalen Change
Development of a systemic-integral model
for organizational change
Oktober 2020
www.integral-change-lens.org
--
Hilmar Linse
Hamburg, Germany
hilmar.linse@integral-change-lens.orgIntegral Change Lens
Abstract
Es wird ein ganzheitliches Set an systemischen und integralen Perspektiven auf den or-
ganisationalen Change entwickelt und begründet. Mit einem modernen Verständnis von
Organisationen, fasst die „Integral Change Lens“ dieses Set in einem anschaulichen Mo-
dell zusammen.
A holistic set of systemic and integral perspectives on organizational change is developed
and established. With a modern understanding of organizations, the “Integral Change
Lens” summarizes this set in a descriptive model.
Keywords: • Organizational Developement • Organisationsentwicklung
• Change Management • Change Management
• Transformation • Transformation
• Transition • Transition
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 2 von 68Integral Change Lens
Inhalt
1 Einleitung ........................................................................................................... 4
1.1 Über diese Arbeit......................................................................................................................... 4
1.2 Hintergrund und aktueller Forschungsstand ............................................................................... 5
1.2.1 Hintergrund, Begriffsbestimmung und Einordnung ............................................................... 5
1.2.2 Forschungsstand ..................................................................................................................... 8
2 Entwicklung eines Modells ............................................................................... 10
2.1 Entwicklung eines Strukturmodells ........................................................................................... 10
2.1.1 Die Organisation als soziales System .................................................................................... 11
2.1.2 Der Mehrebenen-Ansatz der Systemtheorie ........................................................................ 15
2.1.3 Einfluss der themenzentrierten Interaktion (TZI) ................................................................. 21
2.1.4 Entwicklung der Grundstruktur mit Stammfeldern .............................................................. 25
2.1.5 Beziehungen und Interaktionen der Stammfelder ............................................................... 28
2.1.6 Systemisches Strukturmodell ............................................................................................... 31
2.1.7 Integral Theorie .................................................................................................................... 32
2.1.8 Integrale Betrachtung des systemischen Strukturmodells ................................................... 38
2.1.9 Systemisch-integrales Strukturmodell .................................................................................. 41
2.2 Integral Change Lens................................................................................................................. 43
2.2.1 Einordnung in ein Welt- und Organisationsverständnis ....................................................... 44
2.2.2 Werte und agile Prinzipien als relevante Treiber der Zukunftsfähigkeit .............................. 47
2.2.3 Die Integral Change Lens ...................................................................................................... 50
2.2.4 Unterstützende Quellen ....................................................................................................... 55
3 Abschließende Betrachtung.............................................................................. 58
3.1 Anwendung ............................................................................................................................... 58
3.2 Fazit........................................................................................................................................... 60
3.3 Ausblick ..................................................................................................................................... 61
4 Anhang ............................................................................................................. 62
4.1 ICL Matrix – Bezogene Ansätze und Theorien für die Domänen der Integral Change Lens ...... 62
4.2 Glossar ...................................................................................................................................... 63
4.2.1 Lebende Systeme.................................................................................................................. 63
4.2.2 VUCA ..................................................................................................................................... 64
4.3 Literaturverzeichnis ................................................................................................................... 65
4.4 Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................... 68
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 3 von 68Integral Change Lens
1 Einleitung
Die aktuelle VUCA-Welt und insbesondere die Coronakrise stellen viele Organisationen
vor eine multidimensionale Herausforderung der sie sich stellen müssen und auf die viele
Organisationen und Führungskräfte nicht ausreichend vorbereitet sind.
Jede Organisation ist einzigartig und Executives, HR-Verantwortliche und Berater stellen
sich die Frage, wie die erfolgreiche Entwicklung in eine zukunftsfähige Organisation ge-
lingen kann.
Dafür benötigen sie valide Ansätze, die ihnen dabei helfen, der Komplexität zu begegnen
und Organisationen entsprechend zu verstehen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Zielbild einer zukunftsfähigen Organisation und
leistet einen Beitrag dazu, einen wirksamen und zeitgemäßen Ansatz zu finden.
1.1 Über diese Arbeit
In einer systematischen Vorgehensweise wird ein ganzheitliches Modell für den organi-
sationalen Change entwickelt.
In Kapitel 1 werden Grundbegriffe geklärt. In Kapitel 2.1 entsteht zunächst ein syste-
misch-integrales Strukturmodell auf einer wissenschaftlichen Basis. Das Kapitel 2.2 ent-
wirft mit der „Integral Change Lens“ ein auf dem Strukturmodell basierenden anwen-
dungsorientierten Ansatz. Mit diesem lassen sich Change-Vorhaben durchführen und Po-
tentiale zur Steigerung des organisationalen Change-Reifegrades aufzeigen. Kapitel 3 be-
fasst sich abschließend mit der Anwendung und gibt dabei einen ersten Einblick in die
Praxis, fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen kurzen Ausblick auf die möglichen
Entwicklungspfade des Modells.
Für Nutzer wird „Change“ in seiner ganzen Komplexität (be-)greifbarer und beherrsch-
barer. Relevanten Faktoren der organisationalen Zukunftsfähigkeit können in einem
ganzheitlichen Ansatz für die organisationale Entwicklung genutzt werden.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 4 von 68Integral Change Lens 1.2 Hintergrund und aktueller Forschungsstand Die Aufgabe, eine Organisation zukunftsfähig zu gestalten, hat mit der Organisation ei- nen komplexen Entwicklungsgegenstand in einem dynamischen Kontext und lässt sich nur sehr schwer greifbar und beherrschbar machen. Wo steht die Disziplin der Organisa- tionsentwicklung heute? 1.2.1 Hintergrund, Begriffsbestimmung und Einordnung Die nennenswerte Geschichte der „Organisationsentwicklung“ beginnt um 1930 mit ei- nem missglückten Experiment. In den Hawthorne-Werken der Western Electronic Co. wurden in einem arbeitswissenschaftlichen Ansatz in den Jahren 1924-1932 die Aus- leuchtung der Produktionsstätten untersucht, mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern. Das Ergebnis war zunächst nicht erklärbar: Die Arbeitsleistung stieg an, egal ob der Hel- ligkeitspegel erhöht oder verringert wurde. Interpretation: Durch die persönliche Zuwen- dung in der Untersuchung (Aufmerksamkeit, Interesse) würde die Leistung positiv beein- flusst. Als Konsequenz rückte der Mensch mit seinen Bedürfnissen und sozialen Bezie- hungen in den Mittelpunkt des Interesses. Daraus entstanden und entwickelten sich der Human-Relations und der Human-Resources-Ansatz, die als Ausgangsbasis für die Dis- ziplin der „Organisationsentwicklung“ dienen. In der ersten Phase der Organisationsentwicklung wurden die Außenbedingungen einer Organisation noch von Effizienzdruck beherrscht. Der Change wurde noch überwiegend technisch und zeitlich begrenzt verstanden. Das 3-Phasen-Schema (Unfreeze-Change- Freeze) und der Kraftfeld-Ansatz hemmender und treibender Kräfte (nach Kurt Lewin um 1950) bestimmte die Vorgehensweise im Change. Mit zunehmenden Innovationsdruck der Außenbedingungen und wachsender Komplexi- tät der Organisationen, wandelte sich auch die Disziplin der Organisationsentwicklung weiter. Der Begriff Change Management gewann als „neue Richtung“ an Bedeutung und öffnete sich weiteren Perspektiven und wissenschaftlichen Disziplinen, wie der Sys- temtheorie, der Soziologie und der Psychologie, um nur einige zu nennen. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 5 von 68
Integral Change Lens Mit der damit einhergehenden zunehmenden Komplexität der eigenen Disziplin und der weiteren Dynamisierung der Umwelt wurde der Wandel, beziehungsweise Change zu- nehmend als nicht beherrschbar und disruptiv wahrgenommen. Die Begriffe „Change“, „Change Management“ oder nun auch „Transformation“ wurden diffus verwendet und verbanden sich vielfach mit negativen Gefühlen. Das moderne Verständnis von Organisationsentwicklung ist eine fluide Entwicklung, hin zur Erlangung einer zukunftsfähigen, sprich: nachhaltig anpassungsfähigen Organisation. Die folgende Abbildung zeigt den Begriff der Organisationsentwicklung im Zeitenwan- del aus dem Verständnis des Autors (PreChange, Doing=“Ausprobieren“, Beco- ming=“Lernen“ und Being=“Leben“). Abbildung 1: Begriff der OE im Zeitenwandel Begriffsbestimmung Die Begriffe Organisationsentwicklung, Change Management und Transformation wer- den im Folgenden weitestgehend synonym verwandt. Der Wandel in diesem Sinne ist weniger ein zielgerichteter, geplanter und zeitlich begrenzter Veränderungsprozess, son- dern steht vielmehr für die Erlangung einer nachhaltigen Anpassungsfähigkeit der Orga- nisation. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 6 von 68
Integral Change Lens Einordnung Die Transformation in eine zukunftsfähige Organisation ist also kein Projekt, es ist bereits der begonnene Weg. In dieser adaptiven Welt der organisationalen Anpassungsfähigkeit angekommen, haben wir die Transformation oder Change Management als einmaligen und endenden Prozess hinter uns gelassen – aber nicht den dynamischen Wandel als ak- zeptierte Umweltbedingung. Die Organisation wird als ein komplexer Entwicklungsge- genstand in einem dynamischen Kontext begriffen. Die folgende Abbildung zeigt die Einordnung von Projektmanagement, Agilen Methoden und der Organisationsentwicklung im Sinne einer lebendigen und anpassungsfähigen Organisation. Abbildung 2: Einordnung moderner OE in Anlehnung an (Oestereich & Schröder, 2020) Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 7 von 68
Integral Change Lens
1.2.2 Forschungsstand
Die Forschung zur Organisationsentwicklung hat eine historisch gewachsene und etab-
lierte Basis an Grundlagenarbeiten und einen aus der heutigen Zeit betrachteten Erkennt-
nisstand.
Etablierte Grundlagenarbeiten
Zum Teil schon seit weit mehr als einem Jahrhundert beschäftigen sich verschiedene Dis-
ziplinen, Theorien und Ansätze mit Organisationen und deren Kontext:
• Betriebswirtschaftslehre und Organisationslehre (Schreyögg, 2003)
• Systemtheorie (Luhmann, 1984) mit vielen daraus entstandenen Ansätzen, wie
der personalen Systemtheorie (König & Volmer, 2005), (Ellebracht, Lenz, &
Osterhold, 2011) und des Mehrebenen-Ansatzes (Greif, Runde, & Seeberg, 2004)
• Soziologie und Psychologie (Watzlawick, 1990)
• Themenzentrierte Interaktion, TZI (Cohn, 1975)
• Integral Theorie (Wilber, 2005) und Spiral Dynamics (Beck & Cowan, 1996)
• Agilität (Beck, et al., 2001), SCRUM (Schwaber & Sutherland, 2017), etc.
Viele dieser anerkannten und etablierten Grundlagenarbeiten werden in der ersten Hälfte
des Hauptteils dieser Arbeit näher erläutert und zu einem anschaulichen Strukturmodell
für den organisationalen Change zusammengefasst.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 8 von 68Integral Change Lens Erkenntnisse aktueller Forschung Neben den oben genannten Grundlagenarbeiten beschäftigen sich aktuell viele Autoren mit dem organisationalen Change. Dabei betrachten sie heutige Organisationen mit qua- litativen und quantitativen Ansätzen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse beschreiben in der Regel Faktoren, die die organisationale Change-Kompetenz unterstützen und eine Korrelation zu wirtschaftlichem Erfolg aufzeigen. Einige Arbeiten werden im Anschluss an die Beschreibung der „Integral Change Lens“ kurz vorgestellt, wie zum Beispiel: • Reinventing Organizations (Laloux, 2015) • Agile Organisationsentwicklung (Oestereich & Schröder, 2020) • Oganizational Culture (Denison, Janovics, Young, & Jae Cho, 2006) • Accelerate (Kotter, 2015) und Excellence in Change (Krüger & Bach, 2014) • Dexterity - Cap Gemini Invent (Wähler, Bohn, Käppler, & Crummenerl, 2019) Brücke zwischen Grundlagenarbeiten und aktuellen Erkenntnissen Das in dieser Arbeit entwickelte Strukturmodell ist in seiner Synthese und Darstellungs- form neu und soll eine Brücke bauen zwischen den etablierten Grundlagenarbeiten und den aus jüngeren Arbeiten gewonnenen Erkenntnissen zum organisationalen Change. So erklären Claudia Schröder und Bernd Oestereich in der Zeitschrift OrganisationsEnt- wicklung (2019/02): „Viele der historisch einflussreichen Modelle wie Soziokratie und Scrum sowie ihre Weiterentwicklungen Holakratie, LeSS, SAFe etc. sind weiterhin deut- lich durch die technische Systemtheorie (Kybernetik) geprägt. Die Übertragung von Pro- duktentwicklungsmodellen auf die Organisationsentwicklung erfordert unserer Meinung nach die umfängliche Integration der sozialen Systemtheorie, der systemischen Organi- sationsentwicklung sowie ein grundlegendes integrales Verständnis“ (Schröder & Oestereich, 2019, S. 48). Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 9 von 68
Integral Change Lens
2 Entwicklung eines Modells
In diesem Kapitel wird ein Modell entwickelt, dass einen ganzheitlichen Satz an syste-
misch-integralen Perspektiven auf die Organisation oder ein konkretes organisationales
Anliegen zur Verfügung stellt. Das Modell wird in zwei Schritten entwickelt.
1. Ein strukturgebendes Modell wird auf der Basis wissenschaftlicher Arbeiten be-
gründet.
2. Die im Strukturmodell entwickelten Domänen und Faktoren werden anwendungs-
orientiert beschrieben.
2.1 Entwicklung eines Strukturmodells
Dieser Hauptteil der Arbeit begründet die Struktur des Modells auf der Basis wissen-
schaftlicher Arbeiten. Ziel ist es, einen ganzheitlichen Satz an Perspektiven auf die Orga-
nisation zur Verfügung zu stellen und deren Merkmale zu beschreiben.
Das Strukturmodell wird konsequent systemisch und integral aufgebaut. Jede Grundla-
genarbeit wird dabei kurz vorgestellt, beschrieben und der Einfluss auf das Modell erläu-
tert. Folgende Grundlagenarbeiten werden in die Begründung des Strukturmodells ein-
fließen:
Systemtheorie, Personale Systemtheorie, Mehrebenen-Ansatz in der Systemtheorie,
Themenzentrierte Interaktion und weitere Organisationstheorien sowie die Integral
Theorie.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 10 von 68Integral Change Lens 2.1.1 Die Organisation als soziales System Hier wird das zugrundeliegende Verständnis der Organisation als soziales System be- schrieben, welches für die weitere Modellentwicklung notwendig ist: Von der Systemthe- orie Luhmanns zum erweiterten Verständnis sozialer Systeme. Definition nach Luhmann „Ein soziales System kommt zustande, wann immer ein autopoietischer Kommunikati- onszusammenhang entsteht und sich durch Einschränkung der geeigneten Kommunika- tion gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Men- schen, auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen“ (Luhmann, 1986, S. 269). Komplexität sozialer Systeme. Von den vier Systemvarianten (technische, biologische (lebende), psychische und soziale Systeme) stellt die technische Maschine ein triviales System dar, bei dem eine eindeutige Input-Output-Relation besteht: Ihr „Verhalten lässt sich durch Regeln beschreiben und daher vorherbestimmen“ (Simon, 2006). Die drei an- deren Systeme (lebende, psychische und soziale Systeme), also auch Menschen und Or- ganisationen, sind nicht triviale Systeme. „Auf welche Art und Weise und mit welchem Ergebnis ein Input bei diesen Systemen zum Ergebnis kommt, ist nicht vorhersehbar und unterliegt vielfältigen inneren Verarbeitungsmustern, die je nach Situation eine andere Bedeutung im qualitativen wie quantitativen Sinn haben können (Simon, 2006, S. 35f)“ (Graeßner & Strikker, 2013). Soziale Systeme sind selbstreferenziell. Betrachten wir zunächst einmal das biologische System: Organismen reproduzieren sich selbst durch Zellteilung. Auf dieser Erkenntnis basierend entwickelten die Biologen Maturana und Varela das Modell der Autopoiese (altgriechisch αὐτός autos „selbst“ und ποιεῖν poiein „schaffen, bauen“), zur Beschrei- bung der „Fähigkeit eines Systems, sich durch Wiederholung der immer gleichen Opera- tion selbst zu reproduzieren“ (Banke, 2013, S. 48) und seine Elemente zu organisieren. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 11 von 68
Integral Change Lens
„Die Zellteilung ist die Operation, die immer wiederholt werden muss, um den Organis-
mus am Leben zu erhalten. Endet die Zellteilung, hört der Organismus auf zu existieren,
er stirbt“ (Banke, 2013, S. 49).
Der Selbsterhaltungstrieb beschreibt das charakteristischste Merkmal lebender Sys-
teme: „Das Sein und das Tun einer autopoietischen Einheit sind untrennbar, und dies bil-
det ihre spezifische Art von Organisation“ (Maturana & Varela, 1987). Luhmann über-
nimmt das Konzept der Autopoiese lebender (biologischer) Systeme für soziale und psy-
chische Systeme (Luhmann, 1984).
Ein wesentlicher Aspekt autopoietischer sozialer Systeme ist ihre Abgeschlossenheit,
man bezeichnet sie auch als operativ geschlossen. Sie sind selbstreferenziell, d.h. sie
nehmen nur Bezug auf sich selbst: Von außen kommende Impulse (Umwelt) werden zu-
nächst nach internen Erfahrungen interpretiert und gegebenenfalls aufbauend auf den bis-
herigen Erfahrungen verarbeitet (Graeßner & Strikker, 2013, S. 14).
Soziale Systeme bestehen aus Interaktionen und Kommunikation. Simon (2006, S.
91) bringt es auf den Punkt: „Was nicht in die Kommunikation kommt, existiert sozial
nicht.“ Die Elemente als kleinste Einheit sozialer Systeme sind nicht die Menschen, son-
dern deren Handlungen: Interaktionen oder Kommunikationen.
„Soziale Systeme bestehen aus Kommunikationen (als Elementen) und deren Rela-
tionen zueinander. Das heißt, die Elemente sozialer Systeme sind in dieser Model-
lierung nicht irgendwelche materielle Einheiten, sondern Ereignisse, vergleichbar
den Spielzügen eines Spiels, den Bruchstücken einer Konversation: ein gesproche-
ner Satz und ein Kopfnicken als Ausdruck des Verstehens“ (Simon, 2006, S. 88).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 12 von 68Integral Change Lens
Personale Systemtheorie
Luhmanns Definition sozialer Systeme ist in der wissenschaftlichen Diskussion nicht un-
widersprochen, insbesondere die Abstraktion des Menschen als Nicht-Dazugehörig ist
davon betroffen. König und Volmer (2005, S. 21) betonen, dass die „handelnden Perso-
nen ausdrücklich als Element des jeweiligen Systems“ betrachtet werden müssen:
„Veränderung sozialer Systeme kann immer nur bedeuten, dass sich Menschen Ge-
danken über ihre Situation machen, auf der Basis dieser Deutungen handeln und
damit das System verändern“ (König & Volmer, 2005, S. 32).
Es gibt demnach sechs Merkmale der personalen Systemtheorie (König & Volmer,
2005, S. 24ff):
1. Das Verhalten eines Systems ist bestimmt durch die jeweiligen Personen.
2. Das Verhalten eines Systems ist bestimmt durch die subjektiven Deutungen der
jeweiligen Personen.
3. Das Verhalten eines sozialen Systems ist von sozialen Regeln bestimmt.
4. Das Verhalten eines sozialen Systems ist von Regelkreisen (zirkulären Interakti-
onsstrukturen) bestimmt.
5. Das Verhalten eines sozialen Systems ist von der materiellen und sozialen Um-
welt beeinflusst.
6. Das Verhalten eines sozialen Systems ist von seiner bisherigen Entwicklung, sei-
ner Geschichte, beeinflusst.
Die Verbindung von Person und System wird auch von anderen Autoren betont: „Die
Elemente in sozialen Beziehungen sind Personen und Handlungen“ (Ellebracht, Lenz, &
Osterhold, 2011, S. 17).
„Damit bietet die personale Systemtheorie eine Verknüpfung zwischen Handlungstheorie
und Systemtheorie in der Tradition von Luhmann. Die verschiedenen Faktoren stehen
nicht mehr isoliert nebeneinander, sondern in interdependenten Beziehungen“ (Graeßner
& Strikker, 2013).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 13 von 68Integral Change Lens
Erweiterter Begriff sozialer Systeme als Grundlage dieser Arbeit
Erweitert man den Systembegriff, angelehnt an Ellebracht, Lenz & Osterhold (2011, S.
28f):
• Nichttriviale, lebende Systeme sind komplex, nicht durchschaubar, weder bere-
chenbar noch direkt von außen beeinflussbar (es sei denn durch gewaltsame Zer-
störung). Sie sind selbstreferenziell, streben nach Stabilität und entfalten eine
hohe Eigendynamik.
• Die Systemelemente selbst bilden eine Grenze, die sie von der Umwelt unterschei-
det. Sie entscheiden über die Zugehörigkeit. Über die Grenze hinweg findet ein
Austausch statt, der aber nach eigenem Verständnis interpretiert wird.
• Die Systemelemente, stehen zueinander in einer interdependenten Beziehung. Die
Elemente führen Transaktionen, bzw. Kommunikationen aus. Die Verbindung ist
die Verständigung über den Kontext und „Sinn“ (Willke, 2006, S. 250).
Abbildung 3: System (Schulte-Zurhausen)
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 14 von 68Integral Change Lens
2.1.2 Der Mehrebenen-Ansatz der Systemtheorie
Im Folgenden wird der erste Satz an Perspektiven auf die Organisation geliefert. Die Ent-
stehungsgeschichte dieser Perspektiven entstammt ebenfalls der Systemtheorie.
Interaktion, Organisation und Gesellschaft (Luhmann, 1975)
Vertieft man die Ausführungen zu sozialen Systemen, kommt man zu den Systemebenen
Interaktion, Organisation und Gesellschaft von Niklas Luhmann (1975). Mit seiner Klas-
sifikation in Systemebenen legt er damit den Grundstein für die Mehrebenen-Theorie.
Abbildung 4: Luhmanns Klassifikation von Systemen (nach Luhmann 1985: 16)
„In der Systemtheorie Niklas Luhmanns hat kaum ein Schema eine solche Prominenz
erreicht wie die Unterscheidung der drei Systemebenen Interaktionen, Organisationen
und Gesellschaft“ (Kühl, 2012a, S. 2).
Interaktionen oder Interaktionssysteme. Das kleinste und flüchtigste soziale System
besteht aus der einfachen Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen, sie kommen
schon durch die gegenseitige Wahrnehmung zustande: „Man kann nicht nicht kommuni-
zieren“ (Watzlawick, 1990).
Organisationen oder Organisationssysteme. Organisationen sind Bestandteil einer Ge-
sellschaft und werden auch von ihr geprägt.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 15 von 68Integral Change Lens
Organisationen haben aber auch eine bestimmte Aufgabe und verfolgen systematisch ei-
gene Ziele und haben dabei ihre eigenen „Regeln“. Zur effektiven und effizienten Zieler-
reichung entwickeln sie ihre eigenen Strukturen und Regeln. Durch die Verfügung über
Eintritt und Austritt der Mitglieder stellen sie ein zweckgerichtetes und regelkonformes
Verhalten ihrer Mitglieder sicher.
Die Ausprägungen Zweck, Struktur (Hierarchie) und Mitgliedschaft unterscheiden Orga-
nisationen von sozialen Systemen anderer Systemebenen.
Gesellschaften oder Gesellschaftssysteme. Das soziale System „Gesellschaft“ umfasst
als Systemebene die Ebenen Organisation und Interaktion. Es ist damit das „komplexeste,
dauerhafteste und umfassendste soziale System“ (Berghaus, 2011, S. 62). Luhmann selbst
definiert: "Gesellschaft ist das umfassende Sozialsystem aller kommunikativ füreinander
erreichbaren Handlungen" (1975, S. 89).
Verschachtelung der Systemebenen nach Luhmann. Die Systemebenen (die sozialen
Systeme verschiedener Ebenen) sind miteinander verschachtelt. Die Ebene der Gesell-
schaften umfasst alle Ebenen (Organisationen und Interaktionen). Interaktionen finden in
der Gesellschaft und in Organisationen statt. Die oberen Ebenen prägen sicher die einge-
schlossene Ebene, determinieren sie aber nicht (Kühl, 2012b, S. 52).
Abbildung 5: Verschachtelung der Systemebenen nach Luhmann, eigene Darstellung
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 16 von 68Integral Change Lens
Mehrebenen-Theorie nach Kühl
Stefan Kühl (2012a) differenziert Luhmanns Systemebene „Organisation“ horizontal in
weitere soziale Systeme (Gruppen, Organisationen, Familien und Bewegungen) und
schafft damit eine Basis, sich ausgiebiger mit den Beziehungen der Systeme untereinan-
der befassen zu können.
Mehrebenen-Ansatz nach Greif, Runde & Seeberg
Eine wegweisende Modifizierung der Mehrebenen-Theorie nehmen Greif, Rund & See-
berg (Greif, Runde, & Seeberg, 2004) vor. Hier finden sich Verknüpfungen von Luh-
manns Systemebenen (s. oben) mit der personalen Systemtheorie (s. oben) wieder.
Demnach „lassen sich die Prozesse in Organisationen nicht vollständig durch individuel-
les Handeln oder das Verhalten von Gruppen erklären. Aber auch das Verhalten von Or-
ganisationen kann vollständig nicht ohne die Wechselwirkung zwischen Personen und
Gruppen erklärt werden und auch nicht das Handeln der Individuen in Organisationen
ohne Berücksichtigung der Gruppen und Organisationsstrukturen“ (Greif, Runde, &
Seeberg, 2004, S. 100).
Mehrebenensystemtheorie nach Cranach
Für ihren Mehrebenen-Ansatz legen Greif, Runde & Seeberg (2004) die Mehrebenensys-
temtheorie, die der Berner Sozialpsychologe Mario von Cranach (1996) formuliert hat,
zugrunde.
„Organisationen werden immer durch die Individuen und ihre Handlungen kon-
stituiert, die ihnen als Mitglieder angehören. Durch die Handlungen bilden sich
Strukturen und Prozesse heraus. Aber die Strukturen und Prozesse lassen sich
nicht vollständig durch Individuen und ihre Handlungen beschreiben und erklä-
ren“ (Greif, Runde, & Seeberg, 2004, S. 118).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 17 von 68Integral Change Lens
Cranach untersucht, inwieweit sich Handlungen auf verschiedenen Ebenen organisieren
und sich gegenseitig beeinflussen:
o Es gibt drei Ebenen: Individuum, Gruppe und Organisation
o Menschliche Handlungen sind mehrstufig organisiert („Eine Gruppe oder eine
Organisation ist mehr als die Summe aller Mitglieder und ihr individuelles Ver-
halten“)
o Die Beziehungen zwischen den Ebenen werden untersucht
Erweiterung nach Greif, Runde & Seeberg (2004)
Aufbauend auf den beschriebenen Ebenen Individuum, Gruppe und Organisation erwei-
tert Greif die beiden Ebenen „Welt und Weltwirtschaft“ und „nationale Gesellschaft und
Ebene“ um die Relevanz der Umwelt zu betonen (Greif, 2005, S. 2):
Abbildung 6: Ebenen der Mehrebenensystemtheorie, erweitert nach v. Cranach (Greif, 2005, S.
2)
Verschachtelung. Für die Betrachtung der systemischen Abläufe in Organisationen
reicht es zunächst aus, die Ebenen Organisation, Gruppe und Individuum zu beschreiben:
„Organisationen sind übergeordnete Systeme, die als System einen größeren Ein-
fluss auf Individuen haben als die wichtigste Einzelperson der Organisation. […]
Zwischen Organisation und Individuum bilden Gruppen eine eigenständige und
sehr einflussreiche Zwischenebene“ (Greif, Runde, & Seeberg, 2004, S. 118).
und für deren Beziehungen untereinander gilt:
„Individuelles Handeln kann das Handeln der höheren Ebenen beeinflussen, aber
die höheren Ebenen organisieren in der Regel die unteren Ebenen“ (Greif, 2005,
S. 2).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 18 von 68Integral Change Lens
Der Mehrebenen-Ansatz
Luhmann hat eine „Theorie der Gesellschaft“ mit den drei Systemebenen Interaktion,
Organisation und Gesellschaft geschaffen. Kühl differenziert die mittlere Ebene hori-
zontal weiter aus und ergänzt die sozialen Systeme Gruppe, Organisation, Familie und
Bewegungen. Greif, Runde & Seeberg entwickeln darauf aufbauend einen anwendungs-
orientierten Ansatz.
Abbildung 7: Übersicht Mehrebenen-Systemtheorie, eigene Darstellung
Der Mehrebenen-Ansatz moderner Prägung liefert Perspektiven im organisationalen
Kontext. Er beschreibt die Beziehungen und Wechselwirkungen der Ebenen
• Umwelt. Zusammengefasst, die globale (Weltwirtschaft, Pandemie, Klimaent-
wicklung, Kriege, etc.) und nationale (Gesellschaft, Volkswirtschaft, Politik,
Recht, etc.) Ebene.
• Organisation. Die Ebene der gesamten Organisationseinheit. In diesen Bereich
gehören alle Führungsebenen und alle Mitglieder, wichtige Arbeitsfelder und
Kernprozesse der Organisation. Die Organisation dominiert die Ebenen Gruppe
und Individuum.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 19 von 68Integral Change Lens
• Gruppe. Formale und informelle Gruppen als Subsysteme der Organisation (Ab-
teilungen, Projekt- und Arbeitsgruppen, etc.). Die Ebene Gruppe ist einflussreich,
jedoch nicht dominant gegenüber der Ebene Organisation.
• Individuum. Die einzelne Person, deren Arbeitsplatz und individuell zugeordne-
ten Aufgaben sowie Prozesse in der Organisation. Das Individuum hat umgekehrt
beschränkt Einfluss auf die Ebenen Gruppe und Organisation.
Alle Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Änderungen auf einer höheren Ebene, haben
einen stärkeren Einfluss auf die unteren Ebenen. Insbesondere die resultierenden mensch-
lichen Handlungen in der Organisation sind im Fokus dieses Ansatzes.
Abbildung 8: Beziehungen und Wechselwirkung der Mehrebenen-Systemtheorie, eigene Dar-
stellung in Anlehnung an Greif, 2005
Die Ebenen Organisation, Gruppe und Individuum werden als Perspektiven in das
Strukturmodell einfließen.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 20 von 68Integral Change Lens
2.1.3 Einfluss der themenzentrierten Interaktion (TZI)
Die TZI liefert mit dem Vier-Faktoren-Modell (Cohn, 1975) ein passendes, ganzheitli-
ches und ausbalanciertes Set an Perspektiven und bietet darüber hinaus eine Struktur an.
TZI – Eine Definition des Ruth Cohn Institute for TCI International
„Die TZI ist ein von Ruth C. Cohn aus der Psychoanalyse und der Humanistischen Psy-
chologie entwickeltes professionelles Handlungskonzept, das auf effektives Lernen und
Arbeiten abzielt. […] Die TZI verbindet anthropologische Grundannahmen mit einer
Theorie und einer Methodik des Führens und Leitens. […] Dabei werden Kooperation,
Persönlichkeitsentwicklung und verantwortliches Handeln bei der Bearbeitung sachlicher
Anliegen und Aufgaben miteinander verbunden“ (Frosch, Bürster, & Rosenkranz, 2015,
S. 3f).
Das Vier-Faktoren-Modell der TZI
Überall, wo Menschen miteinander arbeiten,
miteinander lernen, miteinander leben, sind
vier Faktoren wirksam:
1. ES. Die zu bearbeitende Sache, die Auf-
gabe oder der Lehrstoff.
2. ICH. Jede einzelne beteiligte Person mit
ihren Kompetenzen, Anliegen, Gefühlen
und mit ihrer Biografie. Abbildung 9: Das Vier-Faktoren-Modell (RCI)
3. WIR. Die Beziehungen und Interaktionen zwischen allen Beteiligten.
4. GLOBE. Die Rahmenbedingungen, der Kontext, die Einflussfaktoren der Um-
welt(en).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 21 von 68Integral Change Lens
Für eine optimale Zusammenarbeit, für lebendiges Lernen und für die stetige Weiterent-
wicklung der Einzelnen und einer lernenden Organisation sind alle vier Einflussgrößen
gleich wichtig. Aufgabe der Leitung ist es, immer wieder eine Balance zwischen den vier
Faktoren herzustellen. Das bedeutet, dass sie neben der Sacharbeit auch die Anliegen und
Kompetenzen der einzelnen Personen, den Gruppenprozess und die Umweltfaktoren be-
achtet und, wenn nötig, thematisiert.
Lern- und Arbeitsprozesse werden gestört und behindert
• wenn die Aufmerksamkeit zu lange nur dem Sachinhalt gilt, ohne dass die Anlie-
gen der einzelnen Individuen oder die Qualität der Kommunikation untereinander
beachtet werden
• wenn es kein geklärtes gemeinsames Anliegen und keine gemeinsamen Ziele gibt
• wenn sich die Gruppenmitglieder überwiegend mit ihren Beziehungsstörungen
und Konflikten beschäftigen und darüber die eigentliche Aufgabe vernachlässigen
• wenn Bedingungen und Einflüsse des Umfeldes nicht hinreichend berücksichtigt
werden
(Frosch, Bürster, & Rosenkranz, 2015, S. 8f).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 22 von 68Integral Change Lens TZI in der modernen Organisationsentwicklung Das Ruth Cohn Institute selbst beschreibt: „TZI ist vielseitig einsetzbar und alltagstaug- lich. [...] In der Organisationsentwicklung und Personalentwicklung als eine Methode zur Reflexion und Planung von Interventionen: Damit […] methodisch präpariert unter- schiedliche Perspektiven und Blickwinkel [eingenommen werden können]. TZI hilft den Wandel zu gestalten. […] So lassen sich Prozesse in Gruppen, Teams, Unternehmen und Organisationen besser analysieren, planen, steuern und gestalten“ (Frosch, Bürster, & Rosenkranz, 2015). Balance. Mit dem Verständnis der TZI werden die Perspektiven auf die Organisation ausgewogener: Der Mehrebenen-Ansatz spricht von einer hierarchischen Gliederung der Ebenen Organisation, Gruppe und Individuum (Greif, Runde, & Seeberg, 2004, S. 118). Die TZI unterstreicht ein ausgewogenes Verhältnis der Faktoren ES, ICH, WIR und GLOBE (Frosch, Bürster, & Rosenkranz, 2015). Das personale System „Organisation“. Organisationen bestehen aus Mitgliedern, die wiederum in Gruppen (Teams, Kreisen, etc.) organisiert sind: „Wir befinden uns sofort in einer Polarität zwischen unseren individuellen Bedürfnissen und denen der Gruppe in Bezug auf den Organisationszweck“ (Oestereich & Schröder, 2020, S. 188). Die Herausforderung ist es, die individuellen Bedürfnisse mit der Gruppenleistung und dem Organisationszweck in ein ausbalanciertes Verhältnis zu bringen. Dabei „nutzen Formate, wie beispielsweise TZI […], die eine ganzheitliche Betrachtungsweise und ins- besondere die Gruppenreifung fördern“ (Oestereich & Schröder, 2020, S. 38). Anschlussfähigkeit zur Umwelt. Die Zukunftsfähigkeit einer Organisation ist abhängig von ihrer Anschlussfähigkeit mit der Umwelt. Die Umwelt ist ein relevanter Faktor, der zu jeder Zeit und auf allen Ebenen wirkt. Damit steht sie zu jeder Ebene und Handlung in einer Art von Beziehung. Oestereich & Schröder bezeichnen dies auch als „Organisationsvorrang“ gegenüber den Eigeninteressen der Individuen. (2020, S. 189) und Reinhard Sprenger schreibt: „… do- miniert das Individualinteresse, wird die Gemeinschaftsaufgabe nicht erfüllt“ (2015, S. 62). Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 23 von 68
Integral Change Lens
Evolutionär. In der Beschreibung zukunftsweisender evolutionärer Organisationen er-
kennt Laloux (2015, S. 54f) in der Untersuchung seiner Fallstudien drei „wichtige Durch-
brüche“, die ebenfalls zu den beschriebenen Perspektiven passen:
• Selbstführung. Gruppen (WIR) arbeiten selbstorganisiert ohne Hierarchie zu-
sammen.
• Ganzheit: Menschen (ICH) und ihre Integrität gelangen zunehmend in den Fokus.
• Evolutionärer Sinn: Existenz und sinnvoller Beitrag (ES) als lebendige Quelle
für die Zukunftsfähigkeit.
Im Fokus: Der Mehrebenen-Ansatz und das Vier-Faktoren-Modell
Der Mehrebenen-Ansatz und das
Vier-Faktoren-Modell lassen sich in
Deckung bringen. Dabei werden
systemische mit humanistischen
und anthropologischen Grundan-
nahmen zusammengeführt.
Abbildung 10: Vier Perspektiven der TZI
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 24 von 68Integral Change Lens
2.1.4 Entwicklung der Grundstruktur mit Stammfeldern
Auf der Basis der vorhergehenden Erkenntnisse wird die Grundstruktur des Modells auf-
gebaut.
Zusammenführung von System, Mehrebenen-Ansatz und TZI
• Es wird eine Organisation als System behandelt und im weiteren Sinne auch dar-
gestellt.
• Drei Perspektiven des Mehrebenen-Ansatzes werden angeboten.
• Die Perspektiven werden in einem ausbalancierten Verhältnis dargestellt.
• Die resultierenden „Stammfelder“ können beschrieben werden.
Abbildung 11: Aufbau der Grundstruktur
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 25 von 68Integral Change Lens Die Stammfelder des Strukturmodells Der Mehrebenen-Ansatz der Systemtheorie, die TZI und andere Organisationstheorien werden im Kontext einer modernen Organisationsentwicklung betrachtet und ein gemein- samer Fokus beschrieben. Stammfeld: Organisation / ES Systemtheorie: Die zweckgerichtete Organisation als ein soziales System. TZI: Die zu bearbeitende Sache, Aufgabe und Inhalt der zu diesem Zweck gebildeten Gruppe. Andere: Evolutionärer Sinn. Aus sich selbst heraus lebendig sein und eine Richtung entwickeln. Statt die Zukunft vorherzusagen und zu kontrollieren, werden die Mitglie- der der Organisation eingeladen, zuzuhören und zu verstehen, was die Organisation werden will und welchem Sinn sie dienen möchte (Laloux, 2015, S. 54f). Fokus: Sinn, Zweck und Ziel auf der höchsten gemeinsamen Ebene einer lebendigen, verständigen und gestaltenden Organisation. Stammfeld: Individuum / ICH Systemtheorie: Jede einzelne Person als Mitglied des Systems „Organisation“ mit ei- ner gewissen strukturellen und prozessualen Einbindung. TZI: Jede beteiligte Person mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen, Kompetenzen und ihrer eigenen Biografie. Andere: Ganzheit. Evolutionäre Organisationen haben eine Reihe von Praktiken ent- wickelt, die dabei unterstützen, unsere innere Ganzheit wiederzuerlangen und unser vollständiges Selbst in die Arbeit einzubringen, nicht nur das vergleichsweise be- grenzte „berufliche“ Selbst (Laloux, 2015, S. 54f). Fokus: Einbindung, Entfaltung und Integrität jedes einzelnen Mitglieds. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 26 von 68
Integral Change Lens Stammfeld: Gruppe / WIR Systemtheorie: Das formale oder informelle Subsystem der Organisation. TZI: Die Beziehungen und Interaktionen der Personen einer Gruppe. Die Dynamik der Gruppenprozesse hat starken Einfluss auf die Leistung. Andere: Selbstführung. Evolutionäre Organisationen funktionieren vollständig ohne Hierarchie (und auch ohne Konsens). Sie haben den Schlüssel gefunden, um die Funk- tionsweisen von komplexen adaptiven Systemen, wie man sie in der Natur kennt, auf Organisationen zu übertragen (Laloux, 2015, S. 54f). Fokus: Weitgehende Autonomie und konstruktive Zusammenarbeit im gegebenen Kontext. Aussen: Umwelt, Globe Systemtheorie: Äußere globale und nationale Einflüsse und Rahmenbedingungen. TZI: Äußere Einflussfaktoren. Andere: Die Umwelt steht in einer Input-Output-Beziehung zur Organisation. Die äu- ßere Umwelt kann dadurch starken Einfluss auf die Organisation nehmen. Fokus: Die Organisation hat eine relevante Umwelt. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 27 von 68
Integral Change Lens
2.1.5 Beziehungen und Interaktionen der Stammfelder
Im Folgenden werden die Beziehungen und Interaktionen der gegebenen Stamm-Struktur
betrachtet. Es ergeben sich drei Beziehungsfelder auf der Basis folgender Annahmen:
• Aus dem erweiterten Begriff sozialer Systeme und dem Mehrebenen-Ansatz (s.
oben) ist abzuleiten, dass interdependente Beziehungen bestehen und Interaktio-
nen zwischen den Ebenen passieren.
• Die TZI unterstreicht die Zusammenhänge der drei Perspektiven in einem ausba-
lancierten Verhältnis (s. oben).
Abbildung 12: Grundstruktur mit Beziehungsfeldern (grün)
Drei Beziehungsfelder werden definiert:
• Organisation - Individuum / ES - ICH
• Individuum - Gruppe / ICH - WIR
• Organisation - Gruppe / ES - WIR
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 28 von 68Integral Change Lens Die Beziehungsfelder des Strukturmodells Die sich daraus ergebenden Beziehungsfelder lassen sich aus Sicht der Systemtheorie und des Mehrebenen-Ansatzes der Systemtheorie, der TZI sowie der Organisationstheorie und anderen im Kontext einer modernen Organisationsentwicklung beschreiben (Fokus). Beziehungsfeld: Organisation - Individuum / ES - ICH Systemtheorie. Betrachten wir die Organisation als ein soziales System, so wird die Beziehung zum Individuum durch die Mitgliedschaft und der Rolle definiert. TZI. Achtet man auf die Balance zwischen menschlichen Bedürfnissen (ICH) und or- ganisationalen Zweck (ES), tritt hier die Identifikation des Einzelnen mit dem Zweck der Organisation in den Fokus. Andere. Der institutionelle Begriff umfasst eine spezifische Zweckorientierung der Or- ganisation zu dessen Verfolgung eine geregelte Arbeitsteilung definiert und dazu ent- sprechende Strukturen und Regeln festgelegt werden. Die Ziehung beständiger Gren- zen zur Außenwelt führt zu identifizierbaren Mitgliedern, die bereit sind, sich der Ord- nung zu unterwerfen (Schreyögg, 2003, S. 9f). Fokus: Mitgliedschaft und Institutionalisierung des Systems. Beziehungsfeld: Individuum - Gruppe / ICH - WIR Systemtheorie: Organisationssysteme bestehen aus Mitgliedern, die wiederum in Gruppen (Subsystemen) organisiert sind. Dort stoßen individuelle Bedürfnisse auf die Anforderungen an die Gruppenleistung in Bezug auf die Aufgaben zur Erfüllung des Organisationszwecks. TZI: Die Herausforderung ist es, die individuellen Bedürfnisse mit der Gruppenleis- tung und dem Organisationszweck in ein ausbalanciertes Verhältnis zu bringen. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 29 von 68
Integral Change Lens Andere: Aufbau und Pflege sozialer Beziehungen und Interaktionen sind die Grund- lage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Das Human-Ressourcen-Modell und mo- dernere integrative Gesamtmodelle betonen die Steigerung der Motivation durch ko- operative und laterale Führungsmodelle mit mehr Selbstverantwortung (Schreyögg, 2003, S. 273ff). Fokus: Zugehörigkeit und Kultur des Miteinander im Kontext der zweckgerichteten Zusammenarbeit. Beziehungsfeld: Organisation - Gruppe / ES - WIR Systemtheorie: Zwischen den Ebenen Organisation und Gruppe bestehen Wechselwir- kungen. Die höhere Ebene organisiert aber in der Regel die niedrigere Ebene. TZI: Die Leitung steuert und gestaltet den Gruppenprozess sachorientiert, personen- orientiert und prozessorientiert. Passende Sozial- und Arbeitsformen unterstützen die Arbeit am Thema (Frosch, Bürster, & Rosenkranz, 2015, S. 12). Andere: Der funktionale Begriff als Aufgabe der Unternehmensführung, die Erfüllung des Organisationszwecks sicherzustellen. Im Sinne von Gutenberg (1983) soll der dis- positive Faktor (Management: Planung und Vollzug) die optimale Kombination der Elementarfunktionen (Arbeitsleistung, Betriebsmittel und Werkstoffe) sicherstellen (Schreyögg, 2003, S. 5f). Fokus: Organisationale Rahmenbedingungen für ein ausbalanciertes Zusammenspiel von Sach-, Personen- und Prozessorientierung. Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 30 von 68
Integral Change Lens
2.1.6 Systemisches Strukturmodell
An dieser Stelle entsteht ein ganzheitliches und differenziertes Grund-Set an systemi-
schen Perspektiven auf die Organisation. Es werden 3 übergeordnete Perspektiven mit
insgesamt 6 verknüpften Domänen entwickelt.
Abbildung 13: Systemisches Strukturmodell
Die wesentlichen bis hier eingeflossenen Grundlagenarbeiten:
• Systemtheorie (Maturana & Varela, 1987); (Luhmann, 1984); (Simon, 2006)
• Personale Systemtheorie (Ellebracht, Lenz, & Osterhold, 2011); (König & Volmer,
2005)
• Mehrebenen-Ansatz der Systemtheorie (Kühl, 2012b); (Cranach, 1996); (Greif,
Runde, & Seeberg, 2004); (Greif, 2005)
• Vier-Faktorenmodell der TZI (Cohn, 1975)
• Organisationstheorien (Schreyögg, 2003); (Laloux, Reinventing Organizations,
2015); (Oestereich & Schröder, 2020)
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 31 von 68Integral Change Lens
2.1.7 Integral Theorie
Die Integral Theorie liefert einen ergänzenden Bezugsrahmen zum systemischen Struk-
turmodell.
Hintergrund
„Das Wort integral bedeutet umfassend, einschließend, nicht marginalisierend, umar-
mend. Integrale Ansätze versuchen in jedem Feld genau das zu sein: die größtmögliche
Anzahl von Perspektiven, Stilen und Methodologien in eine kohärente Sicht des Gegen-
stands einzubeziehen“ zitiert Sean Esbjörn-Hargens aus einem Vorwort Ken Wilbers
(Esbjörn-Hargens & Weber, 2009, S. 1).
Seit 1977 hat der Philosoph Ken Wilber mit zahlreichen Veröffentlichungen die Grund-
lage für die integrale Theorie gelegt. Mit seinem Werk „Eros, Kosmos, Logos“, 1995
wurde der Begriff „integral“ zur Beschreibung seines Ansatzes und insbesondere eines
Quadranten-Modells (später auch AQAL genannt) eingeführt. Vergleiche dazu Esbjörn-
Hargens (2009) und Ken Wilber (A Theory of Everything: An Integral Vision for
Business, Politics, Science and Spirituality, 2001).
„An Integral Approach insures that you are utilizing the full range of resources
for any situation, with the greater likelihood of success. […] The Integral Map is
just a map, but it is the most complete and accurate map we have at this time“
(Wilber, 2005).
Die Integral Theorie liefert einen universellen Bezugsrahmen für nahezu alle Kontexte
und über nahezu alle Disziplinen, ebenfalls für die persönliche Entwicklung.
Der integrale Ansatz versucht möglichst viele Aspekte einzubeziehen und ganzheitlich
zu betrachten, um auch bei komplexen Problemen die Lösungskompetenz zu erhöhen.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 32 von 68Integral Change Lens
AQAL
AQAL steht für all quadrants, all levels, all lines, all states, and all types, folgend erklärt.
Alle Quadranten
Die Integrale Theorie baut auf der Erkenntnis auf, dass alles aus zwei grundlegenden Un-
terscheidungen betrachtet werden kann:
• Innen- und Außenperspektive
• Singular- und Pluralperspektive
Daraus lässt sich ein Kreuz mit vier Feldern herstellen. Diese sogenannten Quadranten
repräsentieren grundlegende Domänen der Realitäten: subjektiv (I), intersubjektiv (WE),
objektiv (IT) und interobjektiv (ITS, eine Wortschöpfung Wilbers).
Abbildung 14: Vier Quadranten
(Die häufig vorkommende Verortung der Felder mit Kürzeln für oben, unten und links,
rechts wird hier weggelassen.)
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 33 von 68Integral Change Lens
Big Three. Die beiden Domänen der Objektivität (IT und ITS) lassen sich zusammenfas-
sen. Die drei verbleibenden Domänen verkörpern somit die Perspektiven der ersten (I),
zweiten (WE) und dritten (IT/S) Person. Sie stehen auch für Ästhetik und Bewusstsein (I),
Moral und Kultur (WE) sowie Wissenschaft und Natur (IT/S). Wilber verknüpft diese
Bereiche mit der Geschichte westlicher Philosophie.
Abbildung 15: Big Three (Esbjörn-Hargens & Weber, 2009, S. 4)
Ein wesentlicher Grundsatz der Integralen Theorie ist die Anerkenntnis der Gleichran-
gigkeit und Gleichzeitigkeit der Domänen (aller Quadranten oder der Big Three).
• Kein Bereich lässt sich reduzieren oder allein durch die Brille eines anderen er-
klären. Dies betrifft insbesondere die Gefahr, die subjektiven Erfahrungen der ers-
ten und zweiten Person, durch objektive Aspekte zu reduzieren.
• Alle Quadranten oder Domänen der Big Three treten gleichzeitig auf. Sie gehören
zusammen und sind miteinander verwoben oder „tetra-mesh“, nach Wilbers Wort-
schöpfung (Esbjörn-Hargens, 2009, S. 7).
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 34 von 68Integral Change Lens
Dimensionen und Perspektiven. In der praktischen Anwendung der integralen Theorie
lassen sich mit dem Quadrantenmodell zwei Untersuchungen unterscheiden:
• Reflektion. Die Dimensionen der Realität eines Selbst (Quadranten)
• Fokus. Die Perspektiven auf ein bestimmtes Phänomen (Quadrivia)
Reflektion. Je mehr Kanäle
geöffnet sind, desto besser
kann die Umwelt als Ganzes
wahrgenommen und so ange-
messen agiert werden.
Abbildung 16: Vier Quadranten
eines Individuums (Esbjörn-
Hargens & Weber, 2009, S. 5)
Fokus. Multiple Perspektiven
auf ein im Fokus befindliches
Phänomen ermöglichen ein
Verständnis des Ganzen und
damit auch Erfolg ver-
sprechende Lösungsansätze.
Abbildung 17: Vier Quadrivia ei-
nes Sees (Esbjörn-Hargens &
Weber, 2009, S. 6)
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 35 von 68Integral Change Lens
Alle Ebenen
In Anlehnung an „Spiral Dynamics“ (Beck & Cowan, 1996), beschreiben die Ebenen
(Levels) eine allgemeine Entwicklungsgeschichte von „mir“ (egozentrisch) zu „die ganze
Realität“ (kosmozentrisch) (Esbjörn-Hargens & Weber, 2009, S. 8).
Abbildung 18: Sich erweiternde Identität (links) und die verschachtelte Eigenschaft sich gegen-
seitig transzendierender und einschließender Ebenen (rechts). (Esbjörn-
Hargens & Weber, 2009, S. 8)
Integral Theorie verwendet für die verschiedenen Entwicklungsebenen die Farben des
Regenbogens. Die Abbildung zeigt die Skala und einen Vergleich sowie die Einordnung
anderer Schulen (Spiral Dynamics=SD).
Abbildung 19: Levels of Consciousness (Quelle: integrallife.com, 20200520)
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 36 von 68Integral Change Lens Das Einbeziehen der Ebenen ermöglicht es in der praktischen Anwendung, den passenden Ansatzpunkt in den jeweiligen Domänen zu finden. Die Entwicklungsebenen korrelie- ren über alle Domänen. Die inneren Domänen der Subjektivität sind dabei die Ebenen der Tiefe, die äußeren Domänen der Objektivität die Ebenen der Komplexität. Abbildung 20: Ebenen der vier Quadranten (Esbjörn-Hargens & Weber, 2009, S. 7) Der Vollständigkeit halber, werden die Ebenen an dieser Stelle behandelt. Sie helfen, sich den jeweiligen Domänen des Strukturmodells besser anzunähern. Die Entwicklungsebe- nen werden später als Farbenspektrum in der „Integral Change Lens“ repräsentiert. Vergleiche für diesen Abschnitt (Esbjörn-Hargens & Weber, EINE ÜBERSICHT INTEGRALER THEORIE Ein allumfassendes Bezugssystem für das 21. Jahrhundert, 2009). Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 37 von 68
Integral Change Lens
2.1.8 Integrale Betrachtung des systemischen Strukturmodells
Das zuvor entwickelte systemische Strukturmodell und die Quadranten der integralen
Theorie werden integriert.
Integrale Betrachtung
Wenn die Quadranten um 90° nach links gedreht werden, kann eine passende Überde-
ckung der beiden Modelle festgestellt werden. Insbesondere die „Big Three“ sind so in
Übereinstimmung mit den Stammfeldern des systemischen Strukturmodells (Mehrebe-
nen-Ansatz und TZI).
Mit dieser Verknüpfung lassen sich die einzelnen Domänen des Strukturmodells konkre-
ter beschreiben.
Abbildung 21: Integration der Big Three und der Quadranten und das systemische Strukturmo-
dell
Beschreibung der Domänen eines systemisch-integralen Strukturmodells
Die beiden Ansätze des bis hier entwickelten systemischen Strukturmodells (SSM) und
der integralen Theorie (IT) werden im Kontext eines modernen Organisationsverständ-
nisses betrachtet und ein gemeinsamer Fokus beschrieben.
Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 38 von 68Integral Change Lens Vergleich: Organisation / IT/S SSM: Sinn, Zweck und Ziel auf der höchsten gemeinsamen Ebene einer lebendigen, verständigen und gestaltenden Organisation. IT: Äußerlich/Dritte Person. Wissenschaft, zunehmende Komplexität. IT: Objektiv, das eigene System beschreibend. ITS: Interobjektiv, die Einbindung in die soziale Umwelt beschreibend. Fokus: Gemeinsames Verständnis über den sinnstiftenden Beitrag (Purpose) für die soziale Umwelt und eine lebendige, verständige und gestaltende Organisation, die sich selbst und ihre soziale Einbindung beschreiben kann. Vergleich: Organisation – Individuum / IT SSM: Mitgliedschaft und Institutionalisierung des Systems. IT: Äußerlich-Individuell/Dritte Person. Das eigene System beschreibend. Objektiv, Wissenschaft, zunehmende Komplexität. Fokus: Systemkonfiguration und Klärung der Mitgliedschaft. Vergleich: Individuum / I SSM: Einbindung, Entfaltung und Integrität jedes einzelnen Mitglieds. IT: Innerlich-Individuell/Erste Person. Subjektiv, Selbst-Identität und Bewußtsein, Grad der Tiefe: Entfaltung und Erfahrung. Fokus: Integrität, Entfaltung und Entwicklung des Individuums im Kontext des Orga- nisationssystems. Vergleich: Individuum – Gruppe / I - WE Hilmar Linse 01.10.2020 Seite 39 von 68
Sie können auch lesen