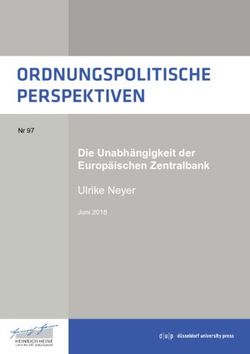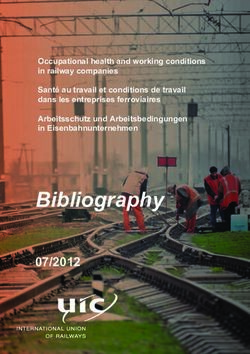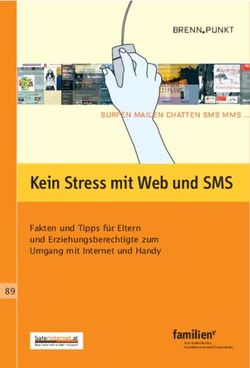Julia Merkle Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen - Bachelorarbeit an der HWR Berlin - ifrOSS
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen
Julia Merkle
Bachelorarbeit
an der HWR Berlin
im Studiengang Wirtschaftsrecht
Matrikelnummer: 324087
Erstbetreuer: Dr. Martini
Zweitbetreuer: Prof. Dr. SchunkeEidesstattliche Erklärung Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit selb- ständig und ohne fremde Hilfe verfasst und andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt habe. Die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen (direkte oder indirekte Zitate) habe ich unter Benennung des Autors/der Autorin und der Fundstelle als solche kenntlich gemacht. Sollte ich die Arbeit anderweitig zu Prüfungszwecken eingereicht haben, sei es vollständig oder in Teilen, habe ich die Prüfer/innen und den Prüfungsausschuss hierüber informiert. Berlin, den 30. Juli 2014 Julia Merkle
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Open Source Software und Lizenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 Open Source Software: Entwicklung und Definition . . . . . . . . . 3
2.2 Open Source Lizenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Wirtschaftliche Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems . . . . . . . 11
3.1 Rechtslage vor 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2 Insolvenzrechtsreform 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3 Rechtslage nach 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4 Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen . . . . . . . . . 18
4.1 Rechtseinräumung vor Insolvenzeröffnung . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.1.1 Synallagmatische Vertragsverhältnisse . . . . . . . . . . . . . 20
4.1.2 Erfüllung des Vertragsverhältnisses . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.3 Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Rechtseinräumung nach Insolvenzeröffnung . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2.1 Folgen der Insolvenzeröffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2.2 Problem: Lizenzhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2.3 Gutgläubiger Erwerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.4 Sukzessionsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.5 Umwandlung in proprietäre Software . . . . . . . . . . . . . 30
4.2.6 Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.3 Fazit: Unstimmige Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5 Lösungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.1 Lizenzvertragliche Anpassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.1 Sicherungsnießbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.2 Einredeverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2.3 Problem der Rechtsmängelhaftung . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2.4 Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.3 Einführung eines § 108a InsO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
IInhaltsverzeichnis
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
IIAbkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
BB Betriebs-Berater
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGH Bundesgerichtshof
BMJ Bundesministerium für Justiz
BR-Drs. Bundesrat-Drucksache
BT-Drs. Bundestag-Drucksache
CR Computer und Recht
DZWIR Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht
FIH Forschungsinstitut Havelhöhe
FK-InsO Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung
FSF Free Software Foundation
GesO Gesamtvollstreckungsordnung
GNU GNU is not unix
GPLv2 General Public License Version 2
GPLv3 General Public License Version 3
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR (Int.) Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Interna-
tionaler Teil)
ifrOSS Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source
Software
InsO Insolvenzordnung
ITRB Der IT-Rechts-Berater
KO Konkursordnung
LG Landesgericht
IIIAbkürzungsverzeichnis
LGPL Lesser General Public License
MüKo Münchener Kommentar
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanie-
rung
OLG Oberlandesgericht
OSI Open Source Initiative
Rn. Randnummer
UrhG Urhebergesetz
VerlG Gesetz zum Verlagsrecht
VglO Vergleichsordnung
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZUM-RD Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
IV1 Einleitung
1 Einleitung
Open Source Produkte sind in vielen Bereichen als Alternative zu
herkömmlicher Software zu finden. Linux oder OpenOffice sind z.B.
als Betriebssystem bzw. Open Source Software weit verbreitet. Da-
bei wird diese Software nicht immer nur von Initiativen oder pri-
vaten Entwicklern, sondern auch von absatzorientierten Unterneh-
men, wie Intel®, entwickelt und zur Verfügung gestellt.
Mit Open Source Software verbinden viele zunächst nur kostenlos
im Internet verfügbare Programme. Dahinter verbirgt sich jedoch
ein Konzept, dass den Gegenpol zur kommerziellen bzw. proprie-
tären Software darstellt. Mit der Sicherstellung verschiedener Frei-
heiten sollen dabei Benutzern mehr Rechte als bei der üblichen
kommerziellen Software eingeräumt werden. Open Source Software
bietet einige Vorteile im Vergleich zur kommerziellen Software. So
entstehen bei der reinen Nutzung von Open Source Produkten kei-
ne Lizenzkosten. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Wechsel
auf preiswerte Standardhardware und geringerer Ressourcenanfor-
derungen bei Open Source Programmen Hardwarekosten eingespart
werden können. Man profitiert außerdem von dem Know-how an-
derer Entwickler und ist gegenüber anderer Softwareanbieter unab-
hängig.1
So greift unter anderem auch das Forschungsinstitut Havelhö-
he (FIH) gGmbH aus Berlin auf „R“, eine Open Source Software
für statistische Berechnungen und der grafischen Darstellung der
Ergebnisse, zurück. Das Forschungsinstitut nutzt dieses Programm
außerdem für den gesamten vorausgehenden data mining Prozess
(Datengewinnung). Neben den Kosteneinsparungen bietet das Pro-
gramm mehr Flexibilität und Möglichkeiten, als die kostenpflich-
tigen Alternativen. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht außerdem
der Vorteil, dass die Ergebnisse und Skripte für jedermann nachvoll-
ziehbar und transparent sind.2 Was wäre aber, wenn die „R Foun-
dation“(Stiftung) etwa wegen dem Ausbleiben von Spenden oder
massenhaftem Austritt von Mitgliedern insolvent werden würde?
Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Software in der Insolvenz
des Lizenzgebers ist ein bislang juristisch wenig untersuchtes The-
ma. Dies wirft vor allem zwei Fragen auf:
1
Vgl. Wichmann, Linux- und Open-Source-Strategien, S. 34 ff.
2
Vgl. Schriftliche Befragung von Dr. Jan Axtner, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter FIH, vom 14.07.2014, im Anhang auf S. 48.
11 Einleitung
1. Kann der Lizenznehmer auf den Bestand der bereits über-
tragenen Nutzungsrechte auch nach Insolvenzeröffnung des
Lizenzgebers vertrauen?
2. Können auch nach der Insolvenzeröffnung Nutzungsrechte er-
worben werden?
Ein Blick ins Gesetz verschafft keine Abhilfe. Mit Überarbeitung
der Insolvenzrechtsreform 1999 ist zudem die zuvor mittels analoge
Anwendung anerkannte Insolvenzfestigkeit von Lizenzen in Frage
gestellt.
Um sich insbesondere den beiden Fragen nähern zu können, wer-
den zunächst allgemein die Begriffe der Open Source Software und
Open Source Lizenzen dargelegt. Neben der Entwicklung und Defi-
nition wird auch auf die wirtschaftliche Bedeutung der Open Source
Software eingegangen, die unter Umständen auf dem ersten Blick
nicht sofort ersichtlich ist. Eine Kategorisierung verschiedener Open
Source Lizenzen sowie die Abgrenzung zu proprietären Lizenzen soll
schließlich einen Überblick über die Vielfalt der existierenden Open
Source Lizenzen verschaffen. Anschließend wird die Insolvenzrechts-
reform als Ursache des Problems näher beleuchtet. Dabei wird die
Rechtslage vor und nach Überarbeitung des Gesetzes verglichen.
Es sollen außerdem die Beweggründe der Reform dargestellt wer-
den. Schließlich soll speziell die Insolvenzfestigkeit von Open Sour-
ce Lizenzen näher betrachtet werden. Kann der Insolvenzverwalter
die Nutzungsrechte einschränken oder gelten die Nutzungsrechte
fort und sind insolvenzfest? In diesem Rahmen wird die Situati-
on vor und nach Insolvenzeröffnung untersucht. Die Bachelorarbeit
beschränkt sich dabei auf den Fall, dass der Lizenzgeber als Her-
ausgeber der Software insolvent wird. Die Insolvenz des Lizenzneh-
mers wird hingegen nicht betrachtet. Auf Basis dieser Ergebnisse
werden anschließend verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten unter-
sucht, die eine Insolvenzfestigkeit herbeiführen könnten. Ziel der
Arbeit ist es, den aktuellen Rechtsstand in Deutschland zu dem
Thema „Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen“ und den
Umgang hiermit darzustellen.
22 Open Source Software und Lizenzen
2 Open Source Software und Lizenzen
Bevor auf die Problematik der Insolvenzfestigkeit eingegangen wird,
werden zunächst die Entwicklung und Definition von Open Source
Software geklärt, um ein einheitliches Verständnis zu schaffen. An-
schließend werden gängige Lizenzmodelle vorgestellt, die den An-
forderungen an Open Source Software gerecht werden. Schließlich
wird die wirtschaftliche Bedeutung von Open Source Anwendun-
gen thematisiert, die von vielen zunächst durch den Begriff und
dem Konzept von Open Source nicht vermutet wird.
2.1 Open Source Software: Entwicklung und
Definition
In den 80er Jahren fand in den USA eine Open Source Bewegung
statt, die durch die US-amerikanische „Free Software Foundation“
(kurz: FSF) ausgelöst wurde. Dieser Bewegung trat Ende der 90er
Jahre die „Open Source Initiative“ hinzu. Den Begriff der Open
Source Software gibt es damit seit 1998. Dank den Bemühungen der
freien Softwareszene, wurden bereits frühzeitig die wesentlichen Ei-
genschaften der Freien Software definiert, um sie damit von der so-
genannten „proprietären“ Software abzugrenzen.3 Die erste grund-
legende Definition von Freier Software stammt von der FSF, in der
vor allem der durch die Lizenzen ermöglichte freie Nutzen betont
wird. Sie beschreiben Open Source Software folgendermaßen4 :
„Ganz allgemein bedeutet das, dass Nutzer die Freiheit
haben, Software auszuführen, zu kopieren, zu untersu-
chen, zu ändern oder zu verbessern.“
Wie stehen aber die beiden verwendeten Begriffe „Freie Software“
und „Open Source Software“ zueinander? Zu Beginn der Bewegung
war der Begriff der Freien Software gebräuchlich. Allerdings wurde
dies vor allem in der Industrie mit Verschenken und damit Ge-
schäftsfeindlichkeit assoziiert und schreckte vor der Nutzung sol-
cher Programme ab. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Mar-
ketingoffensive gestartet. Daraus hat sich am 3. Februar 1998 in
3
Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69c Rn. 38; Jaeger/Metzger, Open Source Soft-
ware, Rn. 2 f.
4
GNU, Was ist freie Software?, URL: http://www.gnu.org/philosophy/
free-sw.de.html [Zugriff am 15.04.2014].
32 Open Source Software und Lizenzen
Kalifornien die „Open Source Initiative“ sowie der Begriff „Open
Source“ herausgebildet. Einer der ersten Aktionen der Initiative
war die Definition des Begriffs der Open Source Software.5 Dabei
wurden folgende Kriterien festgelegt6 :
– Freie Weitergabe: Die Lizenz darf keinem Nutzer den Verkauf
oder die Weitergabe der Software als Teil eines Pakets mit
Programmen aus verschiedenen Quellen unterbinden. Für die
Lizenz darf keine Gebühr anfallen.
– Source Code: Der Quellcode muss im Programm enthalten
sein. Die Verbreitung des Codes darf nicht unterbunden wer-
den.
– Veränderungen/Ableitungen: Veränderungen sind erlaubt und
unter den gleichen Bedingungen wie die der Ausgangsversion
zugänglich zu machen.
– Integrität: Die Lizenz kann die Verbreitung des geänderten
Quellcodes nur verbieten, wenn die Lizenzen stattdessen die
Verbreitung von „patch files“ (kleine Programmteile) erlaubt,
mit denen das Programm modifiziert werden darf.
– Keine Diskriminierung: Die Lizenz darf unter keinen Umstän-
den Personen oder Personengruppen diskriminieren. Darüber
hinaus darf sie nicht auf bestimmte Anwendungsfelder (z.B.
auf ausschließlich berufliche Nutzung) beschränkt werden.
– Verteilung der Lizenzen: Die Rechte, die am Programm ge-
bunden sind, stehen allen Nutzern zu, ohne, dass sie eine Zu-
stimmung einholen müssen.
– Keine Spezifizierung: Die Rechte, die dem Programm anhaf-
ten, hängen nicht von der Nutzung eines bestimmten Produk-
tes ab.
– Keine Verbote: Lizenzen dürfen keine Verbote auf Software
verhängen, die zusammen mit der lizenzierten Software ver-
trieben wird.
5
Open Source Initiative, History of the OSI, URL: http://opensource.org/
history [Zugriff am 14.04.2014].
6
Open Source Initiative, Open Source Definition, URL: http://opensource.
org/docs/osd [Zugriff am 16.04.2014].
42 Open Source Software und Lizenzen
– Neutralität: Die Lizenzen dürfen nicht die Bedingung enthal-
ten, dass Anwendungen auf individuelle Technologie oder be-
stimmte Schnittstellen basieren.
Im Zentrum steht dabei, dass Änderungen am offenen Quellco-
de ebenfalls unter den gleichen Bedienungen wie die Open Source
Lizenz der Ausgangsversion anderen Nutzern zugänglich gemacht
wird.7 Die Namensänderung Ende der 90er Jahre zeigte Wirkung;
große Unternehmen wie IBM und Oracle kündigten die Migrati-
on und Portierung (Plattformumstellung) ihrer Hard- und Software
auf Open Source Anwendungen an. Kritik gab es vor allem aus dem
Lager der Free Software Bewegung. Insbesondere die Free Software
Foundation sah hier einen Prinzipienwandel, bei dem nur noch der
offene Quellcode im Vordergrund stehe und auch „unfreie“ Software
darunter falle könne. 8 Sie kritisieren, dass ihre ethischen und sozia-
len Werte, insbesondere die Achtung der Freiheit der Nutzer, nicht
bei Open Source Software Anforderungen wiederzufinden wären. Zu
sehr würden dort die praktischen Werte, die Schaffung einer leis-
tungsstarken und zuverlässigen Software, überwiegen. Der soziale
Aspekt würde dort in den Hintergrund verdrängt sein.9
Die nahezu übereinstimmenden Anforderungen an die Softwa-
re und die Argumentation der Kritiker verdeutlichen, dass es sich
hier weniger um eine inhaltliche, denn eine ideologische Diskussi-
on handelt. Eine Trennung dieser Begriffe wird im Rahmen dieser
Bachelorarbeit daher nicht vorgenommen.
2.2 Open Source Lizenzen
Eine Softwarelizenz bestimmt die mit der Nutzung verbundenen
Rechten und Pflichten für die Lizenznehmer. Sie ist durch § 2 I Ur-
hG geschützt. § 12 UrhG ermöglicht es dem Urheber zu entscheiden,
ob und wie er seine Software veröffentlichen möchte und welche Li-
zenz er dafür wählt. Die Lizenzen speziell für Open Source Software
werden von der Open Source Initiative als solche anerkannt. Diese
entsprechen den in Kapitel 2.1 vorgestellten Kriterien und garantie-
ren vor allem die freie Nutzung, sowie die Änderung und Verbrei-
7
Auer-Reinsdorff, ITRB 2009, 69.
8
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 4.
9
GNU, Why Open Source misses the point of Free Software, URL: http:
//www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.de.html [Zugriff
am 17.04.2014].
52 Open Source Software und Lizenzen
Abbildung 1: Abgrenzung Open Source und proritäre Software
Software
Open Source Proprietär
Copyleft Kommerzielle
Vollversion
Strenges Nur Binär
Copyleft
Beschränktes Binär &
Copyleft Quellcode
Non Copyleft Shareware
Freeware
Freie Software
Quellcode für Anwender verfügbar
Kostenlos verfügbar
Darstellung in Anlehnung an: Bundesverwaltungsamt, URL: http://www.
bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BIT/Leistungen/IT_
Beratungsleistungen/CCOSS/02_OSS/03_Open-Source-Lizenzen/node.html
[Zugriff am 20.04.2014]
tung der Software. Software, die keine Open Source Lizenz erhalten
würde, wird als proprietäre Software bezeichnet. In Einzelfällen be-
steht auch die Möglichkeit, die Software sowohl proprietären als
auch Open Source Lizenzen zu unterstellen (sog. Dual Licensing).
Die proprietäre Lizenz erlaubt die kommerzielle Nutzung, die, je
nach Ausgestaltung, auch zum Beispiel Support- oder Softwarepfle-
geanspruch vorsehen kann. Die Nutzer erhalten nur den Binärcode,
der durch kompilieren des Quellcodes entsteht. Durch diese Über-
setzung in einen Maschinencode wird die Nutzung des Programms
ermöglicht, aber die Offenlegung und somit Weitergabe des Co-
des verhindert. Nur in Ausnahmefällen dürfen Benutzer auf den
Quellcode zugreifen. In der Regel fallen bei proprietärer Software
Lizenzkosten an. Diese fallen lediglich bei der kostenlosen Share-
ware (zeitlich beschränkte Nutzung, z.B. WinZip®) und Freeware
(zeitlich unbeschränkte Nutzung, z.B. Adobe Reader) nicht an. Der
nicht offengelegte Quellcode und die Unterbindung der Weitergabe
machen alle Ausformungen der proprietären Software zu „unfreier“
Software. Eine Übersicht der Abgrenzung zwischen Open Source
und proprietärer Software bietet Abbildung 1. 10 Die Lizenz wird
62 Open Source Software und Lizenzen
durch einen schuldrechtlichen Vertrag eingeräumt. Der schuldrecht-
liche Lizenzvertrag ist gesetzlich nicht geregelt. Das anwendbare
Recht leitet sich daher aus vielen verschiedenen Einzelregelungen,
insbesondere aus dem Urhebergesetz (UrhG), ab.11
Es existieren eine Vielzahl von Lizenzen, die den Kriterien der
Open Source Software gerecht werden. Abbildung 2 auf der nächs-
ten Seite stellt die 20 beliebtesten Open Source Lizenzen dar. Al-
lerdings nutzen rund 96 Prozent der Open Source Software die in
den Top 10 aufgelisteten Lizenzen. Mit 27 Prozent ist die General
Public License 2.0 (GPLv2) die beliebteste der Open Source Lizen-
zen und wird bei fast einem Drittel als Grundlage herangezogen. 17
Prozent nutzen die MIT License. Gerne genutzt werden außerdem
die General Public License 3.0 (GPLv3) und die Apache License.
Da die ersten vier Lizenzen bereits 70 Prozent ausmachen, haben
die übrigen Lizenzen einen eher geringen Anteil. Dazu gehören auch
unter anderem die von Microsoft geschaffene Lizenz „Microsoft Pu-
blic License“ (0,4 Prozent) oder die von Mozilla stammende „Mozilla
Public License“ (0,89 Prozent).
Unterteilt man die Open Source Lizenzen nach Lizenzierungs-
pflichten bei Bearbeitungen, erhält man fünf Kategorien:
1. Lizenzen mit einer strengen Copyleft-Regelung sehen vor, dass
alle Bearbeitungen die gleiche Lizenz wie die Ursprungsli-
zenz erhalten. Hierunter fallen zum Beispiel die prozentual am
meisten genutzten Lizenzen General Public Licenses 2 und 3
(GPLv2, GPLv3). Das vom Forschungsinstitut Havelhöhe ge-
nutzte Open Source Programm „R“ nutzt z.B. die GPLv212 .13
2. Ist hingegen nur eine beschränkte Copyleftklausel vorgese-
hen, sind Ausnahmen bei der Lizensierungspflicht für Bear-
beitungen möglich. Dies ermöglicht Kombinationen mit an-
deren proprietären Softwaremodulen unter anderen Lizenzbe-
dingungen. Solch eine Klausel beinhaltet unter anderem die
Mozilla Public License und die GNU Lesser General Public
10
Bundesverwaltungsamt, Open-Source-Lizenzen, URL: http://www.bva.
bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BIT/Leistungen/IT_
Beratungsleistungen/CCOSS/02_OSS/03_Open-Source-Lizenzen/node.
html [Zugriff am 20.04.2014].
11
Weber/Hötzel, NZI 2011, 432.
12
R-Project, What ist R, URL: http://www.r-project.org [Zugriff am
14.07.2014].
13
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 24.
72 Open Source Software und Lizenzen
Abbildung 2: Top 20 Open Source Lizenzen
Common Development and GNU Affero GPL v3, 0,40%
Mozilla Public License (MPL) Distribution License (CDDL),
Simplified BSD, 0,89%
1.1, 0,89% 0,40% Microsoft Reciprocal License
(Ms-RL), 0,40%
Code Project Open 1.02 License,
1,92% CDDL-1.1, 0,40% Sun GPL With Classpath
Exception v2.0, 0,40% zlib/libpng License, 0,23%
GNU Lesser General Public
License (LGPL) 3.0 , 2,00%
Common Public License (CPL),
Microsoft Public License, 2,00% 0,19%
Eclipse Public License (EPL),
2,00%
GNU Lesser General Public
License (LGPL) 2.1 , 5,00%
GNU General Public License
(GPL) 2.0, 27,00%
Artic License (Perl), 5,00%
BSD License 2.0 (3-clause, New
oder Revised) License, 7,00%
GNU General Public License
(GPL) 3.0, 11,00% MIT License, 17,00%
Apache License 2.0, 15,00%
Darstellung in Anlehnung an: BlackDuck, Top 20 Open Source Licen-
ses (Stand: Juli 2014), URL: https://www.blackducksoftware.com/resources/
data/top-20-open-source-licenses [Zugriff am 19.07.2014].
License (kurz: LGPL). Sie wurde entwickelt, da die GPL in
einigen Fällen zu streng war und die Verbreitung der Open
Source Software zu behindern drohte.14
3. Wird bei der Lizenz auf eine Copyleft-Klausel verzichtet, ent-
fällt bei Bearbeitungen die Lizenzierungspflicht. Dies soll die
Akzeptanz fördern. Diese Variante ist durch den Wegfall der
Pflicht rechtlich wenig problematisch und in der Literatur da-
her wenig thematisiert. Keine Copyleft-Klausel gibt es zum
Beispiel bei der der Apache Software License, die, wie aus
Abbildung 2 ersichtlich, ebenfalls zu den 20 beliebtesten Li-
zenzen zählt.15
4. Außerdem gibt es die sogenannten „Artistic“-Lizenzen. Dort
kann bei Änderungen der Bearbeiter zwischen verschiedenen
Lizenzen wählen.16
5. Werden dem Inhaber Sonderrechte eingeräumt, so kann ein
14
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 81; Wichmann, Linux- und
Open-Source-Strategien, S. 6.
15
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 98; Wichmann, Linux- und
Open-Source-Strategien, S.6.
16
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 107.
82 Open Source Software und Lizenzen
Bearbeiter Änderungen vornehmen, ohne jedoch Rechte an
der Ursprungssoftware von dem Inhaber zu erhalten. Häufig
nutzen dies Unternehmen, die als Inhaber den Quellcode of-
fen gelegt haben, in der Hoffnung, dass dieser weiterentwickelt
wird. Die Unternehmen erhalten an den Weiterentwicklungen
Sonderrechte und könnten Beiträge z.B. proprietär nutzen.
Ein Beispiel wäre die, nicht in den Top 20 vertretene, Netsca-
pe Public License von Mozilla. Dieses Lizenzmodell hat aller-
dings im Laufe der Jahre an Bedeutung verloren. Unterneh-
men greifen zunehmend auf Lizenzen der übrigen Kategorien
zurück. Nichtsdestotrotz versuchen sie, die Urheberrechte von
externen Programmierern übertragen zu bekommen, wie dies
zum Beispiel bei Open-Office.org-Produkten der Fall ist.17
2.3 Wirtschaftliche Bedeutung
Betrachtet man die Definitionskriterien von Open Source Software
und die Abgrenzung der Lizenzen von proprietären Anwendungen,
fällt vor allem der soziale Aspekt des offenen Quellcodes und der
freien Nutzung ins Auge. Je nach Lizenz-Kategorie dürfen auch
die Bearbeitungen von Lizenzen nicht von der strengen Copyleft-
Regelung abweichen und nicht mit anderen Lizenzbedingungen kom-
biniert werden. Hat die kostenlos verfügbare Open Source Software
wirtschaftlich also überhaupt ein Gewicht?
In einer von der EU in Auftrag gegebenen Studie aus dem Jahr
2006 wurden die ökonomischen Auswirkungen von Open Source
Software untersucht. Darin wurde der Wert der existierenden Open
Source Anwendungen auf rund zwölf Milliarden Dollar geschätzt.
Sie stellten außerdem fest, dass Firmen rund 1,2 Milliarden Euro
in die Entwicklung von Open Source Software investiert haben. Sie
prognostizierten darüber hinaus, dass der Anteil am IT-Markt auf
32 Prozent und auf 4 Prozent am europäischen Bruttoinlandspro-
dukt in den nächsten vier Jahren anwachsen würde. Open Source
Software gewinnt demzufolge in der Wirtschaft immer mehr an Be-
deutung.18
Die wirtschaftliche Bedeutung wird bei Open Source Software oft-
17
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 113.
18
UNU-Merit, Economic impact of open source software, S. 9, auch
online verfügbar unter: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/
2006-11-20-flossimpact_en.pdf [Zugriff am 28.04.214].
92 Open Source Software und Lizenzen
mals zunächst als gering eingeschätzt, da die Lizenzgebühren entfal-
len. Die Gründe, warum auch absatzorientierte Unternehmen Open
Source Software entwickeln und darin investieren, sind auf dem
ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich. Tatsächlich bildet Open
Source Software die wirtschaftliche Grundlage in einer Reihe von
Geschäftsmodellen19 :
– Softwareintegration: Unternehmen schaffen bei der Softwar-
eintegration Verknüpfungen zwischen verschiedener Softwa-
re. Diese können dann der breiten Masse an Unternehmen
angeboten werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit sie
individuell für bestimmte Unternehmen in Kombination mit
Supportverträgen anzubieten.
– Hardwareintegration: Jede Hardware mit Prozessor benötigt
entsprechende Software. Bei diesem Geschäftsmodell wird ei-
ne Kombination aus Hardware mit darauf abgestimmter Soft-
ware angeboten. Es wird daher auch von eingebetteten Syste-
men (engl. „Embedded Systems“) gesprochen. Dieses Modell
stellt einen schnell wachsenden Markt in der Computerindus-
trie dar. Beliebt ist dieses Geschäftsmodell vor allem deshalb,
da beim Rückgriff auf Open Source Software die Hardware-
Hersteller nicht auf einzelne Anbieter angewiesen sind. So bie-
tet z.B. IBM Computer an, die das Open Source Betriebssys-
tem GNU/Linux bereits enthalten. Ein weiteres Beispiel sind
etwa Smartphones, die Android nutzen.
– Support/Publikationen: Einige Unternehmen bieten auch als
Beratungsunternehmen Support für die Open Source Software
an. Es gibt außerdem Webseiten, die sich als Mittler zwischen
Entwicklern und Nutzern anbieten (sog. Mediatoren). Seiten
wie SourceForge.net bieten daneben meist kostenfrei Hilfsmit-
tel für Entwickler wie z.B. Wikis an. Unternehmen können
außerdem Veröffentlichungen zu Open Source Themen oder
Produkten anbieten und diese bei entsprechenden Fachbuch-
verlagen vertreiben. Zu dem Open Source Statistikprogramm
„R“ gibt es so zahlreiche Publikationen, die den Umgang mit
„R“ erklären. Außerdem können Fachartikel in Zeitschriften,
wie dem „Linux Magazin“, veröffentlicht werden.
19
Vgl. Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 19 ff.; Keßler, Anpassung
von Open-Source-Software in Anwenderunternehmen, S. 18 ff.
103 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
– Auftragsentwicklung: Bei der Auftragsentwicklung werden drin-
gend benötigte Erweiterungen einer Open Source Software
entwickelt, die die ursprüngliche Version nicht anbietet. Die-
ses Geschäftsmodell wird häufig bei beliebten Open Source
Produkten angeboten.
– Schaffen einer Entwicklungsumgebung: Bei diesem Geschäfts-
modell wird eine Entwicklungsumgebung für eine Open Sour-
ce Software und die Serverkonsole für den Open Source Server
bereitgestellt.
– Kommerzielle Verbesserung: Dieses Geschäftsmodell ähnelt
dem der Auftragsentwicklung. Allerdings werden hier Verbes-
serungen an der ursprünglichen Open Source Software vorge-
nommen und keine Erweiterung entwickelt.
Während die Veröffentlichung der Open Source Software im Inter-
net kostenlos stattfindet, haben sich daneben also einige Geschäfts-
modelle entwickelt, die sich Open Source Software als wirtschaft-
liche Basis zu Nutze machen. Obwohl sich Open Source Anwen-
dungen insbesondere durch die freie Weitergabe und den offenen
Quellcode auszeichnen, besitzen sie durchaus wirtschaftliches Ge-
wicht, welches vermutlich mit wachsender Beliebtheit weiter anstei-
gen wird.
3 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache
des Problems
Nachdem im vorherigen Kapitel Open Source Software und Lizen-
zen definiert, als auch die Hintergründe und die wirtschaftliche Be-
deutung für einen umfassenden Eindruck dargelegt wurden, soll nun
die Insolvenzfestigkeit der Lizenzen betrachtet werden. Zuvor wird
allerdings die Insolvenzrechtsreform 1994/1999 als Ausgangspunkt
des Problems der Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen nä-
her beleuchtet. Hierfür wird zunächst die Rechtslage vor 1999 dar-
gestellt. Anschließend sollen die Gründe der Insolvenzrechtsreform
aufgeführt werden. Danach soll die nun herrschenden Rechtslage
mit den entstandenen Problemen und den Umgang damit darge-
legt werden.
113 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
3.1 Rechtslage vor 1999
Bevor 1999 die Insolvenzordnung (InsO) in Kraft trat, galten die
Regelungen der Konkursordnung (KO) von 1877, der Vergleichs-
ordnung (VglO) von 1935 und der Gesamtvollstreckungsordnung
(GesO) von 1991. Die Konkursordnung hatte die Vollstreckung der
Gläubigeransprüche als Hauptziel. Die Gläubiger sollten in einem
selbst verwalteten Verfahren, unter Aufsicht des Gerichts, gemein-
sam befriedigt werden. Die später eingeführte Vergleichsordnung
sollte den nicht bevorrechtigten Konkursgläubigern eine höhere Quo-
te sichern.20 Während die Konkurs- und Vergleichsordnung in West-
deutschland Anwendung fanden, galt auf dem Gebiet der ehemali-
gen DDR die Gesamtvollstreckungsordnung.21
Wie wurden nun vor 1999 Lizenzverträge in der Insolvenz be-
handelt? Bereits unter Anwendung der Konkursordnung waren die
Auswirkungen einer Insolvenz auf die Lizenzen umstritten. Damals
wie heute fehlt es an einer speziellen Regelung für Lizenzen. Zur
Diskussion stand insbesondere, ob § 17 oder § 21 KO Anwendung
finden würde. § 17 KO sah ein Wahlrecht für den Konkursverwal-
ter bei gegenseitigen Verträgen vor, während § 21 KO regelte, dass
Miet- und Pachtverhältnisse über Gegenstände nicht durch die In-
solvenz beeinträchtigt werden.22 Die herrschende Meinung und die
Rechtsprechung gingen davon aus, dass im Falle des Konkurses des
Lizenzgebers § 21 KO analog Anwendung fand, wenn sie bereits dem
Lizenznehmer überlassen war. Wurde die Erfindung bzw. das Know-
how noch nicht überlassen, so hatte der Konkursverwalter hingegen
ein Wahlrecht nach § 17 KO zwischen Erfüllung und Nichterfüllung
des Lizenzvertrages.23 Ein Lizenzvertrag ist zwar nicht als Pacht-
oder Mietvertrag, sondern als Vertrag sui generis (eigener Art) an-
zusehen. Es ist jedoch bei dauerhaften Lizenzverträgen mit wie-
derkehrenden Lizenzzahlungen ein hohes Maß an Vertrauen des Li-
zenzgebers in die Kreditwürdigkeit des Lizenznehmers notwendig,
sodass § 19-21 KO analog angewendet wurden.24 Damit blieb der
Lizenzvertrag nach § 21 I KO von der Konkurseröffnung unberührt
20
Braun/Kießner, Einf. Rn. 1ff.
21
Landfermann, BB 1995, 1649.
22
Schleich/Götz, DZWIR 2008, 58.
23
BGH, NJW-RR 1995, 936, 938; Jaeger/Henckel, § 21 KO Rn. 6;
Kuhn/Uhlenbruck, § 21 KO Rn. 4a.
24
Kuhn/Uhlenbeck, § 19 KO Rn. 2a; Schleich/Götz, DZWIR 2008, 58 f.
123 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
und somit konkursfest.25
3.2 Insolvenzrechtsreform 1999
Bereits 1994 verkündet, ist die InsO zum ersten Januar 1999 in
Kraft getreten. Der lange Zeitraum zwischen Verkündung und In-
krafttreten wurde gewählt, um die Insolvenzgerichte nicht übermä-
ßig zu belasten. Der Ausbildung zusätzlicher Rechtspfleger wur-
de damit Zeit gegeben und die Unternehmen konnten sich auf die
neue Rechtslage besser einstellen. Der Grund für das Inkrafttre-
ten der InsO war der unhaltbare Zustand, dass Konkursanträge in
3/4 aller Insolvenzfälle mangels Masse abgewiesen worden sind. Das
Problem der Verbraucherverschuldung konnte während der letzten
Jahre ebenfalls nicht gelöst werden. Nach der Wiedervereinigung
wollte man außerdem die bisherige Rechtsspaltung überwinden. Die
Insolvenzordnung ist anstelle der Konkursordnung und Vergleichs-
ordnung getreten. 26
Mit der Insolvenzordnung wurde ein einheitliches Verfahren für
natürliche und juristische, als auch für Kaufleute und Nichtkauf-
leute geschaffen. Folgende Ziele wurden im Wesentlichen mit der
Reform 1994/1999 verfolgt27 :
– Einheitliches Verfahren: Wie bereits erwähnt, wurde mit der
Rechtsordnung Rechtseinheit zwischen West- und Ostdeutsch-
land hergestellt. Die Verfahrensziele Liquidation und Sanie-
rung bestehen außerdem gleichwertig nebeneinander. Es ist
die freie Entscheidung der Gläubiger, welches Verfahrensziel
im Einzelnen verfolgt werden soll. Außerdem wurde die örtli-
che Zuständigkeit vereinfacht. Im Grundsatz gilt, dass es ein
Insolvenzgericht je Landgerichtsbezirk gibt.
– Bekämpfung der Massearmut: Viele Konkursverfahren konn-
ten mangels Masse nicht eröffnet werden. Die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens sollte nun vor allem frühzeitig, leichter
und häufiger ermöglicht werden. Damit die Insolvenzverfah-
ren zu einem Zeitpunkt beantragt werden können, bei dem
eine Sanierung noch Aussicht auf Erfolg hat, wurde die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit in § 18 InsO als neuer Eröffnungs-
25
Jaeger/Henckel, § 21 KO Rn. 6, 8; Schleich/Götz, DZWIR 2008, 58 f.
26
Landfermann, BB 1995, 1649.
27
Braun/Kießner, Einf. Rn. 12 ff.
133 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
grund eingeführt. Die Insolvenzmasse muss nun die Verfah-
renskosten (inklusive Abwicklungskosten) decken können. Die
Masse soll außerdem durch Neuerwerb, ebenso wie durch ei-
ne Erleichterung der Anfechtungsansprüche mittels teilweisen
Verzicht auf die Erfüllung subjektiver Merkmale, angereichert
werden können.
– Stärkung der Gläubigerautonomie: Die Abwicklung des In-
solvenzerfahrens wird von den Gläubigern bestimmt. Die ge-
stärkte Gläubigerautonomie wird zum Beispiel durch die Be-
stimmung eines Verwalters nach § 97 InsO zum Ausdruck ge-
bracht. Auch besteht die Möglichkeit, den Insolvenzverwal-
ter zu beauftragen, einen Insolvenzplan zu erstellen (§ 157
S. 2 InsO). Der Insolvenzplan ist das Kernelement des ein-
heitlichen Verfahrens. Durch ein Mehrheitsprinzip können die
Beteiligten in Abweichung aller Liquidationsregeln die güns-
tigste Form der Insolvenzabwicklung bestimmen.
– Verbraucherinsolvenz: Im Rahmen des neuen Verbraucherin-
solvenzverfahren sollen Fälle schneller und kostengünstiger
abgewickelt werden.
– Restschuldbefreiung: Um zu einer Antragstellung zu bewegen,
wurde die Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) als ein neu-
es Verfahren eingeführt. Die Restschuldbefreiung ist nach ei-
ner sechsjährigen Wohlverhaltensperiode für natürliche Per-
sonen möglich. Voraussetzung dafür ist, dass das pfändbare
Arbeitseinkommen den Gläubigern zur Verfügung steht. In-
solventen Schuldnern soll durch die Restschuldbefreiung die
Möglichkeit eines Neustarts gegeben werden. Alternativ be-
steht auch mit dem Aufstellen eines Insolvenzplans die Mög-
lichkeit der Befreiung.
3.3 Rechtslage nach 1999
Die Einführung der Insolvenzordnung 1999 führte gleichzeitig zu
einer Veränderung der Rechtslage bei Lizenzverträgen. Wenngleich
der Gesetzgeber keine Änderungen der bisherigen Rechtspraxis bezwe-
cken wollte, so gestaltet sie sich nun zum Nachteil der Lizenzneh-
mer. Der Rechtsgedanke des § 21 KO, dass Miet- und Pachtverhält-
nisse über Gegenstände nicht von der Insolvenz betroffen sind, ist
143 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
nun in § 108 InsO wiederzufinden. Allerdings beschränkt sich die
Anwendung des § 108 InsO, anders als der bisherige § 21 KO, auf
Miet- und Pachtverhältnisse über das unbewegliche Vermögen.28
Der Begriff der unbeweglichen Gegenstände ist in § 49 InsO legal-
definiert. Darunter fallen solche, die dem unbeweglichen Vermögen
unterliegen, wie etwa Grundstücke, Schiffe oder Flugzeuge. Nicht
erfasst sind hingegen Verträge über Mobilien und Rechte, da als
unbeweglich nach § 90 BGB nur körperliche Gegenstände gesehen
werden.29
Aufgrund dieser Anpassung ist heutzutage umstritten, ob und
unter welchen Umständen Lizenzverträge bei einer Insolvenz des
Lizenzgebers überhaupt fortbestehen. Eine Ansicht sieht § 108 In-
sO weiterhin in analoger Anwendung mit der gleicher Begründung
wie zu § 21 KO, da § 103 InsO lediglich für Miet- und Pachtverhält-
nisse über bewegliche Sachen geschaffen wurde. Man wollte mit der
Gesetzesänderung lediglich den Anwendungsbereich für bewegliche
Gegenstände einschränken. Der Gesetzgeber habe bei der Unter-
teilung zwischen Mobilien und Immobilien den analogen Anwen-
dungsbereich des § 108 InsO schlichtweg nicht bedacht.30 Gegen
diese analoge Anwendung spricht jedoch, dass § 108 InsO lex spe-
cialis zu § 103 InsO ist. Mit Nichtanwendung des § 108 InsO kann
demzufolge immer noch auf die allgemeinen Regeln für gegenseitige
Verträge zurückgegriffen werden. Eine planwidrige Lücke, die für
eine analoge Anwendung sprechen würde, kann daher nicht ange-
nommen werden.31
Andererseits wird in der Literatur vertreten, dass bei einer dauer-
haften Softwareüberlassung und der Erfüllung der Leistungspflich-
ten die Lizenzverträge weiterhin bestehen bleiben. Begründet wird
dies damit, dass Lizenzverträge gegen Einmalzahlung als Kaufver-
träge zu qualifizieren seien und kein miet-, oder pachtähnliches Dau-
erschuldvehältnis darstellen. Mit wirksamer Einräumung der Lizenz
gegenüber dem Lizenznehmer, seien die vertraglichen Pflichten zu-
mindest seitens des Softwarehauses erfüllt worden. Das von § 103
InsO verlangte Kriterium des beidseitig nicht erfüllten Vertrages
28
Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 170b; Schleich/Götz, DZWIR
2008, 58, 59.
29
Braun/Kroth, § 108 Rn. 10 f.; MüKo/Eckert, § 108 Rn. 36 f.
30
Fezer, WRP 2004, 793, 803.
31
McGuire, GRUR 2009, 13, 15.
153 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
würde dieser Ansicht zufolge fehlen.32 Das Problem ist allerdings
hier, das verkannt wird, dass die Nutzungsbefugnis allein aus dem
Lizenzvertrag resultiert, da es kein gesetzliches Schuldverhältnis für
Lizenzen gibt. Der Bestand der Lizenz ist damit von dem Bestand
des Lizenzvertrages abhängig. Mit Beendigung des Vertrages enden
auch die Nutzungsrechte. Der Vertrag endet aber nicht unbedingt
mit Zahlung der Lizenzgebühr. Anschließend möchte der Lizenz-
nehmer auch die Lizenz in Anspruch nehmen. Damit ist der Li-
zenzgeber dem Lizenznehmer verpflichtet, die Nutzungsrechte dau-
erhaft zu überlassen und zu gewährleisten, dass dies auch möglich
ist. Es ist daher eher von einem Dauernutzungsverhältnis auszuge-
hen, bei dem die vollständige Erfüllung erst mit Beendigung der
Vertragslaufzeit eintritt.33 Die Ausgestaltung des Lizenzvertrages
ähnelt damit mehr einem Dauerschuldverhältnis wie der Miete oder
Pacht, als einem Kaufvertrag. Der Ansicht, dass ein Lizenzvertrag
als Kaufvertrag zu qualifizieren sei, kann daher nicht gefolgt wer-
den.
Eine andere Meinung sieht ebenfalls die Rechtsstellung des Li-
zenznehmers in der Insolvenz des Lizenzgebers als insolvenzfest an,
da sie, entgegen der herrschenden Ansicht, das Abstraktionsprinzip
als weiterhin gültig betrachtet. Die überwiegende Meinung begrün-
det die Nichtgeltung des Abstraktionsprinzips bei Nutzungsrechten
und Lizenzen aus einer analogen Anwendung des § 9 VerlG. § 9
VerlG sieht vor, dass mit Beendigung des Vertragsverhältnisses das
Verlagsrecht erlischt (Kausalprinzip). Diese Nichtgeltung des Ab-
straktionsprinzips wird analog auch im Urheberrecht angewendet.34
Dagegen könnte sprechen, dass § 9 VerlG noch nicht einmal bei
einer Insolvenz im Bereich des Verlagsrechts angewendet werden
würde. Versteht man die damaligen Gesetzesmaterialien so, dass
eine Ausklammerung des Konkurses aus dem Anwendungsbereich
des § 9 VerlG ausdrücklich gewollt war, so würde es bereits an einer
planwidrigen Lücke fehlen, um eine Analogie annehmen zu können.
Damit würde der schuldrechtliche Lizenzvertrag unter die Anwen-
dung des § 103 InsO fallen. Die Lizenzen müssten jedoch nicht zu-
rückübertragen werden, da der Entgeltanspruch im Interesse der
32
Berger, CR 2006, 505, 507; Grützmacher, CR 2006, 289 f.; Wallner, ZIP 2004,
2073, 2076.
33
Vgl. McGuire, GRUR 2009, 13, 16 f.
34
BGH, NJW 1958, 1583, 1584 - Privatsekretärin; LG Mannheim, ZIP 2004,
576; Wandtke, Urheberrecht, § 4 Rn. 9.
163 Die Insolvenzrechtsreform als Ursache des Problems
Masse liegt. Bei Zurückbehaltung könne der Lizenznehmer zudem
aufgrund der Nichterfüllung des Lizenzvertrages einen Schadenser-
satz nach § 273 BGB verlangen.35 Hier wird allerdings verkannt,
dass bei Betrachtung des Wortlautes des § 9 VerlG keine Differen-
zierung vorgenommen wird, sondern es nur entscheidend ist, ob der
schuldrechtliche Vertrag beendet wurde. 36 Wenn der Gesetzgeber
bereits bei Entstehung des Gesetzes eine Ausnahmeregelung bei § 9
VerlG für den Fall der Insolvenz unbedingt gewollt hätte, so hätte
er dies wohl auch mit aufgenommen. Es ist daher der herrschenden
Ansicht zu folgen, dass das Abstraktionsprinzip bei Nutzungsrech-
ten und Lizenzen keine Anwendung findet.
Die herrschende Meinung ordnet auch nach der Reform Lizenz-
verträge als Dauernutzungsvertrag der Rechtspacht entsprechend
der §§ 108, 112 InsO ein. Die Lizenz kann aber nicht unter den
Begriff des unbewegliches Vermögens subsumiert werden (da Li-
zenzen, wie in Kapitel 2.2. erwähnt, die Rechten und Pflichten des
Lizenznehmers definieren und somit nicht körperlich sind). § 108
InsO ist nach der herrschenden Ansicht folglich nicht anwendbar.
Daher muss auf den allgemeinen § 103 InsO zurückgegriffen wer-
den.37 § 103 InsO räumt dem Insolvenzverwalter ein Wahlrecht ein,
beiderseitig noch nicht vollständig erfüllte Verträge zu erfüllen oder
die Erfüllung abzulehnen. Das Wahlrecht wird dabei sehr weit aus-
gedehnt. Selbst wenn die jeweiligen Hauptpflichten (Einräumung
der Lizenz, vollständige Zahlung der Lizenzgebühr) bereits erfüllt
sind, die Nebenpflichten jedoch weiterhin bestehen, wird angenom-
men, dass der Vertrag beidseitig noch nicht erfüllt ist.38 Eine Ne-
benpflicht in einem Softwarelizenzvertrag könnte zum Beispiel die
Erbringung von Softwareupdates über einen bestimmten Zeitraum
sein.39
Bei der derzeit geltenden Rechtslage kann der Insolvenzverwalter
also den Vertrag fortsetzen oder die Erfüllung ablehnen. Wählt er
die Erfüllung, so kann er die volle Lizenzgebühr als eine der Masse
zustehenden Forderung verlangen. Der Lizenznehmer darf im Ge-
35
Wallner, ZIP 2004, 2073, 2078 ff.
36
LG Mannheim, ZIP 2004, 576, 578.
37
BGH, GRUR 2006, 435, 437; LG Mannheim, ZIP 2004, 576, 577; Abel,
NZI 2003, 121, 124; FK-InsO/Wegener, § 103 Rn. 23; Tintelnot, in: Küb-
ler/Prütting/Bork, § 103 Rn. 62; McGuire, GRUR 2009, 13, 17; Mü-
Ko/Huber, § 103 Rn. 64, 76.
38
Berger, NZI 2006, 380.
39
Weber/Hötzel, NZI 2011, 432, 434.
174 Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen
genzug nach wie vor entsprechende Nutzungshandlungen vorneh-
men. Wird die Erfüllung von ihm allerdings abgelehnt oder auf Auf-
forderung gar nichts erklärt, so sind die gegenseitigen Erfüllungsan-
sprüche mit Insolvenzeröffnung „suspendiert“. Der Insolvenznehmer
kann sich dann nur noch als Insolvenzgläubiger am Insolvenzver-
fahren wegen Nichterfüllung einer Forderung beteiligen. Die quo-
tenmäßige Befriedigung ist in der Regel sehr gering.40 Durch die
Ablehnung der Erfüllung des Lizenzvertrages erlischt nach bishe-
riger Rechtsprechung auch die „dingliche“ Lizenz. Dies hängt mit
der „Nichtgeltung des Abstraktionsprinzips“ zusammen, sodass der
schuldrechtliche Lizenzvertrag und die dingliche Lizenz miteinan-
der verbunden sind. Der Lizenznehmer verliert also nicht nur die
schuldrechtlichen Ansprüche aus dem Lizenzvertrag, sondern auch
das Recht, die Software weiterhin nutzen zu dürfen.41 Die Insol-
venz des Lizenzgebers stellt die Lizenznehmer insbesondere dann
vor erheblichen Risiken, wenn die Software im Unternehmen oder
in ihren Produkten verwendet wird. Bereits getätigte Zahlungen
sind außerdem verloren.42
Open Source Software und Lizenzen unterscheiden sich allerdings
erheblich von proprietären Softwarelizenzen (vgl. Kapitel 2.2.). Ist
eine Anwendung des § 103 InsO dennoch auf Open Source Lizenzen
ohne Weiteres möglich?
4 Die Insolvenzfestigkeit von Open
Source Lizenzen
Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, wird bei der Insolvenz des
Lizenzgebers dem Insolvenzverwalter ein Wahlrecht nach § 103 In-
sO eröffnet, soweit der Vertrag mit Insolvenzeröffnung nicht oder
noch nicht vollständig erfüllt ist. Er kann in diesem Fall über die Er-
füllung oder Nichterfüllung des Lizenzvertrages entscheiden. Open
Source Software unterscheidet sich allerdings, wie bereits in Kapitel
2 erwähnt, in vielerlei Hinsicht von proprietärer Software. Wesentli-
che Kriterien waren, neben der Neutralität der Programme, die Er-
laubnis Veränderungen vorzunehmen und das Verbot, die Software
40
Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69c Rn. 43; Gottwald/Huber, InsolvenzR-Hb, §
37 Rn. 50; Smid/Lieder, DZWIR 2005, 7, 12.
41
Berger, NZI 2006, 380, 281 f.
42
Berger, GRUR 2004, 20; Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69c Rn. 43.
184 Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen
von bestimmten Programmen abhängig zu machen. Insbesondere
geht es aber um die Offenlegung des Codes und die kostenfreie und
uneingeschränkte Weitergabe der Software an alle Nutzer. Ob das
Wahlrecht nach § 103 InsO daher auch uneingeschränkt bei Open
Source Lizenzen möglich ist, soll in diesem Kapitel untersucht wer-
den. Dabei wird hier aufgrund der Folgen für den Lizenzvertrag
danach differenziert, ob die Nutzungsrechte für den Lizenznehmer
vor oder nach der Insolvenzeröffnung eingeräumt wurden.
Kann aber eine kostenlose und zur freien Weitergabe bestimmte
Software überhaupt Teil der Insolvenzmasse sein? § 35 InsO defi-
niert die Insolvenzmasse als das gesamte Vermögen, das dem In-
solvenzschuldner zur Eröffnung des Verfahrens bereits gehört oder
das er während des Verfahrens erlangt. Kriterien, wie die kostenlo-
se und freie Weitergabe, schließen aber noch nicht notwendig aus,
dass Open Source Software als Teil der Insolvenzmasse qualifiziert
werden kann. Der Insolvenzverwalter muss bei der Verwertung von
Software, die nicht auf den Vertrieb ausgerichtet ist, die Zustim-
mung des Urhebers einholen. Auch wenn die Zustimmung nicht er-
teilt wird, so bleibt sie ein Teil davon, kann aber nicht in Form
eines Vertriebs gegen Bezahlung verwertet, wohl aber kostenfrei
überlassen werden.43 Open Source Software kann demzufolge der
Insolvenzmasse zugeordnet werden.
4.1 Rechtseinräumung vor Insolvenzeröffnung
Was geschieht mit den Nutzungsrechten an Open Source Software,
die noch vor Insolvenzeröffnung erworben wurden? Erst mit Insol-
venzeröffnung verliert der Insolvenzschuldner die Verwaltungs- und
Verfügungsbefugnis über sein Vermögen, § 80 I InsO. Die vor diesem
Zeitpunkt getätigten Rechtsgeschäfte sind grundsätzlich wirksam.
Die hier erworbenen Rechte fallen nicht in die Insolvenzmasse, § 91
InsO.44 Ist § 103 InsO auf solche Lizenzverträge anwendbar, die
vor Insolvenzeröffnung abgeschlossen wurden? Damit würde dem
Insolvenzverwalter ein Wahlrecht zwischen Erfüllung oder Nichter-
füllung des Lizenzvertrages zustehen. Bei Wahl der Erfüllung müss-
te er dann die ausstehende Leistung als Masseverbindlichkeit nach
§ 55 II Nr. 2 InsO erbringen und könnte die Gegenforderung für die
43
Koch, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-Recht, Teil 26.1 Rn. 89.
44
BGH, ZIP 2003, 1208, 1209; Gottwald/Huber, InsolvenzR-Hb, § 34 Rn. 1.
194 Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen
Masse verlangen. Die gegenseitigen Ansprüche, deren Durchsetzbar-
keit aufgrund der Insolvenzeröffnung gehemmt war, wären wieder
umsetzbar und erhalten die Rechtsqualität von originären (neuen)
Masseverbindlichkeiten und -forderungen. Der Insolvenzverwalter
kann dann den Wert der gegenseitigen Verträge für die Masse rea-
lisieren. Der Wert eines Vertrages ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen Leistung und Gegenleistung. Der gegenseitige Vertrag bleibt
materiell-rechtlich unberührt, für den Lizenznehmer ändert sich also
am Vertragsverhältnis nichts. Es richtet sich inhaltlich nach dem Li-
zenzvertrag, wie er zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung zwischen
den Parteien bestand. 45 Würde die Erfüllung hingegen abgelehnt
werden, so hätte der Lizenznehmer, wie bereits in Kapitel 3.3
erwähnt, nur noch nach § 103 II 1 InsO die Möglichkeit die Forde-
rungen als Insolvenzforderung anzumelden und sich aus der Masse
quotenmäßig befriedigen zu lassen. Wesentliche Voraussetzungen
für die Anwendung des § 103 InsO sind das Vorliegen synallagmati-
scher Vertragsverhältnisse, sowie die Nichterfüllung des Rechtsver-
hältnisses beider Seiten.46
4.1.1 Synallagmatische Vertragsverhältnisse
Für die Anwendung des § 103 InsO müsste zunächst der Open
Source Lizenzvertrag ein gegenseitiges Rechtsverhältnis darstellen.
Verträge gelten im Sinne dieser Vorschrift als synallagmatisch, bei
dem die Verpflichtungen der Vertragsparteien wie bei §§ 320 ff.
BGB im gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen und somit
für den jeweils Anderen erbracht werden. Darunter fallen vor al-
lem Kauf-, Tausch- oder auch Werkverträge. 47 Der Meinungsstreit,
ob Softwareverträge miet- bzw. pachtähnlich oder doch als Kauf-
/Werkvertrag zu qualifizieren sind (siehe Kapitel 3.3), spielt an die-
ser Stelle keine Rolle, da bei jedem dieser Verträge ein gegenseitiges
Rechtsverhältnis vorliegt.
Fraglich ist allerdings, ob ein do-ut-des Verhältnis auch bei Open
Source Verträgen gegeben ist. Eines der wesentlichen Kriterien der
Open Source Software ist gerade die Besonderheit, dass keine Li-
zenzgebühren anfallen. Sie ist damit kostenlos für den Lizenzneh-
45
Andres, in: Andres/Leithaus, § 103 Rn. 2; Gottwald/Huber, InsolvenzR-Hb,
§ 35 Rn. 20; MüKo/Kreft, § 103 Rn. 39, 41.
46
Metzger/Barudi, CR 2009, 557, 559; MüKo/Kreft, § 103 Rn. 19.
47
Braun/Kroth, § 103 Rn. 6, 8; Gottwald/Huber, InsolvenzR-Hb, § 34 Rn. 14;
MüKo/Huber, § 103 Rn. 55.
204 Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen
mer nutzbar. Eine äquivalente Gegenleistung fehlt hingegen. Zwar
hat auch der Lizenznehmer (Neben-)Pflichten aus den Lizenzbe-
stimmungen, wie z.B. die Namensnennung der Urheber oder die
Beibehaltung von Copyright-Vermerken. Sie stehen jedoch nicht im
Synallagma. Kosten können allenfalls z.B. beim Nutzen eines Sup-
portservices oder dem Erwerb eines Handbuches anfallen. Der Open
Source Lizenzvertrag selbst enthält hingegen eher schenkungsrecht-
liche Elemente.48 Die Schenkung (§ 516 BGB) als nur einseitig ver-
pflichtender Vertrag, fällt nach herrschender Meinung nicht in den
Anwendungsbereich des § 103 InsO.49 Im Ergebnis kann daher fest-
gehalten werden, dass ein Open Source Vertrag nicht die Voraus-
setzung eines gegenseitigen Rechtsverhältnisses erfüllt.
4.1.2 Erfüllung des Vertragsverhältnisses
Selbst wenn man ein synallagmatisches Rechtsverhältnis annehmen
würde, so wäre darüber hinaus problematisch, ob das Vertragsver-
hältnis nicht bereits mit Einräumung der Nutzungsrechte erfüllt ist.
§ 103 InsO verlangt, dass der Vertrag zum Zeitpunkt der Verfah-
renseröffnung noch nicht vollständig erfüllt worden ist. Sobald auch
nur eine Partei ihrer Leistungsverpflichtung dem Vertrag entspre-
chend vollständig nachgekommen ist, ist § 103 InsO nicht anwend-
bar. Allerdings müssen auch die Nebenpflichten vollständig erfüllt
worden sein. Wie auch im Rahmen des § 362 BGB tritt hier die
Erfüllung mit Eintritt des Leistungserfolges ein, nicht bei Vornah-
me der Leistungshandlung.50 Das auch die Nebenpflichten erfüllt
sein sollen, ergibt sich aus der teleologischen und systematischen
Auslegung der Zurückbehaltungsrechte innerhalb eines Vertragsver-
hältnisses. § 17 KO sah vor, dass der Insolvenzverwalter gleich dem
Gemeinschuldner die Leistung erbringen solle. Die geforderte Erfül-
lung der Leistung könne dann abgelehnt werden, wenn die Gegen-
leistung nicht erbracht werden würde. Der Gesetzgeber sah damit
in gegenseitigen Verträgen vor, dass die allgemeinen Sicherungen
nicht durch den Konkurs berührt werden sollten. Wollte der Verwal-
48
Auer-Reinsdorff, ITRB 2009, 69; Tintelnot, in: Kübler/Prütting/Bork, § 103
Rn. 63; Jaeger/Metzger, Open Source Software, Rn. 170d; Metzger/Barudi,
CR 2009, 557, 560.
49
Andres, in: Andres/Leithaus, § 103 Rn. 7; Braun/Kroth, § 103 Rn. 13; Mü-
Ko/Huber, § 103 Rn. 91.
50
LG München I, ZUM-RD 2007, 498, 502; Braun/Kroth, § 103 Rn. 19 f.;
MüKo/Huber; § 103 Rn. 122 f.
214 Die Insolvenzfestigkeit von Open Source Lizenzen
ter die Erfüllung der Nebenpflichten bezwecken, so musste er diese
ebenfalls erfüllen. Auch der Grundgedanke von § 103 InsO sieht
vor, dass der Insolvenzverwalter die Möglichkeit der vollständigen
Abwicklung gegenseitiger Verträge haben soll. Dazu zählen neben
den Hauptleistungspflichten eben auch die Nebenpflichten.51 Bei
proprietären Softwarelizenzverträgen hängt der Zeitpunkt der Er-
füllung von der Qualifikation als Kaufvertrag oder miet-bzw. pacht-
ähnliches Dauerschuldverhältnis ab. Wie bereits in Kapitel 3.3 dar-
gestellt, wird einerseits vertreten, dass Softwareverträge mit einer
Einmalzahlung als Kaufverträge zu qualifizieren sind. Mit Zahlung
des Betrages und Einräumung der Lizenznutzung wäre der Vertrag
dann bereits beidseitig erfüllt. Die herrschende Meinung qualifiziert
hingegen den Softwarevertrag als Dauernutzungsvertrag und sieht
damit eine Ähnlichkeit zur Miete oder Pacht. Der Vertrag ist hier
erst mit Vertragsbeendigung vollständig erfüllt. Dieser Meinung fol-
gend wird ein Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO
zumindest bei proprietären Softwarelizenzverträgen befürwortet.
Ist ein Open Source Vertrag ebenfalls als Dauerschuldverhält-
nis zu qualifizieren? Zunächst kann die Pflicht des Lizenznehmers,
bestimmte Lizenzbestimmungen einzuhalten, an ein Dauerschuld-
verhältnis erinnern. Das eingeräumte Nutzungsrecht wird dabei als
auflösend bedingt betrachtet. Unter einer auflösenden Bedingung
versteht man nach § 158 II BGB, dass das Rechtsgeschäft mit Ein-
tritt einer Bedingung endet. Verstößt der Lizenznehmer gegen die
Lizenzbestimmungen, so entfallen automatisch die Rechte unter der
Lizenz mit dinglicher Wirkung ex nunc. Dem Nutzer ist damit auch
die Weitergabe des Open Source Programms untersagt. Nur bereits
eingeräumte Lizenzen bleiben gemäß Nr. 8 GPLv352 davon unbe-
rührt. Ein Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen würde z.B. die
Weitergabe einer Kopie ohne Beifügung der GPL darstellen. Beim
automatischen Wegfall aller Rechte werden nach Nr. 8 GPLv3 we-
der die Nutzungsrechte eingeräumt, noch wird ein Vertrag erfolg-
reich abgeschlossen. Dem rechtmäßigen Erwerber stehen allerdings
als einfacher Nutzer die in § 69d UrhG vorgesehen gesetzlichen Min-
destrechte zu.53
51
Wallner, ZIP 2004, 2073, 2076.
52
GNU, General Public License Version 3,
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html [Zugriff am 02.06.2014].
53
Dreier, in: Dreier/Schulze, § 69c Rn. 38; Wiebe, in: Spindler/Schuster, § 69c
Rn. 38 f.
22Sie können auch lesen