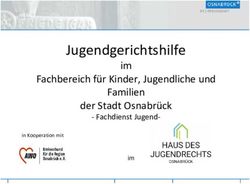Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück - Teil B: Klimaanpassungsstrategie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Konzept zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels der
Stadt Osnabrück
Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der
Stadt Osnabrück
Teil B: Klimaanpassungsstrategie
Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Fachdienst Umweltplanung
Erstellt von:
GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover
Förderung:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
Förderkennzeichen 03K02771
Veröffentlichung:
August 2017
IKonzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS .................................................................................................................................
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ................................................................................................................... III
TABELLENVERZEICHNIS ......................................................................................................................... IV
1. DAS OSNABRÜCKER KONZEPT ZUR ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL .................... 1
1.1 Hintergrund .................................................................................................................................................... 1
1.2 Projektziele und -ablauf .................................................................................................................................. 2
1.3 Beteiligungsprozess ........................................................................................................................................ 3
1.3.1 1. und 2. AG-Sitzung .......................................................................................................................................... 4
1.3.2 Multiplikatorenworkshop zur Maßnahmenentwicklung ................................................................................... 4
1.3.3 Fachaustausch mit den Umlandgemeinden ...................................................................................................... 5
1.3.4 3. AG-Sitzung ..................................................................................................................................................... 7
1.3.5 Bürgerinformationsveranstaltung Stadtklima und Klimaanpassung ................................................................. 7
1.3.6 Zeitungsberichte ................................................................................................................................................ 8
2. BETROFFENHEITEN ........................................................................................................................... 9
2.1 Bisherige Erfahrungen mit klimatischen Extremereignissen ........................................................................... 9
2.2 Funktionale Betroffenheiten ........................................................................................................................ 10
2.2.1 Vorgehensweise .............................................................................................................................................. 11
2.2.2 Ergebnisse........................................................................................................................................................ 11
2.3 Schlussfolgerungen ....................................................................................................................................... 12
3. SCHWERPUNKTTHEMA STADTKLIMAWANDEL ................................................................... 13
3.1 ENVELOPE-Methode ..................................................................................................................................... 13
3.2 Eingangsdaten .............................................................................................................................................. 17
3.2.1 Geodaten ......................................................................................................................................................... 17
3.2.2 Klimadaten ....................................................................................................................................................... 17
IKonzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
3.3 Ergebnisse .................................................................................................................................................... 20
3.3.1 Betrachtete Parameter .................................................................................................................................... 20
3.3.2 Methodik ......................................................................................................................................................... 20
3.3.3 Räumliche und strukturspezifische Entwicklung der thermischen Belastung im Raum Osnabrück................ 22
3.3.4 Wachsende Hot-Spots ..................................................................................................................................... 25
3.3.5 Fazit ................................................................................................................................................................. 26
4. GESAMTSTRATEGIE ZUR KLIMAANPASSUNG ........................................................................ 29
4.1 Maßnahmenkatalog ..................................................................................................................................... 29
4.1.1 Aktionsplan Stadtklima(wandel) ...................................................................................................................... 29
4.1.2 Schlüsselmaßnahmen zur Klimaanpassung ..................................................................................................... 35
4.2 Verstetigungsstrategie .................................................................................................................................. 36
4.2.1 Ansiedlung in der Verwaltung und dauerhafte Implementation .................................................................... 36
4.2.2 Interne und externe Vernetzung ..................................................................................................................... 38
4.2.3 Wertschöpfung durch Klimaanpassung ........................................................................................................... 39
4.3 Controlling-Konzept ...................................................................................................................................... 41
4.3.1 Grundsätzliche Struktur des Controllings ........................................................................................................ 41
4.3.1 Baustein Monitoring Klimawandel .................................................................................................................. 42
4.3.2 Baustein Schlüsselmaßnahmen-Evaluierung ................................................................................................... 43
4.4 Strategie zur Kommunikation des Anpassungskonzeptes in die Stadtgesellschaft ........................................ 44
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK ....................................................................................... 46
QUELLENVERZEICHNIS .......................................................................................................................... 48
ANHANG ...................................................................................................................................................... 50
Anhang A: Auswirkungen des Klimawandels ............................................................................................................. 50
Anhang B: Steckbriefe Extremereignisse ................................................................................................................... 57
Anhang C: Wirkungsketten ........................................................................................................................................ 61
Anhang D: Fragebogen Betroffenheiten .................................................................................................................... 62
Anhang E: Steckbriefe Schlüsselmassnahmen ........................................................................................................... 64
IIKonzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Schematischer Projektablauf .................................................................................................................................. 3
Abb. 2: Fachaustausch mit den Umlandgemeinden ............................................................................................................ 6
Abb. 3: Bürgerinformationsveranstaltung .......................................................................................................................... 7
Abb. 4: Berichterstattung über das Projekt in den lokalen Medien .................................................................................... 8
Abb. 5: Ausschnitt aus dem Steckbrief des Extremwetterereignisses „Hitze“ ..................................................................... 9
Abb. 6: Für die Stadt Osnabrück identifizierte Handlungsfelder ....................................................................................... 11
Abb. 7: Downscaling globaler Klimaprojektionen über die regionale Skala bis hin zur lokalen Skala ............................... 14
Abb. 8: Exemplarische Häufigkeitsverteilungen von Temperatur, Windgeschwindigkeit und relativer Feuchte .............. 15
Abb. 9: Begrenzungsraum für die ausgesuchten Wettersituationen ................................................................................ 15
Abb. 10: Exemplarische Verteilung der 14 Uhr-Situationen im Zustandsraum ................................................................. 15
Abb. 11: Schema zur Berechnung der meteorologischen Variablen für einzelne Wettersituationen aus den Ergebnissen
der acht Basis-Simulationen ................................................................................................................................ 16
Abb. 12: Anthropogener Strahlungsantrieb (RF) verschiedener IPCC-Klimaszenarien ...................................................... 18
Abb. 13: Lage der aus dem Modellgitter ausgewählten Gitterpunkte .............................................................................. 21
Abb. 14: Mittlere jährliche Anzahl an Tropennächten in der Referenzperiode und den Zukunftsperioden ...................... 23
Abb. 15: Mittlere jährliche Anzahl an Tropennächten in der Referenzperiode und deren Zunahme in den
Zukunftsperioden in Abhängigkeit von der Flächennutzung ............................................................................... 23
Abb. 16: Mittlere jährliche Anzahl an PET-Überschreitungstagen in der Referenzperiode und den Zukunftsperioden .... 24
Abb. 17: Mittlere jährliche Anzahl an PET-Überschreitungstagen in der Referenzperiode und deren Zunahme in den
Zukunftsperioden in Abhängigkeit von der Flächennutzung ............................................................................... 24
Abb. 18: Planungshinweise Themenkarte Klimawandel: Belastung in der Nacht (Tropennächte) ................................... 27
Abb. 19: Planungshinweise Themenkarte Klimawandel: Belastung am Tag (PET-Überschreitungstage) ........................ 28
Abb. 20: Beispielhafte Ableitung von Maßnahmen für eine Fläche .................................................................................. 31
Abb. 21 Organigramm der Stadt Osnabrück ..................................................................................................................... 37
Abb. 22: Mitglieder AG-Klimaanpassung .......................................................................................................................... 39
Abb. 23: Beispiel der Klimawandelauswirkungen auf die Wertschöpfung von Unternehmen .......................................... 40
Abb. 24: Zentrale Bausteine für den regelmäßigen Fortschrittsbericht ............................................................................ 42
Abb. 25: Schema zur Evaluation der Schlüsselmaßnahmen .............................................................................................. 42
IIIKonzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Mitglieder des für die Osnabrücker Modellrechnung zusammengestellten Ensembles der Modellsimulationen
der EURO-CORDEX Initiative ............................................................................................................................... 19
Tabelle 2: Anteil der durch den Klimawandel belasteten Siedlungs-/Gewerbeflächen ..................................................... 25
Tabelle 3: Empfehlungen raumeinheitenspezifischer stadtklimatisch wirksamer Maßnahmen für die Stadt Osnabrück 32
Tabelle 4: Übersicht Schlüsselmaßnahmen ....................................................................................................................... 35
Tabelle 5: Vorschlag eines Indikatorensets für das Klimawandel-Monitoring .................................................................. 41
Tabelle 6: Vorschlag eines Indikatorensets für die Erfassung der Folgen des Klimawandels ............................................ 43
Tabelle 7: Lokale Informationsmedien .............................................................................................................................. 44
Tabelle 8: Mögliche Informationsveranstaltungen ........................................................................................................... 45
IVKonzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
1. Das Osnabrücker Konzept zur Anpassung an
den Klimawandel
1.1 HINTERGRUND
Spätestens durch die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro und der dort verabschiedeten Klimarahmenkonvention ist der Klimawandel von der globalen bis
hinunter zur regionalen Ebene als eine der größten Herausforderungen der Zukunft anerkannt worden
(Vereinte Nationen 1992). Die Veränderung des Weltklimas und die Auswirkungen eines weltweiten Klima-
wandels werden seitdem durch das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, „Weltklimarat”) in
regelmäßigen Sachstandsberichten dokumentiert und öffentlichkeitswirksam diskutiert.
Angesichts der Aussagen des 5. Sachstandsberichtes (IPCC 2014a), global ansteigender CO2-Emmissionen
und zäher Verhandlungen der Weltgemeinschaft zu einem Post-Kyoto Abkommen, ist davon auszugehen,
dass die Klimafolgenanpassung im Laufe der kommenden Jahrzehnte noch weiter an Bedeutung gewinnen
wird. Daher hat die Europäische Union ihre Mitgliedsstaaten im Rahmen einer Klimafolgenanpassungsstra-
tegie zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen aufgefordert (EU-Kommission 2007, 2009, 2013). Zur Beglei-
tung der Umsetzung der Strategie auf kommunaler Ebene wurde der “Covenant of Mayors for Climate and
Energy“ als Netzwerk zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch ins Leben gerufen1.
Der Aufforderung der EU sind mittlerweile viele europäische Staaten gefolgt und haben nationale Anpas-
sungsstrategien auf den Weg gebracht. Der deutsche Anpassungsprozess wird vom Umweltbundesamt
bzw. vom dortigen „Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung (KomPass)“ im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gesteuert. Die Bundesrepublik
gehört mit der 2008 verabschiedeten „Deutschen Anpassungsstrategie an die Folgen des Klimawandels
(DAS)“ (Bundesregierung 2008) sowie dem „Aktionsplan Anpassung I + II“ (Bundesregierung 2011, 2015) zu
den Vorreitern des Kontinents. Die DAS und der Aktionsplan werden regelmäßig evaluiert und fortgeschrie-
ben (UBA 2015a). Für die kommunale Ebene ist vor allem die Studie „Vulnerabilität Deutschlands gegen-
über dem Klimawandel“ von besonderer Relevanz (UBA 2015b). Dort sind methodische Standards gesetzt
sowie, in Abhängigkeit vom Naturraum, klimasensible Handlungsfelder identifiziert, operationalisiert und
hinsichtlich ihrer Vulnerabilität bewertet worden.
Der initiierte Anpassungsprozess hat darüber hinaus bereits in einigen normativen Regelungen seinen Nie-
derschlag gefunden (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien). Für die nachhaltige, klimagerechte Stadtentwick-
lung ist in diesem Zusammenhang vor allem die Klimanovelle des BauGB von 2011/2013 von Bedeutung.
Seither sind Klimaschutz und Klimaanpassung als Grundsätze der Bauleitplanung verankert. Ergänzend dazu
wird gemäß EU-Richtlinie das „Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung“ zeitnah zu ändern sein.
Zukünftig wird dann in den Umweltberichten zu Umweltverträglichkeitsprüfungs- bzw. Strategischen Um-
weltprüfungspflichtigen Vorhaben auch auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels auf die Projekte
bzw. Pläne einzugehen sein.
1
Nähere Informationen unter www.covenantofmayors.eu
1Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
1.2 PROJEKTZIELE UND -ABLAUF
Auf allen skizzierten politischen Ebenen wird den Kommunen und den mit ihr verbundenen Stadtgesell-
schaften eine zentrale Rolle im Anpassungsprozess an die Folgen des Klimawandels zugeschrieben. Auch
von Verbandsseite wird diese Rollenzuweisung unterstützt (Deutscher Städtetag 2012). Dies liegt vor allem
darin begründet, dass sich der Klimawandel aufgrund inhomogener Vulnerabilitäten kleinräumig unter-
schiedlich auswirken wird und es daher den lokalen Verhältnissen angepasster Reaktionen bedarf. In der
Deutschen Anpassungsstrategie heißt es hierzu:
“Da Anpassung in den meisten Fällen auf regionaler oder lokaler Ebene erfolgen muss, sind viele Ent-
scheidungen auf kommunaler oder Kreisebene zu treffen“ (Bundesregierung 2008).
Die Stadt Osnabrück hat sich schon sehr früh den Herausforderungen des kommunalen Klimaschutzes ge-
stellt und sich bereits im Jahr 1993 mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis e.V. verpflichtet, ihre Treibhaus-
gasemissionen zu senken. Um den kommunalen Klimaschutz weiter voranzutreiben, hat die Stadt im Jahr
2008 ein Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen und bildet seit 2012 mit dem Kreis Steinfurt, der Stadt Rhei-
ne und dem Landkreis Osnabrück eine „Masterplanregion 100 % Klimaschutz“. Auf dieser Basis sind in den
letzten drei Jahrzehnten bereits eine Vielzahl von Maßnahmen zur CO2 Reduzierung umgesetzt worden.
Parallel zum Mitigationsprozess soll zukünftig die Klimafolgenanpassung (Adaption) in Osnabrück vorange-
trieben werden. Denn der globale Klimawandel ist auch in Osnabrück messtechnisch nachweisbar und ein-
zelne Extremereignisse haben bereits Auswirkungen gezeigt (vgl. Kap. 2.1). So ist in den letzten 60 Jahren
nicht nur die Jahresdurchschnittstemperatur in Osnabrück um über 1 °C gestiegen, auch die Tage mit ext-
rem hohen Temperaturen im Sommer nehmen nachweislich zu und die Winter weisen weniger Frosttage
sowie Tage mit extremen Minustemperaturen auf (vgl. Stadt Osnabrück 2017).
Diese Entwicklung ist vor allem für den Erhalt eines gesunden Osnabrücker Stadtklimas von Relevanz, da
einzelne Stadtstrukturen sehr sensibel auf eine Temperaturerhöhung reagieren und es zu gesundheitlichen
Belastungen kommen kann. Die dynamische Stadtentwicklung nach innen und außen kann diese Problem-
lage zusätzlich verschärfen. Die Verwaltung der Stadt Osnabrück ist daher bereits seit den 1980er Jahren im
Themenfeld Stadtklima aktiv und hat diese Historie 2016/2017 mit der Aktualisierung der Stadtklimaanaly-
se von 1996 fortgeführt (Stadt Osnabrück 1998). Klimaanpassungsmaßnahmen wurden bisher allerdings
lediglich vereinzelt umgesetzt und waren nicht Teil eines ganzheitlichen strategischen Ansatzes (z. B. Ent-
siegelungen von Straßen und Plätzen, Dachbegrünung als Bauauflage für Nichtwohngebäude ab einer be-
stimmten Größe, Ergänzung der städtischen Bepflanzungsstrategie um hitze- und trockenresistente Pflan-
zen, Offenlegung der Teilverrohrung des Flusses Hase als großes Fließgewässer in Osnabrück, Freihaltung
der Frischluftschneisen von Bebauung).
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Osnabrück, u. a. mithilfe von Fördermitteln aus der Nationalen Kli-
maschutzinitiative (NKI) des Bundes, im Jahr 2016 die GEO-NET Umweltconsulting GmbH mit der Erstellung
eines Anpassungskonzeptes an die Folgen des Klimawandels, inklusive der dafür notwendigen Aktualisie-
rung des Stadtklimagutachtens für die Stadt Osnabrück, beauftragt und parallel dazu die projektbegleiten-
de verwaltungsinterne Arbeitsgruppe Klimaanpassung ins Leben gerufen.
Die übergeordneten Projektziele lehnen sich an die „Strategischen Ziele der Stadt Osnabrück 2016-2020“
(Stadt Osnabrück 2015) an und lauten im Einzelnen:
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Resilienz gegenüber Klimafolgen,
Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität durch frühzeitige Berücksichtigung kli-
matischer Veränderungen,
langfristiger Erhalt der Standortattraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und guter Arbeitsbedingungen.
2Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Abb. 1: Schematischer Projektablauf
Die in den drei Zielkategorien bereits existierenden Informationen und Maßnahmen sollten in einem betei-
ligungsorientierten Prozess durch weitere Planungs- und Entscheidungsgrundlagen ergänzt und in einem
Konzept zusammengefasst werden. Zur inhaltlichen Operationalisierung der Ziele sollte im Rahmen des 12-
monatigen Projektes auch die gesamtstädtische Stadtklimaanalyse aus dem Jahr 1996 erneuert werden.
Der vorliegende Bericht fußt auf den Ergebnissen der mess- und modellgestützten aktualisierten Stadt-
klimaanalyse, die in einem separaten, der Öffentlichkeit zugänglichen Dokument publiziert wurde (Stadt
Osnabrück 2017).
Das Projekt ist gemäß „Merkblatt Erstellung von Klimaschutzteilkonzepten“ in acht Arbeitspakete gegliedert
(BMUB 2014; Abb. 1). Die Kernelemente bilden die räumlich-funktionale Betroffenheitsanalyse (Kap. 1.3.6
und insb. 3) sowie die Gesamtstrategie mit dem Maßnahmenkatalog (Kap. 4).
1.3 BETEILIGUNGSPROZESS
Um eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes zu gewährleisten, wurden die für die loka-
len Handlungsfelder der Deutschen Anpassungsstrategie relevanten Akteurinnen und Akteure intensiv in
die Konzepterstellung einbezogen und eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe eingerichtet, die folgende
Aufgabenbereiche abdeckt:
Umweltplanung (68-1)
Ordnungsbehördlicher Umweltschutz (68-2)
Naturschutz und Landschaftsplanung (68-3)
3Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Verkehrsplanung (61-4)
Bauleitplanung/Stadtplanung (61-5)
Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)
Gesundheitsdienst
Katastrophenschutz
Stadtwerke Osnabrück AG
Zur Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes wurden folgende sechs Veranstaltungen durchgeführt, in
denen sich die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe sowie die Öffentlichkeit in die Erstellung einbringen und
sich über dessen Fortschritt informieren konnten:
Drei verwaltungsinterne Arbeitsgruppen (AG)-Sitzungen
Multiplikatorenworkshop zur Maßnahmenentwicklung
Fachaustausch mit den Umlandgemeinden
Bürgerinformationsveranstaltung Stadtklima und Klimaanpassung
Zusätzlich wurden die politischen Entscheidungsträger in zwei öffentlichen Ausschusssitzungen über den
Projektverlauf und dessen Endergebnisse informiert.
1.3.1 1. UND 2. AG-SITZUNG
Die 1. AG-Sitzung (17.06.2016) diente neben der Vorstellung allgemeiner Informationen zu den Zielen und
Ablauf des Projekts, vor allem dazu, die Erwartungen der Teilnehmenden an das Projekt sowie an den An-
passungsprozess (auch über das Projekt hinaus) zu erfragen und zu diskutieren, damit diese im weiteren
Projektverlauf berücksichtigt werden konnten. Zur Veranschaulichung der Auswirkungen von Extremwet-
terereignissen wurden vier Beispiele der jüngeren Vergangenheit präsentiert (Sturm, Hitze, Starkregen,
Schneesturm) und in Hinblick auf die lokalen Betroffenheiten die Wirkungsketten verschiedener meteoro-
logischer Einflüsse erläutert (Temperaturzunahme und Hitze, Niederschlagsverschiebung und Trockenheit,
Starkniederschläge und Gewitterstürme), wobei sich das Projekt vornehmlich auf die Wirkungskette „Tem-
peraturzunahme und Hitze“ konzentrieren wird. Im Nachgang füllten die Teilnehmenden einen Fragebogen
zu den Betroffenheiten ihres eigenen Arbeitsbereichs durch den Klimawandel aus (vgl. Kapitel 1.3.6).
Die Auswertung der Befragung zu lokalen Betroffenheiten wurde in der 2. AG-Sitzung (25.10.2016) vorge-
stellt und diskutiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse ist die Entwicklung konkreter Maßnahmen im Rah-
men des Multiplikatorenworkshops erfolgt. Weiterhin wurden die Ergebnisse der im Sommer 2016 durch-
geführten Messkampagne sowie der modellierten Stadtklimaanalyse präsentiert (vgl. Stadt Osnab-
rück 2017) und die Rahmenbedingungen für die anstehende räumlich hochaufgelöste Analyse des Osnab-
rücker Stadtklimawandels besprochen (u. a. welche Zukunftsperioden betrachtet werden sollten; Kap. 3).
1.3.2 MULTIPLIKATORENWORKSHOP ZUR MAßNAHMENENTWICKLUNG
Der Multiplikatorenworkshop (12.12.2016) bot neben der verwaltungsinternen AG weiteren Akteurinnen
und Akteuren aus Politik, Stadtgesellschaft und öffentlichen Einrichtungen die Gelegenheit, Einblicke in das
Projekt zu bekommen und insb. an der Entwicklung lokaler Maßnahmen mitzuwirken. Eingeladen waren u.
a. Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen, aus privaten und öffentlichen Einrichtungen des Gesund-
heitssektors, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Katastrophenschutz, Wirtschaft, Immobilienwirt-
schaft, Bildung und Forschung sowie der Lokalen Agenda 21.
4Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Die zu Projektbeginn durchgeführte Betroffenheitsanalyse hat eine Sammlung bereits laufender bzw. ge-
planter sowie für Osnabrück als benötigt erachteter Maßnahmen zur Klimaanpassung ergeben, die durch
eine Literaturrecherche ergänzt wurde. Anhand dieser Sammlung wurden im Vorfeld des Workshops vier
Handlungsfelder identifiziert, denen die Maßnahmen jeweils zugeordnet wurden:
Erhalt und Verbesserung des thermischen Komforts sowie Schutz vor extremen Belastungen (Hitze-
stress, Luftschadstoffe) im Außen- und Innenraum (Gebäude, Straßen, Plätze, ÖPNV)
Erhalt bzw. Ausweitung von Stadt- und Privatgrün (Schutz gegenüber Hitze, Trockenstress und kli-
mabedingten Krankheiten)
Planerische und politische Entscheidungsprozesse (Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Verkehrs-
planung, politische Beschlüsse, Finanzierung)
Sicherung einer hohen (Trink-)Wasserqualität, Starkregenvorsorge und (dezentrale) Stadtentwässe-
rung
Dieses Zwischenergebnis stellte die Diskussionsgrundlage dar. Im Plenum wurden die bisherigen Maßnah-
men anhand von fünf Leitfragen ergänzt, aktualisiert, deren Umsatzbarkeit für die Stadt Osnabrück disku-
tiert und eine Einteilung in verschiedene Kategorien vorgenommen. Das Ergebnis berücksichtigt den Pla-
nungsstand der einzelnen Maßnahmen und dient als Grundlage zur Ableitung bestimmter Schlüsselmaß-
nahmen. An folgenden Leitfragen hat sich die Diskussion orientiert:
Wo besteht noch Bedarf an weiterführenden Untersuchungen?
Welche organisatorischen Voraussetzungen sind notwendig (Zuständigkeiten, Budgets, etc.)?
Welche Verfahren und Prozessabläufe müssen angepasst werden?
Wo bedarf es einer weiteren Sensibilisierung von Akteuren und der Öffentlichkeit?
Welche baulich-räumlichen bzw. ökologischen Maßnahmen sind denkbar und zielführend?
1.3.3 FACHAUSTAUSCH MIT DEN UMLANDGEMEINDEN
Bildlich gesprochen macht das Stadtklima nicht an den Stadtgrenzen Osnabrücks Halt, sondern Auswirkun-
gen bestehender bzw. geplanter Bebauungen können sich in beide Richtungen ergeben. Aus diesem Grund
wurden Vertreterinnen und Vertreter der an die Stadt Osnabrück angrenzenden Gemeinden sowie des
Landkreises (LK) Osnabrück im Rahmen eines Fachaustauschs (14.03.2017) die Ergebnisse der Stadtklima-
analyse vorgestellt.
Die aktualisierte Stadtklimaanalyse und die daraus entstandene Planungshinweiskarte konzentriert sich auf
das Stadtgebiet Osnabrücks. Um das Prozessgeschehen innerhalb der Stadtgrenzen korrekt abzubilden,
wurde für die Modellierung des Stadtklimas ein rechteckiges Untersuchungsgebiet ausgewählt, das einige
Teile der angrenzenden Gemeinden einschließt. Die Ergebnisse des gesamten Untersuchungsgebiets finden
Berücksichtigung in der Klimaanalysekarte (vgl. Stadt Osnabrück 2017). Soweit möglich wurden bestimmte
Effekte wie der Kaltluftvolumenstrom, die nächtliche Überwärmung in Siedlungsflächen sowie Auswirkun-
gen des Klimawandels auch außerhalb des Stadtgebiets dargestellt2, sodass diese Ergebnisse für den Fach-
austausch mit den Umlandgemeinden genutzt werden konnten.
Anhand folgender vier Leitfragen wurde erörtert, wie die Ergebnisse einzuordnen sind und welche Konse-
quenzen sich daraus für die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen der Stadt Osnabrück, den angren-
zenden Gemeinden und dem LK Osnabrück ergeben.
2
Außerhalb des Stadtgebiets weisen die Eingangsdaten eine geringere räumliche Auflösung auf, sodass die Detailgenauigkeit der
Ergebnisse entsprechend geringer ist und nicht alle in der Klimaanalysekarte dargestellten Effekte für den Außenbereich über-
nommen werden konnten.
5Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Gibt es vergleichbare Projekte bzw. Ansätze in Ihrer Gemeinde bzw. dem Landkreis Osnabrück?
Wo sehen Sie Schnittstellen des Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Osnabrück zu den Aufga-
ben Ihrer Gemeinde bzw. des Landkreises Osnabrück?
Halten Sie es für sinnvoll das Thema Klimaanpassung intensiver zu berücksichtigen?
Soll ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch stattfinden?
Dabei wurde deutlich, dass die Umlandgemeinden und der Landkreis Osnabrück in Bezug auf Klimaschutz
sehr aktiv sind, Maßnahmen zur Klimaanpassung bislang jedoch weniger im Vordergrund stehen. Im Rah-
men seines Freiraumkonzepts hat der LK Osnabrück die Ergebnisse der vorangegangenen Stadtklimaanaly-
se Osnabrücks aufgegriffen (Klimaschutzflächen) und in Zukunft soll Klimaanpassung in der Bauleitplanung
des LK Osnabrück stärker Berücksichtigung finden. Der LK Osnabrück aktualisiert in den nächsten Jahren
sein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP). In dieses sollen die Ergebnisse des KlAK Osnabrück ein-
fließen.
Die teilnehmenden Gemeinden zeigten großes Interesse an den Ergebnissen des Klimaanpassungskonzep-
tes der Stadt Osnabrück, insb. an der Frage, welche Maßnahmen des für die Stadt entwickelten Maßnah-
menkatalogs sich auf die Umlandgemeinden übertragen ließen. Außerdem wurde die mikroskalige Unter-
suchung eines Vertiefungsgebiets am Stadtrand als sinnvoll erachtet, die beispielhaft die Auswirkungen
potentieller Bebauung im Stadt-/Umlandbereich aufzeigt und aus dessen Ergebnissen Maßnahmen abgelei-
tet werden können. Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen und im Rahmen des Projekts umgesetzt (vgl.
Kap. 9.4 der Stadtklimaanalyse Osnabrück; Stadt Osnabrück 2017).
Auch über das Projektende hinaus wird von allen Seiten ein weiterer Erfahrungsaustausch befürwortet. Um
diesen einzuleiten, lädt die Stadt Osnabrück nach Vorliegen aller Ergebnisse des Klimaanpassungskonzeptes
zu einem weiteren Fachaustausch ein.
Abb. 2: Fachaustausch mit den Umlandgemeinden (Foto: Löbig, GEO-NET)
6Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
1.3.4 3. AG-SITZUNG (26.04.2017)
Ziel der 3. AG-Sitzung war die Festlegung von aus dem Anpassungsprozess entwickelten, auf die Stadt Osn-
abrück bezogenen Schlüsselmaßnahmen. Diese sind dabei wie folgt definiert: „Schlüsselmaßnahmen sind
solche Maßnahmen (oder Maßnahmencluster), die für die Umsetzung des Osnabrücker Anpassungskonzep-
tes als besonders zielführend angesehen werden. Es handelt sich um solche Maßnahmen, die aus Gründen
der Dringlichkeit oder des Leuchtturmeffektes nach Ende des Projektes möglichst kurzfristig vorbereitet
werden sollten.“
Basierend auf den Ergebnissen des Multiplikatorenworkshops wurden im Vorfeld der AG-Sitzung verschie-
dene Schlüsselmaßnahmen herausgearbeitet, die sich einer der vier Kategorien Pilotprojekt, Anreizpro-
gramm, Kommunikation und Konzepterstellung zuordnen lassen. Die einzelnen Schlüsselmaßnahmen wur-
den beschrieben, hinsichtlich ihrer Tauglichkeit als Klimaanpassungsmaßnahme für die Stadt Osnabrück
diskutiert sowie inhaltlich angepasst bzw. die Liste an Maßnahmen ergänzt (vgl. Kap. 4.1). Jede Schlüssel-
maßnahme wird in einem kurzen, auf der AG-Sitzung abgestimmten Steckbrief erläutert. Für das Ausfüllen
dieses Steckbriefs sowie für die letztliche Umsetzung der Maßnahme wurden verantwortliche Personen
bzw. Fachbereiche festgelegt.
1.3.5 BÜRGERINFORMATIONSVERANSTALTUNG STADTKLIMA UND KLIMAANPASSUNG (13.05.2017)
Unter dem Motto „Hotspot Osnabrück: Die Bedeutung von Grün für Luft, Klima und Gesundheit“ fand eine
Bürgerinformationsveranstaltung zum Klimaanpassungskonzept der Stadt Osnabrück im Bohnenkamphaus
des Botanischen Gartens Osnabrück statt. Etwa 20 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich
über bisherige Maßnahmen und Aktivitäten der Stadt Osnabrück zur Erhaltung eines gesunden Stadtklimas
sowie die Ergebnisse des laufenden Projektes zu informieren. Nach der Diskussionsrunde wurde zum Ab-
schluss eine Führung durch den Botanischen Garten zum Thema „Klima & Pflanzen – Ausgleichsfunktionen
von Pflanzen bei Hitzestress und Luftschadstoffbelastung“ angeboten.
Abb. 3: Bürgerinformationsveranstaltung (Foto: Löbig, GEO-NET)
7Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
1.3.6 ZEITUNGSBERICHTE
Durch regelmäßige Berichterstattung in den lokalen Medien, wurde eine breite Öffentlichkeit über das
Vorhaben, den Ablauf und Stand des Projekts informiert. So wurde in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ die
zu Beginn des Projekts durchgeführte Messkampagne vorgestellt (NOZ 2016a, NOZ 2016b) und in einem
Artikel über die Bürgerinformationsveranstaltung ausführlich über die Ergebnisse des Projekts und die nun
angedachten Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel berichtet (NOZ 2017; Abb. 4).
Abb. 4: Berichterstattung über das Projekt in den lokalen Medien (links NOZ 2016a, rechts oben NOZ 2016b, rechts
unten NOZ 2017)
8Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
2. Betroffenheiten
2.1 BISHERIGE ERFAHRUNGEN MIT KLIMATISCHEN EXTREMEREIGNISSEN
Das gelegentliche Auftreten von Extremwetterereignissen ist Teil klimatischer Variabilität. Einzelne Ereig-
nisse lassen sich nicht konkret den Auswirkungen des Klimawandels zuordnen, doch kann davon ausgegan-
gen werden, dass entsprechende Extremwetterereignisse bedingt durch den Klimawandel in Zukunft häufi-
ger auftreten (IPCC 2014b). Um zu veranschaulichen, welche lokalen Auswirkungen Extremwetterereignisse
nach sich ziehen können, wurden vier Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit ausgewählt und u. a. hin-
sichtlich ihres räumlichen Schwerpunkts, des gesundheitlichen und finanziellen Schadens sowie vergleich-
barer Ereignisse im Raum Osnabrück jeweils in einem Steckbrief beschrieben (siehe Abb. 5; Anhang B).
Hitze: Hoch Michaela in 2003
Als Beispiel für eine Hitzeperiode dient der sogenannte Jahrhundertsommer im Jahr 2003, der wärmste
Sommer in Deutschland seit ca. 250 Jahren. In Osnabrück wurden 48 Sommertage (≥ 25 °C) und 15 Heiße
Tage (≥ 30 °C) gezählt. Dabei waren die Monate Juni und August mit Temperaturwerten von 2,9 °C bzw.
3,4 °C über dem langjährigen Mittel ungewöhnlich heiß. Die Hitzeperiode wurde von einer langanhaltenden
Trockenheit begleitet und hatte gesundheitliche Auswirkungen auf Teile der Bevölkerung sowie gravieren-
de Folgen für Land- und Forstwirtschaft. Vergleichbare Ereignisse waren die Hitzeperioden in den Jahren
2010 und 2015.
Abb. 5: Ausschnitt aus dem Steckbrief des Extremwetterereignisses „Hitze“ (Details siehe Anhang B)
9Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Sturm: Orkan Kyrill in 2007
Während eines Sturmtiefs am 18. und 19.01.2007 traten durch den Orkan „Kyrill“ Windböen bis zu
126 km h-1 auf. In Verbindung mit Starkregen sorgte das Sturmtief u. a. dafür, dass fünf Menschen in Osn-
abrück leicht verletzt und eine Vielzahl von Bäumen entwurzelt wurden sowie massive Sachschäden auftra-
ten. Der Bahnverkehr war zeitweise eingestellt und Feuerwehr, Polizei sowie THW mussten zu zahlreichen
Einsätzen ausrücken. Betroffen waren insb. die Stadtteile Wüste, Sutthausen, Gartlage und Schölerberg
sowie der Schlossgarten. Vergleichbare Ereignisse stellten der Orkan „Lothar“ (1999) und der Sturm „Ela“
(2014) dar.
Starkregen: Hochwasserereignis und Überschwemmung in 2010
Bedingt durch besonders ergiebige und flächendeckende Niederschläge – innerhalb von 24 Stunden fielen
128 L m-2, darunter in sechs Stunden 65 L m-2 – musste in Osnabrück am 27.08.2010 der Katastrophenalarm
ausgerufen werden. Der Pegel der Hase lag bis zu 273 cm über mittlerem Wasserstand und die Kanalisation
war innerhalb kürzester Zeit überlastet. Zahlreiche Keller und Wohnungen standen unter Wasser, sodass
ein enormer finanzieller Schaden entstand und die Rettungskräfte im Dauereinsatz waren. Es kam zu
Stromausfällen, Straßensperrungen, Einstellung des Bahnverkehrs und Schulausfällen.
Schneesturm: Sturmtief Thorsten in 2005
Am 25.11.2005 entwickelte sich ein Schneesturm, der zu Neuschneehöhen bis zu 50 cm und zum „Münster-
länder Schneechaos“ führte. Die Folgen waren Stromausfälle, Einstellung des Bahn- und Busverkehrs sowie
zeitweiser Verkehrsstillstand auf den Autobahnen. Die Rettungsleitstelle des Landkreises Osnabrück koor-
dinierte insgesamt ca. 850 Einsätze.
2.2 FUNKTIONALE BETROFFENHEITEN
Die lokalen Auswirkungen des globalen Klimawandels sind vielschichtig und betreffen eine Vielzahl von
Bereichen und Aufgabenfeldern, die auch und vor allem auf kommunaler Ebene von Relevanz sind. Die
„Empfehlung für eine niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ unter-
scheidet in sektorale und sektorübergreifende Handlungsfelder (Land NDS 2012). Diese wurden an die loka-
len Gegebenheiten der Stadt Osnabrück angepasst und münden in zwölf themenspezifischen sowie drei
querschnittsorientierten Handlungsfeldern (Abb. 6).
Die funktionale Betroffenheit der identifizierten Handlungsfelder wurde mit Hilfe von Wirkungsketten ana-
lysiert, die detailliert den Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen und daraus resultierenden
Wirkungen darstellen und die große Bandbreite der Betroffenheit verdeutlichen. Das Analyseverfahren
basiert auf dem 2012 von dem bundesweiten „Netzwerk Vulnerabilität“ für den Fortschrittsbericht der
Deutschen Anpassungsstrategie entwickelten Vorgehen und wurde für Osnabrück leicht modifiziert (adel-
phi/PRC/EURAC 2015). Im Unterschied zur Bundesebene wurden die Handlungsfelder in den Wirkungsket-
ten nicht gesondert betrachtet, sondern nach drei zuvor bestimmten Klimaveränderungen geordnet:
Temperaturzunahme und Hitze
Niederschlagsverschiebung und Trockenheit
Starkniederschläge und Gewitterstürme
Für jede dieser drei Klimaveränderungen wurden alle Handlungsfelder gemeinsam aufgeführt und analy-
siert. Dadurch konnte der Blick stärker auf die ressortübergreifende Betroffenheit und auf die Wechselwir-
kungen zwischen den Handlungsfeldern gelenkt werden (für einen beispielhaften Ausschnitt einer Wir-
kungskette siehe Abb. A 7 im Anhang).
10Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Abb. 6: Für die Stadt Osnabrück identifizierte Handlungsfelder (querschnittsorientierte Handlungsfelder sind mit ei-
nem * gekennzeichnet) und Sortierung nach ihrer Relevanz (Erläuterung im Text)
2.2.1 VORGEHENSWEISE
Um die lokalen Betroffenheiten der Stadt Osnabrück zu erfassen, wurden die 25 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe in Form eines Fragebogens über die Auswirkungen des
Klimawandels auf ihren Arbeitsbereich befragt. Darin wurde u. a. um Einschätzung gebeten, welche Hand-
lungsfelder für die Stadt Osnabrück in Hinblick auf den Klimawandel relevant, durch welche Klimawirkun-
gen die Handlungsfelder des eigenen Arbeitsbereichs in besonderem Maße betroffen (unter Zuhilfenahme
der vorgestellten Wirkungsketten) und welche Maßnahmen sowie ggf. Konzepte zur Anpassung an den
Klimawandel bereits in Umsetzung oder Vorbereitung sind bzw. für den eigenen Arbeitsbereich als not-
wendig gesehen werden (vollständiger Fragebogen im Anhang D).
Der Rücklauf lag bei 14 beantworten Fragebögen, da eine gemeinsame Beantwortung pro Dienststelle als
sinnvoll erachtet wurden. Jede betroffene Fachabteilung gab mindestens eine Rückmeldung, sodass die
Ergebnisse als repräsentativ angesehen werden können.
2.2.2 ERGEBNISSE
Aus den Ergebnissen kristallisierten sich neun Handlungsfelder heraus, die von der Mehrheit in Hinblick auf
den Klimawandel als für die Stadt Osnabrück relevant angesehen werden: Bauwesen und Immobilien,
Hochwasserschutz, Stadt- und Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen, Katastrophen- und Bevölke-
rungsschutz, Wasserwirtschaft, Biodiversität bzw. Natur- und Artenschutz, Gesundheit, Mobilität und Ver-
kehr (Abb. 6).
11Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Unter den Klimawirkungen, die diese Handlungsfelder in besonderem Maße betreffen, wurden u. a. Hitze-
stress (Gesundheit), die Gefährdung der öffentlichen und privaten Trinkwasserversorgung (Wasserwirt-
schaft), Biotop-Veränderungen bzw. der Verlust von Habitatfunktionen (Grün- und Freiflächen sowie Bio-
diversität bzw. Natur- und Artenschutz) sowie das Auftreten von Wetterextremen (Katastrophen- und Be-
völkerungsschutz) genannt. Als Konsequenz daraus werden planerische Anforderungen an nahezu alle
Fachgebiete sowie insbesondere die Notwendigkeit fachübergreifender Zusammenarbeit gesehen.
Zur Erhaltung eines gesunden Stadtklimas werden in Osnabrück bereits einige Maßnahmen umgesetzt. So
finden sich in den „Ökologische[n] Standards in der Bauleitplanung der Stadt Osnabrück“ Belange des
Stadtklimas wieder, etwa indem bei der Aufstellung von Bebauungsplänen deren Auswirkungen auf beste-
hende Frischluftentstehungsgebiete und -schneisen überprüft, Vorschriften zur Dachbegrünung von Flach-
dächern sowie flach geneigten Dächern gemacht und für größere Stellplatzanlagen die Begrünung mit
großkronigen Bäumen festgesetzt werden (Stadt Osnabrück 2017). Zur Gewährleistung einer guten Sied-
lungsdurchlüftung wurden als Folge der Stadtklimaanalyse 1996 „Klimaschutzflächen“ dargestellt, die indes
keinem rechtlichen Schutz unterstehen und in der Vergangenheit an den Rändern teilweise bereits über-
baut wurden (Stadt Osnabrück 1998). Weiterhin wurde ein Entsiegelungsprogramm initiiert, das in einzel-
nen Pilotvorhaben die Entsiegelung z. B. von Schulhöfen vorsieht, jedoch nur mit einem geringen Budget
versehen ist. Auch wird die Wuchsleistung neuer Straßenbaumarten erfasst (Stresstest Straßenbäume) –
die dazugehörige Stadtbaumliste zur Klimaanpassung ist allerdings zum Teil veraltet und berücksichtigt
nicht alle Kriterien (z. B. keine Sturmanfälligkeit). In Bezug auf den Hochwasser- bzw. Katstrophenschutz
sind ebenfalls Maßnahmen in Umsetzung, z. B. die Fortschreibung der Gesamtentwicklungsplanung für
Teileinzugsgebiete, die Schaffung bzw. Optimierung von Retentionsräumen und Renaturierung öffentlicher
Gewässer bzw. das Aufstellen von Sonderplänen für Hochwasserereignisse oder Stromausfälle sowie Be-
schaffung der dafür benötigten Ausstattung.
Diese Maßnahmen sind vorwiegend auf den Status quo ausgerichtet, deren Umsetzung sorgt aber bereits
für eine gewisse Minderung der erwarteten Auswirkungen des Klimawandels. Darüber hinaus werden ge-
zielte Klimaanpassungsmaßnahmen für die Stadt Osnabrück als notwendig angesehen, etwa in Form der
Entlastung belasteter Stadtgebiete, verbindlichen Unterschutzstellung von Klimaschutzflächen, Berücksich-
tigung von Hitzeschutz in der Planung (insb. bei Pflegeeinrichtungen), des Schutzes bzw. Erhöhung des An-
teils von Grünflächen, von Konzepten für Starkregenereignissen und (übergeordnet) der Anpassung der
gesamtstädtischen Bebauung sowie des Verkehrs an den Klimawandel.
2.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Ergebnisse der Befragung stellen die Grundlage für die Ableitung konkreter, auf die Stadt Osnabrück
bezogener Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im weiteren Projektverlauf dar (vgl. Kapitel 1.1
und 4.1.2). Eine pilothafte Umsetzung der Maßnahmen könnte z. B. in bestehenden Konzepten wie dem
„Entwicklungskonzept 2020 – Wohnen und Gewerbe“ (Fachdienst Bauleitplanung) oder der „Perspektive
Grün 2020“ (OSB) erfolgen.
Aus der Betroffenheitsanalyse hat sich ergeben, dass das Klimaanpassungskonzept seinen Schwerpunkt auf
den Stadtklima(wandel) legen soll. Mit der Aktualisierung der Stadtklimaanalyse für den Ist-Zustand sowie
der gesamtstädtischen Untersuchung zu den Auswirkungen des Klimawandels wird eine aktuelle Datenbasis
für den thermischen Wirkkomplex zur Verfügung stehen, anhand derer Maßnahmen abgeleitet werden
können. Die weiteren Handlungsfelder werden dabei durch ihre Wechselwirkungen mit dem Stadtklima
mitgedacht – perspektivisch ist die Starkregenvorsorge als zweiter Schwerpunkt des Klimaanpassungspro-
zesses der Stadt Osnabrück vorgesehen.
12Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
3. Schwerpunktthema Stadtklimawandel
3.1 ENVELOPE-METHODE
Die räumlich hochaufgelöste Analyse des Osnabrücker Stadtklimawandels erfolgt auf Basis des Methoden-
pakets ENVELOPE. Das Paket koppelt das mesoskalige Stadtklimamodell FITNAH-3D mit den aktuellsten
Ergebnissen regionaler Klimamodell-Ensemble Rechnungen und erlaubt auf diese Weise die numerische
Simulation stadtklimatisch relevanter Parameter. Diese können mithilfe eines Geographischen Informati-
onssystems (GIS) visualisiert und geostatistisch ausgewertet werden.
Entsprechend des Projektansatzes werden sich die Modellanalysen auf den thermischen Wirkungskomplex
beziehen und räumlich differenzierte Informationen zur zukünftigen Entwicklung der Auftrittshäufigkeit
ausgewählter klimatologischer Kenntage bereitstellen. Aus dem Vergleich mit den Daten für die aktuelle
Klimanormalperiode 1961-1990, kann das zu erwartende Ausmaß des Stadtklimawandels in Osnabrück
räumlich hochaufgelöst analysiert werden. Die Modellrechnungen liefern Ergebnisse in einer einheitlichen
horizontalen Auflösung für die Gesamtstadt.
Obwohl die Ergebnisse der Regionalen Klimamodelle auf einem, verglichen mit dem globalen Maßstab, sehr
feinen Rechengitter vorliegen, werden für die Abschätzung von Klimafolgen in der Regel noch detailliertere
Aussagen benötigt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund notwendig, dass regionale Klimamodelle mit
einer sehr guten räumlichen Auflösung von gegenwärtig bis zu 12,5 km dennoch nicht in der Lage sind, die
relevanten lokalen Handlungsfelder wie fein strukturierte Wälder, unterschiedliche landwirtschaftliche
Kulturen oder Städte aufzulösen und in den Klimaprojektionen ausreichend zu berücksichtigen.
Diese Aufgabe können mesoskalige und an den entsprechenden Raum angepasste Simulationsmodelle
übernehmen. Sie sind aufgrund ihrer höheren räumlichen Auflösung in der Lage, die Vielfalt und Heteroge-
nität der naturräumlichen Gliederung einer Landschaft auf die Verteilung der meteorologischen Größen zu
erfassen. Abb. 7 zeigt schematisch den verfolgten Downscaling-Ansatz ausgehend von der globalen Klima-
projektion bis hin zum Stadtklimamodell.
Mesoskalige dreidimensionale Simulationen werden dabei nicht parallel zu einem regionalen Klimamodell
ausgeführt, vielmehr erfolgt die Übertragung der regionalen Ergebnisse auf die lokale Ebene durch ein sta-
tistisch-dynamisches Verfahren. Dabei werden die größerskaligen Ergebnisse statistisch ausgewertet und
mit den Ergebnissen einer Vielzahl mesoskaliger Simulationen verknüpft. Es werden keine lokalen Klimas-
zenarienrechnungen für die nächsten Dekaden durchgeführt, sondern die Ergebnisse der regionalen
Klimamodelle „intelligent“ auf kleinere Raumeinheiten interpoliert, wobei eine Berücksichtigung der loka-
len Besonderheiten einer Landschaft mit unterschiedlicher Landnutzung und Relief erfolgt.
Ausgehend von einer definierten Fragestellung, werden die Ergebnisse der regionalen Klimaszenarienrech-
nungen ausgewertet, sodass sie als übergeordnete Eingangsdaten für das mesoskalige Modell verwendet
werden können. Beispielhaft soll das Vorgehen anhand der Fragestellungen „Wie ändert sich die Wärmebe-
lastung in Städten in Zukunft (Hitzestress)?“ bzw. „Wie viele Tage mit Hitzestress sind in Zukunft zu erwar-
ten?“ beschrieben werden.
13Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels der Stadt Osnabrück (Teil B: Klimaanpassungsstrategie)
Abb. 7: Downscaling globaler Klimaprojektionen über die regionale Skala bis hin zur lokalen Skala (Quelle: DWD 2017)
Die Wärmebelastung für den Menschen kann anhand eines Wärmehaushaltsmodells abgeschätzt werden,
bei dem der Wärmeaustausch einer „Norm-Person“ mit seiner Umgebung berechnet wird3. Als Kriterium
werden dabei Indikatoren wie die Physiologisch Äquivalente Temperatur (PET), PMV4 oder UTCI5 berechnet,
die Maßzahlen für die Komfortbedingungen des Menschen sind („Bioklima“). Die PET kann aufgrund ihrer
°C-Einheit auch von Nichtfachleuten nachvollzogen werden und hat sich in der Fachwelt zu einer Art „Qua-
si-Standard“ entwickelt, sodass die Ergebnisse aus Osnabrück mit denen anderer Städte vergleichbar sind.
In die Berechnung der PET gehen als wichtigste meteorologische Eingangsgrößen die Lufttemperatur,
Windgeschwindigkeit, relative Luftfeuchte und Strahlungstemperatur am Aufenthaltsort ein (kurz- und
langwellige Strahlung; VDI 2008). Diese Parameter unterscheiden sich innerhalb städtischer Strukturen in
weiten Grenzen. In Abhängigkeit stadtspezifischer Faktoren (z. B. Bebauungshöhe, Versiegelung, Durchgrü-
nungsgrad) und der Charakterisierung der großräumigen Wettersituation (z. B. Wind, Luftmasseneigen-
schaften), können mit Hilfe eines mesoskaligen Modells deren Verteilungen innerhalb eines urbanen Rau-
mes detailliert berechnet werden. Während die stadtspezifischen Eingangsgrößen bekannt sind bzw. für die
Zukunft vorgegeben werden müssen, werden Wetterlageninformationen aus den Ergebnissen der regiona-
len Klimamodelle abgeleitet.
Zur Beantwortung der Ausgangsfragen kann die Auswertung der regionalen Klimaszenarienrechnungen
entsprechend eingeengt werden. Regionale Klimamodelle liefern aufgrund interner Variabilität für ver-
schiedene Rechenläufe bei gleichem Emissionsszenario unterschiedliche Resultate. Um sich von den Zufäl-
ligkeiten einer bestimmten Realisierung eines regionalen Klimaszenarios zu lösen, ist es daher notwendig,
die Ergebnisse dieser Rechnungen statistisch zu analysieren und daraus die notwendigen Eingangsgrößen
für das mesoskalige Modell zu generieren. Die aus den Zeitreihen berechneten Häufigkeitsverteilungen für
3
Energiebilanzmodell für den menschlichen Wärmehaushalt bezogen auf das Temperaturempfinden einer Durchschnittsperson
(„Klima-Michel“ mit folgenden Annahmen: 1,75 m, 75 kg, 1,9 m² Körperoberfläche, etwa 35 Jahre; vgl. Jendritzky 1990).
4
Predicted Mean Vote Index
5
Universal Thermal Climate Index
14Sie können auch lesen