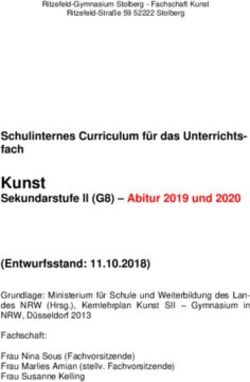Kunst Städtisches Gymnasium Ahlen Sekundarstufe II
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Städtisches Gymnasium Ahlen
Schulinternes Curriculum zum Kernlehrplan
Kunst
Sekundarstufe II
Stand: Februar 2019Städtisches Gymnasium Ahlen Kunst Curriculum Oberstufe
Inhalt
Seite
1 Rahmenbedingungen der Arbeit im Fach Kunst 3-4
2 Entscheidungen zum Unterricht 5
2.1 Unterrichtsvorhaben 6
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 7-8
2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben EF 9-14
2.1.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Q1-Q2 15-22
2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 23-26
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung 27-33
2.4 Lehr- und Lernmittel 33
2.5 Medienkonzept (Ausblick) 34-35
3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 35-36
4 Qualitätssicherung und Evaluation 36-38
5 Links 39
2Städtisches Gymnasium Ahlen Kunst Curriculum Oberstufe
1 Rahmenbedingungen der Arbeit im Fach Kunst
Der Standort des Städtischen Gymnasiums Ahlen befindet sich im städtischen Raum in
Grenznähe zum Ruhrgebiet. Die Schülerschaft ist insgesamt sehr heterogen und setzt sich aus
vielfältigen Kulturen zusammen. Die Unter- und Mittelstufe ist zurzeit dreizügig. Die gymnasiale
Oberstufe ist mit Musik- und Kunsterziehern personell so ausgestattet, dass die Stundentafel im
Fach Kunst auch in der Sekundarstufe I erfüllt werden kann. Die Unterrichtseinheiten werden
vornehmlich in Doppelstunden gehalten.
Die Schule verfügt über zwei größere verdunkelbare Kunsträume, einen 50 Jahre alten Werkraum
mit angeschlossenem Raum zur Holzbearbeitung im Keller und ist zudem mit einem Keramik-
Brennofen im Werkraum, einem Sammlungsraum neben Zeichensälen 1+2 und einem kleinen
Bibliotheks- und Lehrerarbeitsraum in Zeichensaal 1, ausgestattet. Sie hat jedoch keine
besondere Einrichtung zur Metallbearbeitung. Für Drucktechniken gibt es zwei einfache
Druckpressen (im Sammlungsraum im Erdgeschoss befindlich). Beide großen Kunsträume sind
mit einem festinstallierten Beamer sowie einem Overheadprojektor und ELMO ausgestattet, im
Werkraum gibt es einen Multimediawagen mit Beamer, Elmo und OHP.
Die Fachschaft besitzt zudem einen Farbkopierer, der sich im Sammlungsraum befindet. Des
Weiteren 1 mobilen Beamer, 3 digitale Pocket Kameras, zwei Camcorder und 2 Stative. Die
digitale Ausstattung setzt sich aus 2 Festrechnern, 2 Laptops, 2 Scannern, 2 Druckern, 15
Grafiktablets und 1 Macbook zusammen.
Durch die Lage der Schule im städtischen Raum sind Museumsbesuche in den regulären
Schulalltag fest eingebunden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, kleinere wechselnde und
aktuelle Ausstellungen im Kunstverein zu besuchen.
Die Schule legt aktuell einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich Neue Medien. Der
Kunstunterricht wird darauf schrittweise angepasst und ausgerichtet. Eine Photoshop- und
Bildbearbeitungs-AG wird seit 9 Jahren regelmäßig angeboten. Der Kunstunterricht fördert den
Bereich Neue Medien durch die Erarbeitung von Kurzfilmen und digitaler Bildbearbeitung
(Ausstattung mit PSE/PRE 7 im Informatikraum und auf den vorhandenen Geräten in den beiden
Zeichensälen sowie vereinzelten mobilen Geräten im Selbstlernzentrum).
Im neu eingerichteten zweiten PC Raum ist eine vollständige Ausstattung mit neuer
Grafiksoftware von adobe beantragt (PSE/PRE 19). Die neu eingerichteten iPad-Klassen werden
mit frei zugänglicher Grafiksoftware im Kunstunterricht arbeiten (z.B. paint, sketch, animate,
vectornator, etc.).
Die Besonderheit im Fachbereich Kunst stellt die seit über 45 Jahren bestehende
ununterbrochene Leistungskursstruktur dar, ein Angebot, dass sehr gut angenommen wird und
beliebt ist. Die Stabilität wird durch eine Kooperation mit dem kirchlichen Gymnasium St. Michael
sichergestellt.
3Städtisches Gymnasium Ahlen Kunst Curriculum Oberstufe
In der Sekundarstufe I bieten wir seit 2009 eine Frühförderung in Form von freiwilligen
Profilkursen an, die Talenten einen Rahmen zusätzlich zum regulären Unterricht bietet und früh
die Weichen für eine Leistungskurswahl legen kann. Zur besonderen Förderung des Fachs Kunst
und unter Berücksichtigung dieser seit 10 Jahren sehr erfolgreich laufenden Profilkurse im Fach
Kunst für die Klassen 5-7 wird ab dem Sommer 2019 ein eigenes Profilfach Kunst eingerichtet,
welches die freiwilligen Profilkurse ersetzt.
SchülerInnen nehmen ebenfalls regelmäßig und mit großem Erfolg an nationalen und regionalen
Wettbewerben teil, zum Beispiel dem jährlichen Förderpreis für Junge Kunst des Kunstvereins
Ahlen, dem Jugendkunstpreis der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn, dem BAS Ahlen,....
Weitere, außerunterrichtliche Angebote:
• Ausstellung von Schülerarbeiten im Schulgebäude als Kunst am Bau (Mensa, Aulabereich,
div. Fachräume, Schulhof und Schulumgebung)
• Mitmachmöglichkeiten am „Tag der offenen Tür“ (individuelle Buttons und Magnete
designen)
• Ständig wechselnde Ausstellungen aktueller Schülerarbeiten an den Wänden sowie in
Schaukästen und Vitrinen in den verschiedenen Trakten und Gängen der Schule.
• Kurs- und Klassenübergreifende Mitarbeit bei der Gestaltung von Bühnenbildern und
Requisiten
• Online Ausstellungen zu div. Themen, Wettbewerben, Projekten und Unterrichtsinhalten
• Kunst-Postkartensets mit wechselnden Motiven, die käuflich zu erwerben sind und deren
Erlös die Fachschaft für den Farbkopierer nutzt (Materialkosten Postkarten und Papier).
4Städtisches Gymnasium Ahlen Kunst Curriculum Oberstufe
2 Entscheidungen zum Unterricht
Im folgenden Kapitel wird exemplarisch eine Möglichkeit entwickelt, wie sich das Schulcurriculum
dieser Schule ausgestalten könnte. Der Entwicklungsprozess eines Schulcurriculums im Fach
Kunst wird im Sinne des oben beschriebenen Vorgehens mit den beigefügten Materialien
veranschaulicht. Es wird deutlich, dass häufig Vernetzungen zwischen den unterschiedlichen
konkretisierten Kompetenzerwartungen bestehen und wie im Sinne eines Spiralcurriculums
Kompetenzen vorbereitet, angelegt und gefestigt werden. Zusätzlich ist erkennbar, dass durch die
Auseinandersetzung mit den konkreten Kompetenzen sich der Fokus und die Ausrichtung eines
Unterrichtsvorhabens im Laufe der Planung verschieben und konkreter gefasst werden kann.
Die spezifische Situation vor Ort mit den vielfältigen Erfahrungen in der fachlichen und
überfachlichen Arbeit und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
deutet sich in Einzelbeispielen an.
Sekundarstufe I
Kunstunterricht findet im Regelunterricht der Sekundarstufe I statt. In der Orientierungsstufe
(KL.5 und Kl. 6) wird Kunst ganzjährig mit zwei Wochenstunden unterrichtet. In der Mittelstufe
(Kl.7, Kl. 8 und Kl.9) findet Kunstunterricht halbjährig mit zwei Wochenstunden im Wechsel mit
dem Fach Musik statt. Besonderheiten:
• Kunst wird durch Literatur auch ganzjährig als Differenzierungsfach mit Klausuren in den Jahrgangstufen 8
und 9 angeboten.
• Kunst bietet besonders interessierten Schülerinnen und Schülern in den Klassen 5-7 ein Profil Kunst im
Wahl-Pflicht Bereich an. Hier findet Begabtenförderung statt und es besteht die Möglichkeit, über den
normalen Kunstunterricht hinaus Techniken zu erlernen, zu vertiefen oder sich in aufwändigeren Projekten zu
engagieren.
• Ab Sommer 2019 wird Kunst in der Sekundarstufe I ab Klasse 5 als Profil unterrichtet. Dazu wird das
bisherige Profilkurskonzept aufgelöst und in den Regelunterricht integriert.
Sekundarstufe II
In der Oberstufe unseres Gymnasiums wird Kunst momentan in der EF, Q1 und Q2 unterrichtet.
In der EF wird das Fach als dreistündiger Grundkurs unterrichtet. Kunst kann von den SuS in der
Q1 wir folgt angewählt werden:
• als dreistündiger Grundkurs, mit der Möglichkeit, Kunst schriftlich als drittes oder viertes Prüfungsfach im
Abitur zu belegen.
• als fünfstündiger Leistungskurs.
5Städtisches Gymnasium Ahlen Kunst Curriculum Oberstufe
2.1 Unterrichtsvorhaben
Das „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) dient dazu, den Kolleginnen und
Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den
einzelnen Jahrgangsstufen zu verschaffen. Die hier angegebenen Kompetenzen decken nicht alle
im Unterrichtsvorhaben angelegten Kompetenzen ab.
Diese Unterrichtsvorhaben bündeln Kompetenzen des Kernlehrplans unter thematischen
Gesichtspunkten. Im Übersichtsraster werden nur die für das Unterrichtsvorhaben zentralen
Kompetenzen aufgeführt. Weiterhin werden den Unterrichtsvorhaben die im Kernlehrplan
vorgegebenen Inhaltsfelder und die inhaltlichen Schwerpunkte zugeordnet.
In den Kapiteln 2.1.2 und 2.1.3 „Konkretisierte Unterrichtsvorhaben“ werden die in Kapitel 2.1.1
aufgeführten Unterrichtsvorhaben detaillierter ausgeführt. Die Fachkonferenz dokumentiert hier
• ihre verbindlichen Festlegungen,
• ihre kollegialen Absprachen
• und ihre unverbindlichen Anregungen für die Unterrichtenden.
Die Fachkonferenz hat
• alle konkretisierten Kompetenzerwartungen einzelnen Unterrichtsvorhaben zugeordnet
und die entsprechenden Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte angegeben. Die
zentralen Kompetenzen des Unterrichtsvorhabens sind durch Fettschrift hervorgehoben;
• zu den aufgeführten Kompetenzen Unterrichtsinhalte angegeben, die sich auch aus den
jeweils geltenden Abiturvorgaben ergeben;
• gemäß Schulgesetz Grundsätze abgesprochen, die den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen
sind. Sie betreffen spezifische didaktische oder methodische Grundsätze, Lernmittel und -
orte, Instrumente und Bereiche der Diagnose und der Leistungsüberprüfung sowie
fächerübergreifende oder außerschulische Kooperationen. Diejenigen Absprachen, die sich
an den aufgeführten Unterrichtsvorhaben konkret festmachen lassen, werden an dieser
Stelle einbezogen.
Ziel der Darstellung ist, dass die Unterrichtsvorhaben für alle fachlichen Kolleginnen und Kollegen
nachvollziehbar sind. Die Darstellung ersetzt nicht die individuelle Unterrichtsplanung und erhebt
nicht den Anspruch eines Lehrwerks.
Eine Abweichung in der Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben ist im Rahmen der
pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte möglich. Sie wird in die regelmäßige Evaluation
eingebracht. Dabei bleibt allerdings sicherzustellen, dass im Rahmen der Umsetzung der
Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzen des Kernlehrplans ausgebildet werden.
6Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF, Q1 und Q2
Einführungsphase (EF)
Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:
Thema: Grafik – Naturalistische und abstrahierende Darstellungsprinzipien in der Zeichnung Thema: Farbe – Wahrnehmung und Wirklichkeit (naturalistische und abstrahierende Darstellungsprinzipien in der
Malerei)
Kompetenzen:
• (ELP 1) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten zweidimensionaler Bildgestaltungen unter Kompetenzen:
Anwendung linearer, flächenhafter und raumillusionärer Bildmittel. • (ELP 2) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten unter dif7ferenzierter Anwendung und
• (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und deren Kombination der Farbe als Bildmittel
spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild. • (ELR2) beschreiben Mittel der farbigen Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild
• (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im Dialog zwischen • (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im Dialog zwischen
Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess gewonnenen Erfahrungen. Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess gewonnenen Erfahrungen
• (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerischen Gestaltungen unterschiedliche zufallsgeleitete und
gezielte Bildstrategien. Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Farbe, Malerei, Bildstrategien, Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge
Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Form, Grafik, Bildstrategien, Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge
Zeitbedarf: HJ 1, 1. und halbes 2. Quartal Zeitbedarf: HJ 1, halbes 2. Quartal und HJ 2, erstes Quartal
Unterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:
Thema: ‚Suchen und Finden’ Mischtechniken / plastisches Arbeiten Thema: Methoden der Bildanalyse / Teilintegration in I bzw. II, III
Kompetenzen: Kompetenzen: die Schülerinnen und Schüler
• (ELP3) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten plastischer Bildgestaltungen unter Anwendung • (STR2) ordnen Gestaltungsprozesse und Gestaltungsergebnisse Intentionen zu (z.B. dokumentieren,
modellierender Verfahren appellieren, irritieren).
• (ELR3) beschreiben die Mittel der plastischen Gestaltung und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im • (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur Konzeption des Bildgefüges mit vorgegebenen Hilfsmitteln)
Bild • (GFR3) analysieren und erläutern Charakteristika und Funktionen von Bildgefügen durch analysierende
• (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerische Gestaltungen unterschiedliche zufallsgeleitete und und erläuternde Skizzen zu den Aspekten Farbe und Form
gezielte Bildstrategien • (GFR5) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten der Beschreibung des
Bildbestands sowie der Analyse des Bildgefüges und führen sie schlüssig zu einem Deutungsansatz
Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte zusammen
Inhaltliche Schwerpunkte: Material, Bildstrategien, Form und Farbe, Elemente der Bildgestaltung, Bilder als
Gesamtgefüge Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bildkonzepte und Bildstrategien, Bilder als Gesamtgefüge
Zeitbedarf: HJ 2, 2. Quartal
Zeitbedarf: Teilintegration in UV I, II, III
7Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
Qualifikationsphase Q1-Q2 (Festlegung der Kompetenzen in GK /LK (*) oder beide _ )
Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:
Thema: unser Weltbild vom Mittelalter bis in die Moderne - motivgeschichtlicher Ansatz // mögl. Kategorien: Thema: Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe II - Unser Weltbild* in der Kunst der
Menschendarstellung / Portrait / Landschaft / Natur und Raum Gegenwart - motivgeschichtlicher Ansatz // mögl. Kategorien: Menschendarstellung/Portrait/Landschaft/Natur u. Raum
Schwerpunkt: Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe in der Malerei und Grafik Schwerpunkt: Picasso (1930 - 1950 ) (GK / LK) / Gerhard Richter (1965-1990) (LK)
von Goya (1790-1825)
Kompetenzen:
Kompetenzen: • (ELP 3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, Techniken, Verfahren,
• (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter (*differenzierter) Anwendung linearer, farbiger, flächenhafter und Werkzeugen und deren Bezügen
raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und bewerten diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, • (ELR 4) erläutern die Abhängigkeiten zwischen Materialien, Medien, Techniken, Verfahren und Werkzeugen in bildnerischen
• (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und erläutern Gestaltungen und begründen die daraus resultierenden Ausdrucksqualitäten
deren Funktionen im Bild • (STP1) entwerfen (*ausgehend von eigenständig entwickelten Problemstellungen) zielgerichtet Bildgestaltungen durch
• (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten / (*komplexen) Problemstellungen sachgerechte Anwendung bekannter bildnerischer Techniken
• (KTR3) vergleichen traditionelle Bildmotive und erläutern ihre Bedeutung vor dem Hintergrund ihrer • (GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der
unterschiedlichen historischen Kontexte Analyse und führen sie zu einer Deutung zusammen.
• (*KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel traditioneller Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und • (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter Einbeziehung bildexternen Quellenmaterials die
ikonologischen Bezügen biografische, soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern
• (*KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich seiner Relevanz für die Ergänzung oder Relativierung der eigenen
Analyse, Interpretation oder fachspezifischen Erörterung
Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte Inhaltsfelder: Bildgestaltung/Bildkonzepte
Zeitbedarf: HJ 1 Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte
Zeitbedarf: HJ 2
Unterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:
Thema: Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und gesellschaftlichen Thema: Künstlerische Verfahren und Strategien der Bildentstehung in individuellen und gesellschaftlichen Kontexten -
Kontexten / aleatorische und kombinatorische Verfahren in Collage, Malerei und Zeichnung Neue Formen des Kunstwerks / Kunst im öffentlichen Raum
Schwerpunkt: Aleatorische (halbautomatische) und kombinatorische Verfahren des Surrealismus, Schwerpunkt: Konstruktion von Erinnerung in den Installationen und Objekten von Louise Bourgeois
insbesondere bei Max Ernst
Kompetenzen: die Schülerinnen und Schüler
Kompetenzen: • (ELP 2) realisieren Bildwirkungen unter (*differenzierter) Anwendung plastischer Mittel in raumbezogenen Gestaltungen und
• (ELP3) entwerfen bildnerische Gestaltungen unter absichtsvollem Einsatz von Materialien, Medien, Techniken, Verfahren, bewerten diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht
Werkzeugen und deren Bezügen • (ELR 2) analysieren die Mittel plastischer und raumbezogener Gestaltungen und erläutern deren Funktionen im Bild
• (ELR 1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und raumillusionären Gestaltung und erläutern deren • (STP5/*6) beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage dieser Erkenntnisse den Gestaltungsprozess
Funktionen im Bild • (*GFR7) nutzen und beurteilen den Aspekt bezogenen Bildvergleich als Mittel der Bilderschließung und Bilddeutung
• (STP 3) variieren abbildhafte u. nicht abbildhafte Darstellungsformen in Gestaltungen und erläutern die damit • (KTP 3) realisieren und vergleichen/*bewerten problem- und adressatenbezogene Präsentationen
verbundenen Intentionen • (KTR 2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter Einbeziehung bildexterner Quellenmaterials die
• (STP 4) bewerten und variieren Zufallsergebnisse im Gestaltungsvorgang als Anregung bzw. Korrektiv biografische, soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern
• (STP 5*) dokum. Gestaltungsprozesse u. erörtern dabei das konzeptionelle Potenzial v. Zufallsverfahren • (KTR 3*) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich seiner Relevanz für die Ergänzung oder Relativierung der eigenen
• (KTP 2) gestalten und erläutern / beurteilen* neue Bedeutungszusammenhänge durch Umdeutung und Umgestaltung von Analyse, Interpretation oder fachspezifischen Erörterung
Bildtraditionen
Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte, Plastik
Zeitbedarf: HJ 1 Zeitbedarf: HJ 2
8Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben EF
Unterrichtsvorhaben I: Grafik – Naturalistische und abstrahierende Darstellungsprinzipien in der Zeichnung
Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Form, Grafik, Bildstrategien, Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge
Zeitbedarf: 1 ½ Quartale (vernetzt mit UV IV)
Festlegung der Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur konkreten Umsetzung
Die Schülerinnen und Schüler… Materialien /Medien: • Bleistift; Fineliner; Kugelschreiber; Feder und Tusche; Kohle;
Unterschiedliche Papiere und unterschiedliche Zeichenmittel Pastellkreiden
Elemente der Bildgestaltung: • Pack-, Zeichen-, Butterbrot-, Ingrespapier, Zeichenkarton
• (ELP 1) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten zweidimensionaler Epochen / KünstlerInnen: • 17. Jh.: Cornelis Norbertus Gijsbrechts (Trompe-l’œil),
Bildgestaltungen unter Anwendung linearer, flächenhafter und • exemplarische Werke aus der Kunstgeschichte sowie der Rembrandt Radierungen
raumillusionärer Bildmittel. aktuellen Kunst • 20. Jh.: Giorgio Morandi (Stillleben), Horst Janssen, (Portraits)
• (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und
• motivgeschichtlicher Vergleich (z.B. Wasser, Portrait, Landschaft, • Analyse historischer Zeichnungen zur Herleitung der
raumillusionären Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten
im Bild.
Fisch…) verschiedenen Schraffurtechniken
• (ELR3) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von • Bild als Illusion: Magritte: „Ceci n’est pas une pipe“
Gestaltungen und deren spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild. • Das Trompe-l’œil als Beispiel für hochnaturalistische Darstellung
• (ELR 5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und • zeichnerische Komposition mit div. Verfremdungsprinzipien
Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen. • Anwendungen im Bereich von Grafik-Design, z.B. Gestaltungen
von Buchumschlägen, Leporellos, Logos, Visitenkarten,
Bilder als Gesamtgefüge: Geschenkpapier, Mandalas
• (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur Konzeption des Bildgefüges mit
Fachliche Methoden: • Plastisches Zeichnen einfacher geometrischer Körper (Kugel,
vorgegebenen Hilfsmitteln).
• (GFP3) entwerfen und bewerten Kompositionsformen als Mittel der
• Analyse und Beurteilung ausgewählter historischer Zeichnungen Würfel, Kegel, Pyramide, Zylinder etc.)
gezielten Bildaussage. hinsichtlich der enthaltenen zeichnerischen Mittel • Parallelschraffur; Kreuzschraffur; Formschraffur; Punkt-für-
• (GFR4) beschreiben Kriterien geleitet unterschiedliche Grade an • Unterschiedliche Konzepte des Zeichnens (naturalistische Punkt-Verfahren; „Kritzelschraffur“
Abbildhaftigkeit. Studien aus der Anschauung; Zeichnen aus der Erinnerung; • Zeichnerische Übungen
Blindzeichnung; Schnellzeichnung; konturlose Zeichnung; • motorische Zeichenübungen (ohne Abzusetzen; durchgehende
Bildstrategien: negative Eingrenzung) Line aus dem Arm etc.)
• (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im • Kompositionsskizzen zur Kompositionsanalyse ausgewählter • Herleitung der verschiedenen Formkontraste, z.B. anhand von
Dialog zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Werke der bildenden Kunst bzw. zur eigenen Bildfindung ausgewählten Stillleben (z.B. Morandi), Beispielen des Bauhaus
Prozess gewonnenen Erfahrungen.
• Formkontraste nach Itten / Bauhaus • Herleitung und Anwendung der Grundprinzipien des Bildaufbaus
• (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerischen Gestaltungen
unterschiedliche zufallsgeleitete und gezielte Bildstrategien. • Kompositionsprinzipien Stillleben (spannungsarm- (Symmetrie; Asymmetrie, offene/ geschlossene Komposition)
spannungsreich) • Praktische Umsetzung der Formkontraste, z.B. in Form eines
Bildkontexte: eigenen Stilllebens
• (KTP1) entwerfen und erläutern Bildgestaltungen als Ausdruck Diagnose der Fähigkeiten: • Herleitung der Naturalismus-Kriterien nach Georg Schmidt....
individueller Interessen. • Erzeugung von plastischen und räumlichen Werten durch • Einordnung ausgewählter historischer Werke hinsichtlich ihres
gezielte Hell-Dunkel-Differenzierung in Form verschiedener Ikonizitätsgrades/ Abstraktionsgrades...
Schraffur Techniken (Eigenschatten bzw. Körperlicht und • Diskussion: Ist der Wert/ die Qualität eines Bildes abhängig vom
Körperschatten / Schlagschatten) Ikonizitätsgrad?
• Genaues Studium von Formen und Proportionen - zeichnerische • Einführung zentraler Fachbegriffe der naturalistischen
9Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
Darstellung mit Außen- und Binnenkonturen Darstellungsweise ( Plastizität, Stofflichkeit, Detailgenauigkeit,
• (Naturalismus-) Kriterien geleitete Beurteilung eigener und Eigenschatten bzw. Körperlicht und Körperschatten,
fremder Bilder Schlagschatten / Räumlichkeit )
• Herstellen von Bezügen von sinnlich erfahrener Wirklichkeit und
ihrer Darstellung auf der Fläche (sowohl in der Produktion als
auch bei der Rezeption gegebener Werke)
• Grafische und formale Phänomene in fachsprachlich korrekte
Wortsprache überführen
• Zielführender Einsatz der sieben Formalkontraste
Leistungsbewertung sonstige Mitarbeit: • div. Dokumentationsformen schriftlicher und mündlicher Form
Kompetenzbereich Produktion: (z.B. Referat, Arbeitsergebnis dem Plenum präsentieren,
• Ergebnisse der künstlerischen Praxis: Zeichnungen; Skizzen; Portfolio, Skizzenbuch, schriftl. Auswertung, Einzelgespräche,
großformatige Kompositionen Reflexion im gemeinsamen UG / GA…)
• Reflexion über den Arbeitsprozess (Gestaltungsplanung, • Präsentation des Gestaltungsprozesses und der
Entwürfe und Entscheidungsfindung) Gestaltungsergebnisse (Schulöffentlichkeit)
• Reflexion über das Arbeitsergebnis in Hinsicht auf die geforderte
Aufgabenstellung
Kompetenzbereich Rezeption:
• Fachsprachlich richtige Erfassung des Seheidrucks
• mündliche, praktisch-rezeptive und schriftliche Ergebnisse von
Rezeptionsprozessen
• Aspekt orientierte Bildanalyse und Interpretationsansätze
Leistungsbewertung: Klausur Gestaltungspraktische Entwürfe und Problemlösungen mit
Reflexion zum eigenen Arbeitsprozess
(Schwerpunkt Praxis als neues Klausurformat)
10Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
Unterrichtsvorhaben II: Farbe – Wahrnehmung und Wirklichkeit (naturalistische und abstrahierende Darstellungsprinzipien in der Malerei)
Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Farbe, Malerei, Bildstrategien, Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge
Zeitbedarf: 1 ½ Quartale (vernetzt mit UV IV)
Festlegung der Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur konkreten Umsetzung
Die Schülerinnen und Schüler… Materialien /Medien: • Malen mit Acrylfarbe
Deckfarben, div. Papiere, Malkarton und Malgründe (Leinwand, Holz…) • deckendes Malen
Elemente der Bildgestaltung: • differenzierte Farbmischungen,
• (ELP 2) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten unter • Einführung in die naturalistische Darstellungsweise /
differenzierter Anwendung und Kombination der Farbe als Bildmittel duktusbetontes Malen
• (ELP 4) variieren und bewerten materialgebunden Impulse, die von den • Malen nach der Natur und nach Fotovorlagen
spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und
• Malen nach Musik
Bildverfahren (Zeichnen, Malen, Plastizieren) ausgehen
• (ELP 5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen • Experimente mit Farbwirkungen
und Bildverfahren (Zeichnen, Malen, Plastizieren) • Farbe und Ausdruck
• (ELR2) beschreiben Mittel der farbigen Gestaltung und deren spezifische (Schwerpunkt: sichtbarer Duktus, Malen mit Acryl)
Ausdrucksqualitäten im Bild Epochen / KünstlerInnen: • Werbung;
• (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und Verschiedene farbige Bildbeispiele aus der Malerei / Medien / Werbung / • themen-/motivgebundene Vergleichsbeispiele, z.B. Stillleben,
raumillusionären Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten versch. Epochen im Vergleich / motivgeschichtlicher Ansatz, analog zu UV1 Figurendarstellungen
im Bild
• (ELR3) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von • Eigenwert und Darstellungswert von Farbe, z.B. Bildbeispiele aus
Gestaltungen und deren spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild Expressionismus, Symbolismus und Impressionismus
• (ELR 5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und • Museumsbesuche (Arbeit vor Originalen)
Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen Fachliche Methoden: • Praktische Herleitung verschiedener Farbkontraste nach Itten
• Einführung in die Bildanalyse II: Vertiefung durch den Aspekt • Untersuchungen gezielter Farbtheoretischer Aspekte durch
Bilder als Gesamtgefüge: Farbtheorie in der werkimmanenten Bildanalyse praktisch rezeptive Methoden:
• (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur Konzeption des Bildgefüges mit • Analyse von Farbe, Farbkontrasten und Komposition (auch durch z.B.
vorgegebenen Hilfsmitteln)
zeichnerisch analytische Skizzen) • Gegenüberstellen von Farbreihen und Kontrasten,
• (GFP3) entwerfen und bewerten Kompositionsformen als Mittel der
gezielten Bildaussage
• Farbkontraste nach Itten / Bauhaus • durch Bestimmen und Nachmischen von Farben und
• (GFR1) beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von • Einführung in die Farbphysik Farbtypen
Perzepten • subjektive Farbharmonien, individuelle und gesellschaftliche • Verändern und Gegenüberstellen von Farbkonzepten
• (GFR2) beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand Faktoren / Farbpsychologie • Bewusstes Spiel mit Harmonien und Disharmonien
• (GFR3) analysieren und erläutern Charakteristika und Funktionen von • Farbfunktionen • Stationenlernen zu Farbphysik und Farbwahrnehmung (div.
Bildgefügen durch analysierende und erläuternde Skizzen zu den Aspekten • Deutungsansätze werkimmanent Experimente)
Farbe und Form
• Motivgeschichtlicher Vergleich
• (GFR4) beschreiben kriteriengeleitet unterschiedliche Grade an
Abbildhaftigkeit Diagnose der Fähigkeiten: • Kombinierte Wahrnehmungs- und Farbübungen,
• (GFR5) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen Aspekten • Selbstdiagnose der bisher erworbenen Fähigkeiten im Bereich • Diagnosekriterien aus den vorausgegangenen
der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse des Bildgefüges und Farbe in neuen Anwendungssituationen durch begleitende Unterrichtsinhalten ableiten, formulieren und einüben
führen sie schlüssig zu einem Deutungsansatz zusammen Reflexion im Arbeitsprozess (Farbgesetzmäßigkeiten, • Kontrollieren und Weiterentwickeln der Sprachfertigkeit bei der
• (GFR6) beurteilen das Perzept vor dem Hintergrund der Bildanalyse und Farbkonzepte, Farbmischungen und Farbwirkung (Farbfamilien, Bestandaufnahme und Beschreibung von Bildern
Bilddeutung Farbton, Farbkontraste, Sättigung, Helligkeit, Duktus…)
• Im Kompetenzbereich Rezeption, Wahrnehmungen in
Bildstrategien:
fachsprachlich korrekte Wortsprache zu überführen
• (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im
Leistungsbewertung sonstige Mitarbeit: • div. Dokumentationsformen schriftlicher und mündlicher Form
11Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
Dialog zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Kompetenzbereich Produktion: (z.B. Referat, Arbeitsergebnis dem Plenum präsentieren,
Prozess gewonnenen Erfahrungen • Gestaltungspraktische Versuche (Farbübungen, Skizzen und Portfolio, Skizzenbuch, schriftl. Auswertung, Einzelgespräche,
• (STP3) dokumentieren und bewerten den eigenen bildfindenden Dialog Reflexion im gemeinsamen UG / GA…)
Farbstudien im Gestaltungsprozess)
zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess
• Reflexion über den Arbeitsprozess (Gestaltungsplanung, Präsentation des Gestaltungsprozesses und der
gewonnenen Erfahrungen.
• (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerischen Gestaltungen Entwürfe und Entscheidungsfindung) Gestaltungsergebnisse (Schulöffentlichkeit)
unterschiedliche zufallsgeleitete und gezielte Bildstrategien • Reflexion über das Arbeitsergebnis in Hinsicht auf die geforderte
Aufgabenstellung
Bildkontexte:
• (KTP1) entwerfen und erläutern Bildgestaltungen als Ausdruck Kompetenzbereich Rezeption:
individueller Interessen • Skizze (Fertigung und Auswertung)
• (KTR1) erläutern an fremden Gestaltungen die biografische, • Praktisch-rezeptive Bildverfahren (mündliche, praktisch-
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern, auch unter dem
rezeptive und schriftliche Ergebnisse von Rezeptionsprozessen)
Aspekt der durch Kunst vermittelten gesellschaftlichen Rollenbilder von
Frauen und Männern • Aspekt orientierte Bildanalyse und Interpretationsansätze
• (KTR2) beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel ausgewählter Leistungsbewertung: Klausur Gestaltungspraktische Entwürfe und Problemlösungen mit Reflexion zum
Bildgegenstände durch die Anwendung der Methode des eigenen Arbeitsprozess (Schwerpunkt Praxis als neues Klausurformat)
motivgeschichtlichen Vergleichs.
Unterrichtsvorhaben III: ‚Suchen und Finden’ Mischtechniken / plastisches Arbeiten
Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Material, Bildstrategien, Form und Farbe, Bildstrategien, Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge
Zeitbedarf: 1 Quartal (vernetzt mit UV IV)
Festlegung der Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur konkreten Umsetzung
Die Schülerinnen und Schüler… Materialien /Medien: • Mischtechniken, Collagen,
Plastische Modelliermasse / unterschiedliche Werkzeuge / • Ton- oder Gipsplastiken,
Elemente der Bildgestaltung: div. gesammelte Objekte , div. Collagematerialien • Montagen,
• (ELP3) erproben und beurteilen Ausdrucksqualitäten plastischer • Objekt-/ Raumgestaltungen ( z.B. Assemblagen, Buchobjekte,
Bildgestaltungen unter Anwendung modellierender Verfahren
Objektmontagen, Ready mades, Objektkästen, kinet. Objekte)
• (ELP 4) variieren und bewerten materialgebunden Impulse, die von den
spezifischen Bezügen zwischen Materialien, Werkzeugen und
• assoziative Bildfindungen
Bildverfahren (Zeichnen, Malen, Plastizieren) ausgehen Epochen / KünstlerInnen: • Kurt Schwitters, Dadaismus
• (ELP 5) beurteilen die Einsatzmöglichkeiten von Materialien, Werkzeugen Verschiedene Plastik- und Objektbeispiele aus versch. Epochen im • Auguste Rodin, Ausdrucksstärke
und Bildverfahren (Zeichnen, Malen, Plastizieren) Vergleich / motivgeschichtlicher Ansatz, analog zu UV1 / möglichst • Michelangelo und griechische Plastik (Kontrapost)
• (ELR3) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von kontrastreich • Alexander Calder (kinetische Objekte)
Gestaltungen und deren spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild
• Marcel Duchamp (Bewegung, Ready Mades)
• (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von
Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild • Damien Hirst (Rauminstallationen, Objektkunst)
• (ELR 5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und • Olafur Eliasson (Rauminstallationen, Environments)
Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen. Fachliche Methoden: • Analyse von Körper-Raum Bezug
• Perceptbildung , • Experimentelle Methoden zur Erfassung des Körper-Raum
Bilder als Gesamtgefüge: • Einführung in die Plastikanalyse (Ansichtigkeit, Raumbezug) Zusammenhangs durch den Rezipienten durch Draht, Wachs
• (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur Konzeption des Bildgefüges mit • werkimmanente Methode, oder Papier
12Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
vorgegebenen Hilfsmitteln) • ikonographische Methode (vergleichende Analyse); evtl. • Experimente und ihre Auswertung
• (GFP3) entwerfen und bewerten Kompositionsformen als Mittel der analytische Skizzen; • Licht und Schattenspiele mit Papier, Scherenschnitt, Zeichnung
gezielten Bildaussage
• ggf. automatisches Schreiben
Diagnose der Fähigkeiten: • Schulung und Verbesserung Motorische Fertigkeiten im Umgang
Bildstrategien:
• Fähigkeit zu aleatorisch-assoziativer Gestaltungsweise mit Material durch Selbstbeobachtung
• (STP1) realisieren Gestaltungen zu bildnerischen Problemstellungen im
Dialog zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im (kontextuell fremde Bildwelten gestalterisch miteinander • Den Umgebungsraum zu dreidimensionalen Gestaltungen in
Prozess gewonnenen Erfahrungen verknüpfen sowie neue Bildwelten entwerfen können) Beziehung setzen, durch diagnostische Aufgaben
• (STP3) dokumentieren und bewerten den eigenen bildfindenden Dialog • Fähigkeit zur Integration von Ergebnissen aus zufallsgeleiteten • Diagnosekriterien aus den vorausgegangenen
zwischen Gestaltungsabsicht, unerwarteten Ergebnissen und im Prozess und gezielten Bildstrategien in einer Gestaltung Unterrichtsinhalten ableiten und formulieren, um den Aspekt
gewonnenen Erfahrungen • Fähigkeit bedeutungsoffene Bildwelten lesen und in der Räumlichkeit und Plastik erweitern
• (STR1) beschreiben und untersuchen in bildnerischen Gestaltungen angemessener Weise verstehen können
unterschiedliche zufallsgeleitete und gezielte Bildstrategien
Leistungsbewertung sonstige Mitarbeit: • Werktagebuch
Kompetenzbereich Produktion: • Gestaltungspraktische Übungen
Bildkontexte:
• Gestaltungspraktische Versuche (Skizzen , Modelle, • Reflexion der Arbeitsergebnisse individuell und im Plenum
• (KTP1) entwerfen und erläutern Bildgestaltungen als Ausdruck
individueller Interessen Assemblagen, Collagen u. Objektstudien im Gestaltungsprozess) • Präsentation ( Gestaltungsergebnisse und ihre Präsentation im
• Reflexion über den Arbeitsprozess (Gestaltungsplanung, Raum)
Entwürfe und Entscheidungsfindung)
• Reflexion über das Arbeitsergebnis in Hinsicht auf die geforderte
Aufgabenstellung
Kompetenzbereich Rezeption:
• Skizzen (Fertigung und Auswertung)
• Praktisch-rezeptive Bildverfahren (mündliche, praktisch-
rezeptive und schriftliche Ergebnisse von Rezeptionsprozessen)
• Aspekt orientierte Plastikanalyse und Interpretationsansätze
Leistungsbewertung: Klausur entfällt
Unterrichtsvorhaben IV: Methoden der Bildanalyse / Teilintegration in I bzw. II, III
Inhaltsfelder: Bildgestaltung, Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bildkonzepte und Bildstrategien, Bilder als Gesamtgefüge
Zeitbedarf: Teilintegration in UV I, II, III
Festlegung der Kompetenzen Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur konkreten Umsetzung
Die Schülerinnen und Schüler… Materialien /Medien: Vers. Verfahren zu Analyseskizzen einüben, z.B. kleine
Folien, Transparentpapier, Werkkopien „Handskizzen“, Überblicksskizzen, genaue Bildaufbauskizzen und
Elemente der Bildgestaltung: Hell-Dunkel Skizzen
• (ELR1) beschreiben die Mittel der linearen, flächenhaften und
Epochen / KünstlerInnen: • Wandbilder im Musikflur des Altbaus / Projektergebnisse von
raumillusionären Gestaltung und deren spezifische Ausdrucksqualitäten
im Bild
unterschiedliche Bildkonzepte mit unterschiedlicher Wirklichkeitsnähe: Kunstkursen der Oberstufe
• (ELR2) beschreiben Mittel der farbigen Gestaltung und deren spezifische • Besuche und Besprechungen aktueller Ausstellungen in Museen
Ausdrucksqualitäten im Bild Bildbeispiele aus unterschiedlichen Epochen und Kunst-Richtungen • Beispiele aus Barock, Klassizismus, Expressionismus,
• (ELR3) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von Gegenwartskunst, neue Medien
13Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
Gestaltungen und deren spezifische Ausdrucksqualitäten im Bild
• (ELR4) beschreiben und erläutern materialgebundene Aspekte von
Gestaltungen und deren spezifischen Ausdrucksqualitäten im Bild Fachliche Methoden: • Verschiedene Methoden zur Annäherung an ein Kunstwerk:
• (ELR 5) erläutern und bewerten Bezüge zwischen Materialien und • Perceptbildung, Nachstellen, Fotografie, Vergleiche
Werkzeugen in bildnerischen Gestaltungen. • werkimmanente Methode, • Experimentelle Methoden zur Perzeptbildung (z.B.
• ikonographische Methode ( Bildvergleiche ); automatisches Schreiben, assoziativer Ansatz)
Bilder als Gesamtgefüge • analytische Skizzen zur Komposition • Naturalismuskriterien (nach Schmidt)
• (GFP1) veranschaulichen Bildzugänge mittels praktisch-rezeptiver • Linienführung in Skizzen (gedachte, reelle Linien, Legende,
Analyseverfahren Zusammenhänge erfassendes Zeichnen einüben)
• (GFP2) erstellen grundlegende Skizzen zur Konzeption des Bildgefüges
mit vorgegebenen Hilfsmitteln)
Diagnose der Fähigkeiten: • Aspekte der Selbstdiagnose anhand eingeübter Analyseroutinen
• (GFR1) beschreiben die subjektiven Bildwirkungen auf der Grundlage von • Wahrnehmungen im Kompetenzbereich Rezeption in und Vergleichen in Gruppenarbeit
Perzepten fachsprachlich korrekte Wortsprache zu überführen, • Kontrollieren und Weiterentwickeln der Sprachfertigkeit /
• (GFR2) beschreiben strukturiert den sichtbaren Bildbestand • Farb- und Formkontraste anzuwenden, Fachbegriffe bei der Bestandsaufnahme, Beschreibung und
• (GFR3) analysieren und erläutern Charakteristika und Funktionen von • analytisch bildimmanenten Aspekten zuzuordnen sowie Analyse von Bildern
Bildgefügen durch analysierende und erläuternde Skizzen zu den synthetisierend zu interpretieren
Aspekten Farbe und Form
Leistungsbewertung sonstige Mitarbeit: • Präsentaiton der Analyseergebnisse / Kompositionsskizzen im
• (GFR4) beschreiben Kriterien geleitet unterschiedliche Grade an
Abbildhaftigkeit
Kompetenzbereich Produktion: Plenung
• (GFR5) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen • Anfertigung von Kompositionsskizzen • Arbeitseinsatz in Gruppen und Präsentation / Reflexion der
Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse des • Bilder als Anlässe zu kreativem Schreiben Gruppenergebnisse
Bildgefüges und führen sie schlüssig zu einem Deutungsansatz • Auswertung von Perzepten (mündlicher und schriftlicher Form)
zusammen Kompetenzbereich Rezeption: auf Basis der Analysegrundlagen / Interpretationsergebnisse
• (GFR6) beurteilen das Perzept vor dem Hintergrund der Bildanalyse und • Schriftliche und mündliche Erläuterung von werkimmanenten
Bilddeutung
Analyseergebnissen, von Interpretationsansätzen und von
erweiterten methodischen Ansätzen
Bildstrategien:
Leistungsbewertung: Klausur entfällt
• (STR2) benennen und beurteilen abbildhafte und nicht abbildhafte
Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen
Bildkontexte:
• (KTR1) erläutern an fremden Gestaltungen die biografische,
soziokulturelle und historische Bedingtheit von Bildern, auch unter dem
Aspekt der durch Kunst vermittelten gesellschaftlichen Rollenbilder von
Frauen und Männern
(KTR2) beschreiben und beurteilen den Bedeutungswandel ausgewählter
Bildgegenstände durch die Anwendung der Methode des
motivgeschichtlichen Vergleichs.
14Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
2.1.4 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Q1-Q2
Qualifikationsphase Q.1.1 ABITUR 2019-20
unser Weltbild*vom Mittelalter bis in die Moderne - motivgeschichtlicher Ansatz // mögl. Kategorien: Menschendarstellung / Portrait / Landschaft / Natur und Raum
Schwerpunkt**: Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen Distanz und Nähe in der Malerei und Grafik von Goya (1790-1825)
Inhaltsfelder: Bildgestaltung / Bildkonzepte
Inhaltliche Schwerpunkte: Elemente der Bildgestaltung, Bilder als Gesamtgefüge, Bildstrategien, Bildkontexte
Zeitbedarf: 50 Std. (abzählen, ansonsten: HJ 1)
Festlegung der Kompetenzen in GK /LK (*) oder beide _ Absprachen hinsichtlich der Bereiche Anregungen zur konkreten Umsetzung
Die Schülerinnen und Schüler… (je nach Thema, s.o.)
Übergeordnete Kompetenzen alle Halbjahre: Materialien /Medien: • unterschiedliche Zeichen- und Malmittel wie Kohle und Kreide
• (ÜP1) gestalten Bilder planvoll/bewusst* und problemorientiert mit Grafische und malerische Verfahren und Medien auf Papier, Karton, Aquarell, Acryl
Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedlicher Bildverfahren / mit unterschiedlichen
Bildverfahren und bewerten die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten* • Drucktechniken ( Radierung )
• (ÜP2) gestalten Bilder im Sinne eines bildfindenden Dialogs und erläutern diesen Epochen / KünstlerInnen: - Auswahl erfolgt nach jeweiligen Abiturvorgaben -
Prozess am eigenen Gestaltungsergebnis
• (ÜP3) gestalten und beurteilen (unterschiedliche*) kontextbezogene Bildkonzepte
• Mittelalter / Kaiser Otto III. /Verkündigung
• (ÜR1) beschreiben eigene und fremde Gestaltungen differenziert und stellen die • Europäische Kunstgeschichte, Überblickswissen / Einführung • Renaissance, Dürer / Selbstbildnisse / Tizian / Caravaggio
Ergebnisse ihrer Analysen, Deutungen und Erörterungen fachsprachlich korrekt/ (in • Barock, u.a. Rembrandt, z.B. Motivvergleiche ‚Adam und Eva’ ,
fachspez. Argumentationsformen*) dar
• Schwerpunkt: Künstlerische Sichtweisen und Haltungen zwischen ‚Figur des Bettlers’
• (ÜR2) analysieren systematisch mit grundlegenden Verfahren / (gezielt
ausgewählten Untersuchungsverfahren*) unbekannte Werke aus bekannten (und Distanz und Nähe: Goya ( Malerei und Grafik 1790-1825 ) • Zwischen Rokoko und Romantik, Goyas Stilbrüche, seine Portraits
unbekannten*) Zusammenhängen und leiten Deutungsansätze ab (z.B. Maja, Karl IV), politische Radierungen (Disparates, Desastres,
• (ÜR3) erläutern und bewerten eigene und fremde Gestaltungen hinsichtlich der (**mögl. Aufteilungen zu Goya: Malerei und Grafik, surreal Vgl. Los Caprichos), die Pinturas Negras, Sardine, Koloss…
Form-Inhalts-Bezüge und des Einflusses bildexterner Faktoren
• (ÜR4) erläutern und vergleichen grundlegende Gestaltungskonzepte mit Ernst + Picasso /Picasso Radierungen)
• (*ÜR4) vergleichen und bewerten Zusammenhänge und Entwicklungen Fachliche Methoden (in den weiteren Halbjahren ergänzt und vertieft): • naturalistische Zeichentechniken ( Vertiefung )
grundlegender Gestaltungskonzeptionen und ihre Wirkungen Analyse ( auch mittels Aspekt bezogener Skizzen und praktisch-rezeptiver
• (*ÜR5) deuten und erörtern ästhetische Gestaltungen als Modelle von
• Schwerpunkt: individueller freier Strich
Wirklichkeitskonstruktionen Zugänge ) und Deutung, u.a. • Radierung
• (*ÜR6) erläutern und bewerten die verwendeten rezeptiven Methoden • werkimmanente Methode, hier insbesondere Untersuchung des • Maltechniken ( Erweiterung )
Grades der Wirklichkeitsnähe • subjektiver und flächiger Duktus
Elemente der Bildgestaltung: • erweiterte Deutungen durch Einbeziehung der jeweiligen
• (ELP1) realisieren Bildwirkungen unter (*differenzierter) Anwendung linearer,
• Fotografieren, Collage, Übermalen/Überzeichnen
biographischen, soziokulturellen und historischen Bedingtheiten • Präsentieren, Inszenieren
farbiger, flächenhafter und raumillusionärer Mittel der Bildgestaltung und
bewerten diese im Hinblick auf die Gestaltungsabsicht, • Auswertung bildexternen Quellenmaterials
• (ELR1) analysieren die Mittel der linearen, farbigen, flächenhaften und • Aspekt bezogener Bildvergleich ( Grad der Abbildhaftigkeit,
raumillusionären Gestaltung und erläutern deren Funktionen im Bild Medialität )
• motivgeschichtlicher Vergleich von Bildern aus unterschiedlichen
Bilder als Gesamtgefüge: Epochen
• (GFP1) realisieren Bilder als Gesamtgefüge zu eingegrenzten / (*komplexen)
Diagnose der Fähigkeiten und Fertigkeiten • zeichnerische und malerische Entwürfe zu eigenen
Problemstellungen
• (GFP2) erstellen Aspekt bezogene Skizzen (*differenzierte Entwürfe) zur • der Erfassung und Darstellung von Proportionen und Formen Bildgestaltungen
Konzeption des Bildgefüges für eigene Gestaltungen sowie der körperillusionären Darstellung • Zeichenübungen, vorbereitende Skizzen
• (GFR1) beschreiben strukturiert den wesentlichen sichtbaren Bildbestand • zur Selbstbeurteilung des Lernstands • malerische Studien und Farbproben
• (GFR2) erstellen Aspekt bezogene Skizzen zur Organisation des Bildgefüges • zur strukturierten Beschreibung des Bildbestands, zur • Verfassen schriftlicher Bildbeschreibungen sowie zu
fremder Gestaltungen (* erstellen differenzierte Skizzen zur Organisation des Verwendung von Fachsprache, zur Analyse und Ableitung einer Anaylseaspekten und Deutungen
Bildgefüges in fremden Gestaltungen zu selbst gewählten Aspekten) schlüssigen Deutung
15Städtisches Gymnasium Ahlen Curriculum Kunst Oberstufe
• (GFR5) überprüfen Deutungshypothesen mit (*gezielt) ausgewählten Formen • zur angemessenen Literaturrecherche und Verknüpfung der
der Bildanalyse (u. a. Beschreibung der formalen Zusammenhänge und des externen Informationen mit der eigenen vorläufigen Deutung zur
Grads der Abbildhaftigkeit),
adressatengerechten Präsentation
• (GFR6) benennen und erläutern Bezüge zwischen verschiedenen
Aspekten der Beschreibung des Bildbestands sowie der Analyse und führen sie Leistungsbewertung sonstige Mitarbeit: • zeichnerische Komposition
zu einer Deutung zusammen. Kompetenzbereich Produktion: • Collage und Zeichnung
• Gestaltungspraktische Entwürfe / Planungen • fotografische Dokumentation
Bildstrategien: • Bewertung in Bezug auf die Gestaltungsabsicht • Bildgestaltungen
• (STP1) entwerfen (*ausgehend von eigenständig entwickelten • Gestaltungspraktische Problemlösungen • Präsentation
Problemstellungen) zielgerichtet Bildgestaltungen durch sachgerechte
Anwendung bekannter bildnerischer Techniken
Vorbereitung und Durchführung einer Präsentation bzw. Ausstellung • Ausstellung
• (STP5/*6) beurteilen Zwischenstände kritisch und verändern auf Grundlage der Planung u/o Lösung
dieser Erkenntnisse den Gestaltungsprozess -------------------------------
• (STP6/*7) erläutern den eigenen bildnerischen Prozess und begründen ihre Kompetenzbereich Rezeption:
Gestaltungsentscheidungen • analysierende und erläuternde Skizzen ( Bildfläche, • Mündliche Vorträge
• (STP7/*8) erläutern die eigenen gestalterischen Ergebnisse hinsichtlich der Richtungsbezüge, Farbbezüge ) • Protokolle
Gestaltungsabsicht und beurteilen sie Kriterien orientiert. • Beschreibung, Analyse / Interpretation von Bildern (Aspekt • Folienskizzen
• (*STP9) erörtern selbst erprobte Bildstrategien vor dem Hintergrund der
bezogene Vergleiche ) im Zusammenhang mit bildexternen
vorgefundenen Bedingungen und der angestrebten Intention
• (STR3) vergleichen und beurteilen die Ein- oder Mehrdeutigkeit von Bildern in
Quellen
Abhängigkeit zum Adressaten
• (STR4) vergleichen und (*beurteilen) bewerten abbildhafte und nicht Leistungsbewertung Klausur (zur Leistungsbewertung siehe Extra Info) • Aspekt orientierter Vergleich, etwa von Künstler-/ Selbstportraits
abbildhafte Darstellungsformen in bildnerischen Gestaltungen. Theorie: • (LK) malerisch differenzierte / Duktus orientierte Interpretation
Analyse / Interpretation von Bildern ( Beschreibung und Aspekt orientierte e. Fotografie
Bildkonzepte: Untersuchung mit analysierenden Skizzen und Deutung im Bildvergleich ), • Interpretation / Zeichnung, evtl. mit Collage
• (KTP1) entwerfen und begründen Bildgestaltungen als Ausdruck individueller jeweils angepasster und Kriterien geleiteter Erwartungshorizont angepasst an
Positionen im Sinne einer persönlichen Deutung von Wirklichkeit (*in
• Themenbasierte Malerei/Zeichnung/Collage in Mischtechnik
kulturellen Kontexten)
Abiturvorgaben / am Bsp. früherer Abiturprüfungen
• (KTR2) vergleichen und erörtern an fremden Gestaltungen unter Einbeziehung Praxis:
bildexternen Quellenmaterials die biografische, soziokulturelle und historische festgelegte, im Unterricht besprochene und eingeübte Kriterien (z.B.
Bedingtheit von Bildern ausführliche und themenbasierte Farbdifferenzierung, genaue
• (KTR3) vergleichen traditionelle Bildmotive und erläutern ihre Bedeutung vor Mischverhältnisse, Form und Inhalt angepasster Duktus, schrittweise Lösen
dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen historischen Kontexte vom Naturvorbild, flüssige und sinnvolle Integration von kontrastiven
• (*KTR3) bewerten bildexternes Quellenmaterial hinsichtlich seiner Relevanz für Elementen, Fähigkeit zur kritischen Reflexion der eigenen künstlerischen
die Ergänzung oder Relativierung der eigenen Analyse, Interpretation oder Arbeit, Formulieren gestalterischer Vorgehensweise…)
fachspezifischen Erörterung
• (*KTR4) erläutern und beurteilen den Bedeutungswandel traditioneller
Bildmotive in ihren stilgeschichtlichen und ikonologischen Bezügen
• (KTR5) analysieren und vergleichen die Präsentationsformen von Bildern in
kulturellen Kontexten.
• (*KTR5) analysieren und bewerten vergleichend komplexe Bildzeichen aus
Beispielen der Medien- /Konsumwelt und der bildenden Kunst
*Weltbild umfasst im weitesten Sinne die künstlerische Wahrnehmung / Interpretation verschiedenster Strömungen, Veränderungen und Entwicklungen in Gesellschaft, Umwelt, Weltpolitik, Ökologie, Ökonomie, Wirtschaft, Soziologie und eröffnet so die Möglichkeit, den sehr eingeschränkten Motivkomplex
„Menschen“ sinnvoll zu erweitern…
**Schwerpunktthemen können bei Bedarf auch innerhalb der HJ gesplittet und kombiniert werden (z.B. bei Vergleichen und/oder Großprojekten). Sie sind durch die jew. Lehrkraft in einzelne UVs zu strukturieren und flexibel zu untergliedern (z.B. in einheitliche Blöcke v. Theorie und Praxis / Theorie u. Praxis
kombiniert / Themensplittung* / Reihenfolge angepasst an größere Projekte)
16Sie können auch lesen