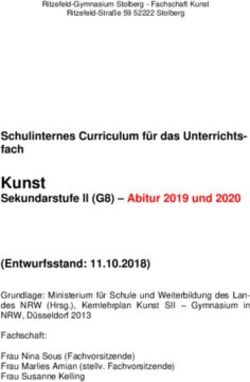Schulinternes Curriculum der Qualifikationsphase im Fach Sozialwissenschaften
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schulinternes Curriculum der Qualifikationsphase im Fach Sozialwissenschaften
Stand: 06.11.2016
Wichtig! Zwingend sind die zusätzlichen aktuellen Abiturvorgaben zu beachten!
Inhaltsfeld 4: Wirtschaftspolitik
inhaltliche Schwerpunkte:
‐ Legitimation staatlichen Handelns im Bereich der Wirtschaftspolitik
‐ Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
‐ Konjunktur‐ und Wachstumsschwankungen
Unterrichtsvorhaben: IF 4: Wirtschaftspolitik
Sequenz 1: „Warum geht es nicht immer aufwärts? – Marktwirtschaft zwischen Boom und Krise“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/Material
‐ Absicherung staatlichen SuS SuS SuS SuS
Handelns im wirtschaft‐ ‐ beschreiben die Ziele ‐ erörtern die rechtliche ‐ werten fragegeleitet ‐entwickeln aus der Aspekte zur Leistungs‐
lichen Bereich durch GG d. Wirtschaftspolitik u. Legitimation staatlichen Daten u. deren Aufbe‐ Analyse zunehmend bewertung:
u. StWG, erläutern Zielharmo‐ Handelns in der Wirt‐ beitung im Hinblick auf komplexerer wirtschaft‐ ‐ zwei zweistündige
nien u. –konflikte schaftspolitik (u.a. GG Datenquellen, Aussage‐ licher, gesellschaftlicher Klausuren pro Halbjahr
‐ Wirtschaftspolitische innerhalb des mag‐ sowie StWG)(UK 1,2), u. Geltungsbereiche (….) u. sozialer Konflikte bei Schriftlichkeit,
Zielsetzungen (StWG), ischen Vierecks sowie ‐ beurteilen Zielgrößen aus u. überprüfen diese angemessene ‐ Bewertung mittels
Erweiterungen u. Indi‐ seiner Erweiterung um der gesamtwirtschaft‐ bezüglich ihrer Gültig‐ Lösungsstrategien u. ausgearbeitetem Be‐
katoren, Gerechtigkeits‐ und lichen Entwicklung und keit für die Ausgangsfra‐ wenden diese an (HK 3), wertungsbogen,
Nachhaltigkeits‐ deren Indikatoren im ge (MK 3), ‐ nehmen in diskursiven, ‐ Berücksichtigung der
‐ Konjunkturverlauf u. – aspekte zum mag‐ Hinblick auf deren Aus‐ ‐ analysieren unter‐ simulativen u. realen schriftlichen Dimension
zyklus unter Einbezug ischen Sechseck (SK 2), sagekraft u. die zugrun‐ schiedliche sozialwissen sozialwissenschaftlichen im Rahmen der Bewer‐
von Wachstum, Preis‐ ‐ erläutern den Kon‐ de liegenden Interessen schaftliche Textsorten Aushandlungsszenarien tung der sonstigen
entwicklung, Beschäfti‐ junkturverlauf und das (UK 4), wie kontinuierliche u. einen Standpunkt ein Mitarbeit durch min‐
ung u. Außenbeitrag Modell des Konjunktur ‐ beurteilen die Reich‐ diskontinuierliche Texte und vertreten eigene destens eine Analysezyklus auf der Grund‐ weite des Modells des (…) (MK 4), Interessen in Abwägung oder eine schriftliche
lage einer Analyse von Konjunkturzyklus ( UK ‐ ermitteln in themen‐ mit den Interessen Übung,
Wachstum, Preisent‐ 1,2), , u. aspektgeleiteter anderer ( HK 4),
wicklung, Beschäfti‐ ‐ beurteilen die Funk‐ Untersuchung die Inhaltlich‐methodische
gung u. Außenbeitrag tion u. Gültigkeit v. öko‐ Position u. Absprachen:
sowie von deren nomischen Prognosen Argumentation sozial‐ ‐ modellartige u. reale
Indikatoren (SK 1,2, (UK 8), wissenschaftlich rele‐ Entwicklungen berück‐
evtl. auch 3, wenn vanter Texte (…) (MK 5), sichtigen,
Theorien einbezogen ‐ setzen Methoden u. ‐ Ausbau der Fachtermi‐
werden), Techniken zur Präsenta‐ nologie u. des Metho‐
tion u. Darstellung denrepertoires,
sozialwissenschaftlicher ‐ Operatorenübungen,
Strukturen u. Prozesse
zur Unterstützung v. so
zialwissenschaftlichen
Analysen u. Argumenta‐
tionen ein (MK 9),
‐ ermitteln – auch ver‐
gleichend – Prämissen,
Grundprinzipien, Kon‐
struktion sowie Abstrak‐
tionsgrad u. Reichweite
sozialwissenschaftlicher
Modelle u. Theorien u.
überprüfen diese auf
ihren Erkenntniswert
(MK 11),
‐ analysieren sozialwis‐
senschaftlich relevante
Situationen u. Texte im
Hinblick auf die in ihnen
wirksam werdenden
Perspektiven u. Interes‐senlagen sowie ihre Vernachlässigung alter‐ nativer Interessen u. Perspektiven (MK 13), ‐ identifizieren u. über‐ prüfen sozialwiss. Indikatoren im Hinbl.auf ihre Validität (MK 16),
Inhaltsfeld 4: Wirtschaftspolitik
Inhaltliche Schwerpunkte:
‐ Legitimation staatlichen Handelns im Bereich der Wirtschaftspolitik,
‐ Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland,
‐ Konjunktur‐ und Wachstumsschwankungen,
‐ Qualitatives Wachstum und nachhaltige Entwicklung,
‐ (Wirtschaftspolitische Konzeptionen)
‐ (Bereiche u. Instrumente der Wirtschaftspolitik)
Unterrichtsvorhaben: Wirtschaftspolitik
Sequenz 2: „ Immer mehr oder immer besser? – Wirtschaftliches Wachstum und Alternativen“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/Material
‐ Das BIP als Wachstums‐ SuS SuS SuS SuS s. Ausführungen zu
indikator und seine ‐ beschreiben die Ziele ‐ erörtern kontroverse ‐ analysieren unter‐ ‐ entwerfen für diskur‐ Sequenz 1!
Problematik der Wirtschaftspolitik Positionen zu staat‐ schiedliche sozialwissen sive, simulative und
und erläutern Zielhar‐ lichen Eingriffen in schaftliche Textsorten reale sozialwissen‐
‐ Indikatoren für nach‐ monien und –konflikte marktwirtschaftlichen wie kontinuierliche u. schaftliche Handlungs‐
haltiges u. qualitatives innerhalb des magi‐ Systemen (UK 1 – 3), diskontinuierliche szenarien zunehmend
Wachstum in der schen Vierecks sowie ‐ erörtern die rechtliche Texte, Fallbeispiele, komplexe Handlungs‐
Diskussion, seiner Erweiterung um Legitimation staatlichen Statistiken, Karikaturen pläne und übernehmen
Gerechtigkeits‐ und Handelns in der Wirt‐ sowie andere Medien‐ fach‐, situatonsbezogen
‐ Wachstum im Kontext Nachhaltigkeitsaspekte schaftspolitik ( u.a. GG produkte aus sozial‐ u. adressatenbezogen
traditioneller und alter‐ zum magischen Sechs‐ sowie StWG) (UK 1 – 3 wissenschaftlichen die zugehörigen Rollen
nativer wirtschaftspoli‐ eck (SK 3), u. 7), Perspektiven (MK 4), (HK 2),
tischer Konzeptionen, (‐) analysieren an ‐ beurteilen Zielgrößen ‐ ermitteln in themen‐ ‐ entwickeln aus der
einem Fallbeispiel der gesamtwirtschaft‐ und aspektgeleiteter Analyse zunehmend
‐ Aspekte der Auseinan‐ Interessen und lichen Entwicklung und Untersuchung die komplexerer wirtschaft‐
dersetzung gesellschaft‐ wirtschaftspolitische deren Indikatoren im Position u. Argumen‐ licher, gesellschaftlicher
licher Gruppierungen Konzeptionen von Hinblick auf deren Aus‐ tation sozialwissen‐ und sozialer Konflikte
um neue Wachstums‐ Arbeitgeberverbänden sagekraft und die schaftlich relevanter angemessene Lösungs‐konzepte u. Gewerkschaften, (SK zugrunde liegenden Texte (…) (MK 5), strategien u. wenden
1), Interessen (UK 3, 7, 9), ‐ präsentieren konkrete diese an. (HK 3),
‐ Zur internationalen ‐ erläutern die Hand‐ ‐ beurteilen die Funk‐ Lösungsmodelle, Alter‐ ‐ nehmen in diskursiven,
Verflechtung wachs‐ lungsspielräume u. tion und Gültigkeit von nativen oder Verbesse‐ simulativen u. realen
tumspolitischer Vor‐ Grenzen national‐ ökonomischen Prog‐ rungsvorschläge zu sozialwissenschaftlichen
stellungen staatlicher Wirtschafts nosen (UK 5 – 6), einer konkreten sozial‐ Aushandlungsszenarien
politik angesichts ‐ erörtern die Möglich‐ wissenschaftlichen einen Standpunkt ein
supranationaler Ver‐ keiten und Grenzen Problemstellung MK 7), und vertreten eigene
flechtungen sowie nationaler Wirtschafts‐ ‐ stellen fachintegrativ Interessen in
weltweiter Krisen (SK politik (UK 5, 6, 9), und modellierend sozial Abwägung mit den
2), wissenschaftliche Prob‐ Interessen anderer (HK
leme unter wirtschafts‐ 4),
wissenschaftlicher, so‐ ‐ vermitteln eigene Inter
ziologischer u. politik‐ essen mit den Interes‐
wissenschaftlicher Per‐ sen Nah‐ und
spektive dar (MK 8), Fernstehender u.
‐ analysieren sozial‐ erweitern die eigene
wissenschaftlich relevan Perspektive in Richtung
te Situationen u. Texte eines Allgemeinwohls
im Hinblick auf die in (HK 7),
ihnen wirksam werden‐
den Perspektiven u.
Interessenlagen sowie
ihre Vernachlässigung
alternativer Interessen
u. Perspektiven (MK 13)
‐ identifizieren eindi‐
mensionale u. herme‐
tische Argumentationen
ohne entwickelte Alter‐
nativen (MK 14),
‐ analysieren sozialwis‐
senschaftlich relevanteSituationen u. Texte unter den Aspekten der Ansprüche einzelner Positionen u. Interessen auf die Repräsentation des Allgemeinwohls, auf Allgemeingültigkeit so‐ wie Wissenschaftlich‐ keit (MK 15), ‐ identifizieren u. über‐ prüfen sozialwissen‐ schaftliche Indikatoren im Hinblick auf ihre Validität (MK 16), ‐ ermitteln sozialwissen‐ schaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen u. ge‐ sellschaftlichen Ord‐ nung u. deren Verän‐ derung (MK 17),
Inhaltsfeld 4: Wirtschaftspolitik
inhaltliche Schwerpunkte:
‐ Legitimation staatlichen Handelns im Bereich der Wirtschaftspolitik
‐ Wirtschaftspolitische Konzeptionen
‐ Bereiche und Instrumente der Wirtschaftspolitik
Unterrichtsvorhaben: Wirtschaftspolitik
Sequenz 3: „Lenken oder loslassen? – Wie soll staatliche Wirtschaftspolitik gestaltet werden?“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/Material
‐ Aspektorientierte Erar‐ SuS SuS SuS SuS s. Ausführungen zu
beitung wirtschaftspo‐ ‐ unterscheiden die ‐ erörtern kontroverse ‐ erschließen fragegelei‐ ‐ entwerfen für diskur‐ Sequenz 1!
litischer Konzeptionen Instrumente u. Positionen zu staat‐ tet in selbstständiger sive, simulative u. reale
(klassische – zur Ab‐ Wirkungen angebots‐ lichen Eingriffen in Recherche aus sozial‐ sozialwissenschaftliche
grenzung; nachfrage‐ orientierter, nachfra‐ marktwirtschaftlichen wissenschaftlich Handlungsszenarien
orientierte, angebots‐ georientierter u. alter‐ Systemen (UK 1 – 4), relevanten Textsorten zunehmend komplexe
orientierte und alter‐ nativer wirtschafts‐ ‐ beurteilen wirtschafts‐ zentrale Aussagen u. Handlungspläne u.
native), politischer Konzep‐ politische Konzeptionen Positionen sowie übernehmen fach‐,
tionen, (SK 3), im Hinblick auf die Intentionen u. mögliche situationsbezogen u.
‐ Analyse von Bereichen ‐ unterscheiden ord‐ zugrunde liegenden Adressaten der jeweil‐ adressatengerecht die
u. Instrumenten der nungs‐,struktur‐ u. Annahmen und igen Texte u. ermitteln zugehörigen Rollen (HK
Wirtschaftspolitik (s. prozesspolitische Ziel‐ Wertvorstellungen Standpunkte u. Inter‐ 2),
auch wirtschaftspoli‐ setzungen u. Maßnah‐ sowie die ökonomi‐ essen der Autoren (MK ‐ nehmen in diskursiven,
tische Konzeptionen): men der Wirtschafts‐ schen, ökologischen u. 1), simulativen u. realen
‐ ordnungspolitische politik (SK 3), sozialen Wirkungen (UK ‐ ermitteln in themen‐ sozialwissenschaftlichen
Ziele u. Maßnahmen 1 – 3) u. aspektgeleiteter Aushandlungsszenarien
(s. z.B. Markt‐ u. Pro‐ ‐analysieren an einem ‐ erörtern die Möglich‐ Untersuchung die Posi‐ einen Standpunkt ein
duktionsabstimmung, Fallbeispiel Interessen keiten u. Grenzen tion u. Argumentation und vertreten eigene
Wettbewerbs‐ u. Ver‐ u. wirtschaftspolitische nationaler Wirtschafts‐ sozialwissenschaftlich Interessen in Abwägung
teilungspolitik, Konzeptionen von politik (UK 5 u. 6), relevanter Texte (…) MK mit den Interessen
‐ strukturpolitische Ziele Arbeitgeberverbänden 5 anderer (HK 4),
u. Maßnahmen (s. z.B. u. Gewerkschaften (SK ‐ stellen themengeleitet ‐ vermitteln eigeneInfrastrukturpolitik, 2) komplexere sozialwis‐ Interessen mit den
Fragen der Sozialord‐ senschaftliche Fallbei‐ Interessen Nah‐ und
nung oder der Förde‐ spiele u. Probleme in Fernstehender u. erwei‐
rung v. Wissenschaft u. ihrer empirischen Di‐ tern die eigene Perspek‐
Technologie, mension u. unter tive in Richtung eines
‐ prozesspolitische Ziele Verwendung passender Allgemeinwohls (HK 7),
u. Maßnahmen (s. z. B. soziologischer, politolo‐
Finanzpolitik, Preispoli‐ gischer u. wirtschafts‐
tik, Einkommenspolitik, wissenschaftlicher Fach‐
Arbeitsmarktpolitik, begriffe, Modelle u.
Theorien dar (M 6),
‐ Interessen und wirt‐ ‐ präsentieren konkrete
schaftspolitische Aus‐ Lösungsmodelle, Alter‐
richtung von Gewerk‐ nativen o. Verbesse‐
schaften u. Arbeitgeber‐ rungsvorschläge zu
verbänden: Abitur 2017: einer konkreten sozial‐
„Auseinandersetzungen wissenschaftlichen Pro‐
im Zusam menhang mit blemstellung (MK 7),
dem Arbeitslohn u. ‐ setzen bei sozialwissen
seiner ge sellschaft‐ schaftlichen Darstellun‐
lichen Bedeutung“ gen inhaltliche u. sprach
liche Distanzmittel zur
Trennung zwischen ei‐
genen u. fremden Posi‐
tionen u. Argumenta‐
tionen ein (MK 10),
‐ ermitteln – auch ver‐
gleichend – Prämissen,
Grundprinzipien, Kon‐
struktion sowie
Abstraktonsgrad u.
Reichweite sozialwissen
schaftlicher Modelle u.Theorien und überprü‐ fen diese auf ihren Erkenntniswert (MK 11), ‐ analysieren sozialwis‐ senschaftlich relevante Situationen u. Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden Perspektiven u. Inter‐ essenlagen sowie ihre Vernachlässigung alter‐ nativer Interessen u. Perspektiven (MK 13), ‐ ermitteln sozialwissen‐ schaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen Ordnung u. deren Veränderung (MK 17), ‐ analysieren wissen‐ schaftliche Modelle u. Theorien im Hinblick auf die hinter ihnen stehen‐ den Erkenntnis‐ u. Ver‐ wertungsinteressen (MK 19),
Inhaltsfeld 4: Wirtschaftspolitik
Inhaltsfeld 7: Globale Strukturen und Prozesse
inhaltliche Schwerpunkte:
4.‐ Legitimation staatlichen Handelns im Bereich der Wirtschaftspolitik
‐ Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
‐ Qualitatives Wachstum und nachhaltige Entwicklung
‐ Bereiche und Instrumente der Wirtschaftspolitik
7 .‐ Merkmale, Dimensionen und Auswirkungen der Globalisierung
‐ Internationale Wirtschaftsbeziehungen
‐ Wirtschaftsstandort Deutschland
Unterrichtsvorhaben: Wirtschaftspolitik (vor dem Hintergrund der Globalisierung)
Sequenz 4:“Wirtschaftspolitische Gestaltungsmöglichkeiten oder ökonomisches Diktat? – Chancen und Grenzen nationaler Wirtschaftspolitik im Kontext
der Globalisierung“
inhaltliche Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/Material
Schwerpunkte
‐ Globalisierung: Begriff, SuS SuS SuS SuS s. Ausführungen zu
Merkmale, Dimensio‐ ‐ erläutern die Dimen‐ ‐ beurteilen Konsequen‐ ‐ analysieren unter‐ ‐ entwerfen für diskur‐ Sequenz 1!
nen u. Auswirkungen, sionen der Globali‐ zen eigenen lokalen schiedliche sozialwis‐ sive u. reale sozialwis‐
sierung am Beispiel Handelns vor dem Hin‐ senschaftliche Text‐ senschaftliche Hand‐
‐ Erläuterung v. a. der aktueller Verände‐ tergrund globaler Pro‐ sorten wie kontinuier‐ lungsszenarien zuneh‐
ökonomischen Dimen‐ rungsprozesse, (SK 2) zesse und eigener so‐ liche u. diskontinu‐ mend komplexe Hand‐
sion der Globali‐ ‐ erläutern die Standort‐ wie fremder Wertvor‐ ierliche Texte (…) (MK lungspläne und über‐
sierung durch Einbezug faktoren des Wirt‐ stellungen (MK 4) 4), nehmen fach‐, situa‐
von Fallbeispielen, schaftsstandorts ‐ erörtern die Konkur‐ ‐ ermitteln in themen‐ tionsbezogen und
Deutschland mit Blick renz von Ländern u. u. aspektgeleiteter Un‐ adressatengerecht
‐Ebenen des Wettbe‐ auf den regionalen, Regionen um die An‐ tersuchung die Posi‐ die zugehörigen Rollen
werbs; harte u. wei‐ europäischen u. glo‐ siedlung v. Unterneh‐ tion u. Argumentation (HK 2),
che Standortfaktoren balen Wettbewerb(SK men im Hinblick auf sozialwissenschaftlich ‐ entwickeln aus der
des Wirtschaftsstand‐ 1, 2) ökonomische, politi‐ relevanter Texte (Text‐ Analyse zunehmendstandorts Deutsch‐ ‐ analysieren an einem sche u. gesellschaft‐ thema, Thesen/Be‐ komplexerer wirtschaft
lands im internatio‐ Fallbeispiel Interessen liche Auswirkungen, hauptungen, Begrün‐ licher, gesellschaft‐
nalen Vergleich, und wirtschaftspoli‐ (MK 4, 5, 6) dungen, dabei insbes. licher u. sozialer Kon‐
tische Konzeptionen ‐ erörtern kontroverse Argumente, Belege u. flikte angemessene
‐ Handlungsspielräume von Arbeitgeberver‐ Positionen zu staat‐ Prämissen, Textlogik, Lösungsstrategien u.
u. Grenzen national‐ bänden und Gewerk‐ lichen Eingriffen in Auf‐ und Abwertungen wenden diese an.
staatlicher Wirtschafts‐ schaften (SK 2, 5), marktwirtschaftlichen ‐ auch unter Berück‐ (HK 3),
politik etwa im Bereich ‐ erläutern die Hand‐ Systemen (MK 1,2,3,6), sichtigung sprachlicher ‐ beteiligen sich ggf.
der Lohnkosten u. Ge‐ lungsspielräume und ‐ erörtern die Möglich‐ Elemente‐, Autoren‐ simulativ an (schul‐)
staltung von Handels‐ Grenzen nationalstaat‐ keiten und Grenzen bzw. Textintention öffentlichen Diskursen
und Finanzströmen, licher Wirtschaftspoli‐ nationaler Wirtschafts‐ (MK 5), (HK 5),
tik angesichts supra‐ politik (MK 5, 6) ‐ stellen themengeleitet ‐ entwickeln politische
nationaler Verflech‐ komplexere sozialwis‐ bzw. ökonomische u.
tungen sowie weltwei‐ schenschaftliche u. soziale Handlungssze‐
ter Krisen (SK 4, 5) Probleme in ihrer em‐ narien u. führen diese
pirischen Dimension u. selbstverantwortlich
Verwendung passen‐ innerhalb bzw. außer‐
der soziologischer, po‐ halb der Schule durch
litologischer u. wirt‐ (HK 6),
schaftswissenschaft‐ ‐ vermitteln eigene In‐
licher Fachbegriffe, teressen mit den Inter‐
Modelle u. Theorien essen Nah‐ und Fern‐
dar (MK 6), stehender u. erweitern
‐ präsentieren konkrete die eigene Perspektive
Lösungsmodelle, Al‐ in Richtung eines All‐
ternativen oder Ver‐ gemeinwohls (HK 7),
besserungsvorschläge ‐
zu einer konkreten
sozialwissenschaft‐
lichen Problemstellung
(MK 7),
‐ stellen fachintegrativ
u. modellierend sozial‐wissenschaftliche Pro‐ bleme unter wirt‐ schaftswissenschaft‐ licher, soziologischer u. politikwissenschaft‐ licher Perspektive dar (M. 8) ‐ analysieren sozialwis‐ senschaftlich relevante Situationen u. Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam wer‐ den Perspektiven u. Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer Interessen u. Perspektiven (MK 13 ‐ identifizieren eindi‐ mensionale u. herme‐ tische Argumentatio‐ nen ohne entwickelte Alternativen (MK 14), ‐ analysieren sozial‐ wissenschaftlich rele‐ vante Situationen u. Texte unter den As‐ pekten d. Ansprüche einzelner Positionen u. Interessen auf die Re‐ präsentation des All‐ gemeinwohls, auf All‐ gemeingültigkeit sowie Wissenschaftlichkeit
(MK 15), ‐ ermitteln sozialwissen‐ schaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ord‐ nung und deren Ver‐ änderung (MK 17),
Inhaltsfeld 5: Europäische Union
inhaltliche Schwerpunkte
‐ EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen (Sequenz 1)
‐ Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union (Sequenz 2)
‐ Europäischer Binnenmarkt (Sequenz 3)
‐ Europäische Integrationsmodelle (Sequenz 4)
‐ Strategien und Maßnahmen europäischer Krisenbewältigung (Sequenz 5a, b)
Sequenz 1: „EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/
Material / Hinweise
Richtlinien, SuS SuS SuS ■ entwickeln aus der
Verordnungen und ihr erläutern das diskutieren anhand analysieren Analyse zunehmend Die Abfolge der
Zustandekommen „Ordentliche eines Beispiels die sozialwissenschaftich komplexerer Sequenzen ist nicht
□ Darstellung der EU‐ Gesetzgebungsverf Legitimität der relevante Situationen wirtschaftlicher, verbindlich.
„Gesetzgebung“ ahren“ der EU Umsetzung einer EU‐ u. Texte im Hinblick gesellschaftlicher u.
Richtlinie auf die in ihnen sozialer Konflikte Buch: „Sowi NRW“
Die Organe der EU erörtern die Legitimität wirksam werdenden angemessene Kapitel 6 (S. 166ff.),
□ Darstellung der und Effizienz der EU im Perspektiven u. Lösungsstrategien u. „Die Europäische
Zusammensetzung und Hinblick auf die Rolle Interessenlagen sowie wenden diese an (HK 3), Union“ (Buchner: S.
der Kompetenzen des / der einzelnen ihre Vernachlässigung 76ff.)
der Instituionen alternativer ■ vermitteln eigene
Europäischen Interessen u. Interessen mit den Aspekte zur
Rates d. Staats‐ Perspektiven (MK 13) Interessen Nah‐ und Leistungsbewertung:
/Regierungschefs analysieren sozial‐ Fernstehender und ‐ zwei dreistündige
Europäischen wissenschaftlich rele‐ erweitern die eigene Klausuren pro Halbjahr
Kommission vante Situationen u. Perspektive in Richtung bei Schriftlichkeit,
Europäischen Texte unter den As‐ eines Allgemeinwohls ‐ Bewertung mittels
Parlaments pekten d. Ansprüche (HK7). ausgearbeitetem Be‐ Ministerrrats einzelner Positionen u. wertungsbogen,
(Rates der EU) Interessen auf die Re‐ ‐ Berücksichtigung der
EuGH präsentation des All‐ schriftlichen
gemeinwohls, auf All‐ Dimension im Rahmen
gemeingültigkeit sowie der Bewertung der
Wissenschaftlichkeit sonstigen Mitarbeit
(MK 15), durch mindestens eine
Analyse oder eine
schriftliche Übung.
Inhaltlich‐methodische
Absprachen:
‐ modellartige u. reale
Entwicklungen berück‐
sichtigen,
‐ Ausbau der
Fachterminologie
und des
Methodenrepertoires,
‐ OperatorenübungenInhaltsfeld 5: Europäische Union
inhaltliche Schwerpunkte
‐ EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen (Sequenz 1)
‐ Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union (Sequenz 2)
‐ Europäischer Binnenmarkt (Sequenz 3)
‐ Europäische Integrationsmodelle (Sequenz 4)
‐ Strategien und Maßnahmen europäischer Krisenbewältigung (Sequenz 5a, b)
Sequenz 2: Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union: Ein Friedensprojekt?
inhaltliche Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/
Schwerpunkte Material / Hinweise
Stationen des SuS SuS SuS Sus Buch: „Sowi NRW“
europäischen erläutern die bewerten die führen die MK 5, Mk ■ vermitteln eigene Kapitel 5 (S. 141ff.);
Einigungsprozesses Frieden stiftende europäische 5 und MK 9 fort Interessen mit den siehe auch
sowie Freiheiten Integration unter den erschließen Interessen Nah‐ und Ausführungen zu
Darstellung und Kriterien der fragegeleitet in Fernstehender und Sequenz Nr. 1
verschiedener Menschenrechte Sicherung von selbstständiger erweitern die eigene
Phasen des sichernde Funktion Frieden und Recherche aus Perspektive in Richtung
Integrationsprozess der europäischen Freiheiten der EU‐ sozialwissenschaftlich eines Allgemeinwohls
es Integration nach Bürger relevanten Textsorten (HK7)
Exemplarische dem Zweiten zentrale Aussagen
Darstellung des Weltkrieg und Positionen sowie
Vertrages von beschreiben und Intentionen und
Lissabon erläutern zentrale mögliche Adressaten
im Hinblick auf Stationen und der jeweiligen Texte
einen Wandel von Dimensionen des und ermitteln
einer Wirtschafts‐ europäischen Standpunkte und
zu einer Integrationsprozess Interessen der
Wertegemeinschaft es Autoren (MK1)
Zuordnung
einzelnerVertragsbestimmun
gen zu
Integrationstheorie
n und Szenarien (s.
Sequenz 4)
Friedensnobelpreis an
die EU – Für und Wider
Erörterung der
Positionen und
Argumente zur
Berechtigung der
EU, den Nobelpreis
zu erhaltenInhaltsfeld 5: Europäische Union
inhaltliche Schwerpunkte
‐ EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen (Sequenz 1)
‐ Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union (Sequenz 2)
‐ Europäischer Binnenmarkt (Sequenz 3)
‐ Europäische Integrationsmodelle (Sequenz 4)
‐ Strategien und Maßnahmen europäischer Krisenbewältigung (Sequenz 5a, b)
Inhaltsfeld 5: Europäische Union
Sequenz 3: „Der europäische Binnenmarkt – ein primär ökonomisches Projekt?“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/
Material / Hinweise
Die vier SuS SuS SuS SuS
Grundfreiheiten des ■ ermitteln in ■führen die MK 5, Mk 5 ■ entwickeln aus der Die Abfolge der
Binnenmarkts als Kern ■ erläutern die vier Argumentationen und MK 9 fort Analyse zunehmend Sequenzen ist nicht
des Integrations‐ Grundfreiheiten des Positionen bzw. Thesen ■ erschließen fragegeleitet komplexerer verbindlich.
EU‐Binnenmarkts und ordnen diesen in selbstständiger wirtschaftlicher,
prozesses
aspektgeleitet Recherche aus gesellschaftlicher u. Buch: „Sowi NRW“
Argumente und Belege zu sozialwissenschaftlich sozialer Konflikte Kapitel 7 (ab S. 205ff.),
□ Darstellung der vier (UK1), relevanten Textsorten angemessene „Die Europäische
Freiheiten des zentrale Aussagen und Lösungsstrategien u. Union“ (Buchner: S.
Binnenmarkts ■ bewerten den Positionen sowie wenden diese an (HK 3), 76ff.)
Binnenmarkt als Teil der Intentionen und mögliche
Wirtschafts‐ und europäischen Integration Adressaten der jeweiligen ■ nehmen u.U. (Zeit!!!) Aspekte zur
Währungsunion – die unter den Kriterien der Texte und ermitteln in diskursiven, Leistungsbewertung:
■ erläutern die WWU
Fortsetzung der Sicherung des Friedens und Standpunkte und simulativen und realen ‐ zwei dreistündige
im Hinblick auf
wirtschaftlichen Freiheiten der EU‐ Interessen der Autoren sozialwissenschaftlichen Klausuren pro Halbjahr
Teilnehmer, Stufen,
Vergemeinschaftung Bürger/innen. (MK1), Aushandlungsszenarien bei Schriftlichkeit,
Zielsetzung.
□ Darstellung und ■ analysieren einen Standpunkt ein ‐ Bewertung mittelsErläuterung der ■ arbeiten heraus, in unterschiedliche und vertreten eigene ausgearbeitetem Be‐
Zielsetzung und der welchem sozialwissenschaftliche Interessen in Abwägung wertungsbogen,
sechsstufigen Zusammenhang die Textsorten wie mit den Interessen ‐ Berücksichtigung der
Integrationsschritte WWU zu den vier kontinuierliche anderer (HK4), schriftlichen
Freiheiten steht. und diskontinuierliche Dimension im Rahmen
□ Herausarbeitung der Texte (u. a. positionale und ■ vermitteln eigene der Bewertung der
Zusammenhänge fachwissenschaftliche Interessen mit den sonstigen Mitarbeit
zwischen Binnenmarkt Texte, Fallbeispiele, Interessen Nah‐ und durch mindestens eine
und WWU Statistiken, Karikaturen Fernstehender und Analyse oder eine
sowie andere erweitern die eigene schriftliche Übung.
Schengener Medienprodukte) aus Perspektive in Richtung
■ erläutern die das sozialwissenschaftlichen eines Allgemeinwohls
Übereinkommen: der Schengener Überein‐ Perspektiven (MK4), (HK7). Inhaltlich‐methodische
Abbau der kommen im Hinblick Absprachen:
Grenzkontrollen als auf Teilnehmer,
notwendige Basis des Voraussetzungen, ‐ modellartige u. reale
freien Regelungen, Entwicklungen berück‐
Personenverkehrs? Sicherheit‐ sichtigen,
□ Darstellung der ■ analysieren ‐ Ausbau der
europäische politische Fachterminologie
zentralen Teilaspekte:
Entscheidungssituatio und des
* Historie
nen im Hinblick auf Methodenrepertoires,
* Schengenraum
den Gegensatz
* SIS ‐ Schengener
nationaler ‐ Operatorenübungen
Informationssystem
Einzelinteressen und
* Schengenbesitzstand
europäischer
Gesamtinteressen.
Erörterung des ■ beurteilen exemplarisch
Binnenmarkts politische, soziale und
□ Erläuterung und ökonomische
Bewertung der Entscheidungen aus der
Auswirkungen und Perspektive von
Relevanz der vier (politischen) Akteuren,Freiheiten des Adressaten und Systemen
Binnenmarkts für die (UK 4),
Bürger, die EU‐Staaten, hier konkret z.B. die
die Wirtschaft Forderung nach offenen
(>>> vgl. UK 4) Grenzen aufgrund der
hohen Kosten für die
□ EU‐Binnemarkt – ein Wirtschaft im Gegensatz zu
bislang unvollendetes geschlossenen Grenzen zur
Projekt: Erörterung der Eindämmung der
Umsetzungsdefizite und einreisenden Flüchtlinge
Diskussion der Grenzen
und AuswirkungenInhaltsfeld 5: Europäische Union
inhaltliche Schwerpunkte
‐ EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen (Sequenz 1)
‐ Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union (Sequenz 2)
‐ Europäischer Binnenmarkt (Sequenz 3)
‐ Europäische Integrationsmodelle (Sequenz 4)
‐ Strategien und Maßnahmen europäischer Krisenbewältigung (Sequenz 5a, b)
Inhaltsfeld 5: Europäische Union
Sequenz 4: „Europäische Integrationsmodelle: Perspektiven einer vertieften und erweiterten EU“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/
Material / Hinweise
Die EU – ein exklusiver SuS SuS SuS SuS
Kreis oder ein ■ ermitteln in ■führen die MK 5, Mk 5 ■ entwickeln aus der Die Abfolge der
grundsätzlich offener ■ beschreiben und Argumentationen und MK 9 fort Analyse zunehmend Sequenzen ist nicht
Raum? erläutern zentrale Positionen bzw. Thesen komplexerer verbindlich.→ Unter
Stationen und und ordnen diesen ■ erschließen fragegeleitet wirtschaftlicher, Umständen kann diese
Dimensionen des aspektgeleitet in selbstständiger gesellschaftlicher u. Sequenz auch erst den
europäischen Argumente und Belege zu Recherche aus sozialer Konflikte Abschluss der
□ ggf. Integrationsprozesses. (UK1), sozialwissenschaftlich angemessene Gesamtreihe bilden, da
Begriffsabgrenzung relevanten Textsorten Lösungsstrategien u. die zukünftige Gestalt
Integrationsweite/ ‐tiefe zentrale Aussagen und wenden diese an (HK 3), der EU leichter vor dem
Positionen sowie Hintergrund bestimmter
Das Beitrittsverfahren: Intentionen und mögliche ■ nehmen u.U. (Zeit!!!) (z.T. erfolgloser)
Adressaten der jeweiligen in diskursiven, Krisenbewältigungen
□ Motive für einen EU‐ Texte und ermitteln simulativen und realen Eingeschätzt werden
Beitritt Standpunkte und sozialwissenschaftlichen kann.
□ Kriterien: Interessen der Autoren Aushandlungsszenarien
Kopenhagener Kriterien/ (MK1), einen Standpunkt einArt. 49 EUV und vertreten eigene Buch: „Sowi NRW“
□ Status: ■ analysieren Interessen in Abwägung Kapitel 5.3 & 5.4, Seite
Bewerberländer & unterschiedliche mit den Interessen 150ff.
aktuelle sozialwissenschaftliche anderer (HK4),
Beitrittskandidaten Textsorten wie
kontinuierliche ■ vermitteln eigene Aspekte zur
□ Verfahren: Schritte des und diskontinuierliche Interessen mit den Leistungsbewertung:
Beitrittsverfahrens
Texte (u. a. positionale und Interessen Nah‐ und ‐ zwei dreistündige
fachwissenschaftliche Fernstehender und Klausuren pro Halbjahr
Der Türkeibeitritt: Texte, Fallbeispiele, erweitern die eigene bei Schriftlichkeit,
Politisches Kalkül oder ■ ordnen einen ■ bewerten die
Statistiken, Karikaturen Perspektive in Richtung ‐ Bewertung mittels
willkommener konkreten Fall (Türkei) europäische Integration
sowie andere eines Allgemeinwohls ausgearbeitetem Be‐
in ihr bisheriges unter den Kriterien der
Kandidat? Medienprodukte) aus (HK7). wertungsbogen,
Wissen ein Sicherung von Frieden und
sozialwissenschaftlichen ‐ Berücksichtigung der
und analysieren diesen Freiheiten der EU‐Bürger.
□ Zusammenfassung der Perspektiven (MK4) schriftlichen Dimension
weiterführend.
Beitrittsverhandlungen im Rahmen der
mit der Türkei Bewertung der
sonstigen Mitarbeit
durch mindestens eine
□ Erarbeitung und Analyse oder eine
Diskussion der Motive für ■ erörtern Chancen und
schriftliche Übung.
einen EU‐Beitritt der Probleme einer EU‐
Türkei aus Sicht der Erweiterung.
Türkei und der EU Inhaltlich‐methodische
Absprachen:
□ Vergleich und
Beurteilung ‐ modellartige u. reale
unterschiedlicher Entwicklungen berück‐
Positionen zum sichtigen,
Türkeibeitritt
‐ Ausbau der
Fachterminologie
und desMethodenrepertoires,
Die Zukunft der EU:
Die Vereinigten ‐ Operatorenübungen
Staaten von Europa –
■ beurteilen die
oder die Rückkehr zum
Vorgehensweise
Nationalstaat? europäischer Akteure im
Hinblick auf die
Die Vereinigten Staaten Handlungsfähigkeit der EU → Hinweis:
von Europa als Fernziel?
(z.B. Fischers Humboldt‐
ggf. Rückbezug zur
Rede)
Sequenz 5 bzw.
Vorziehen der 4.
Mögliche Szenarien
Sequenz: Lösung
unterschiedlicher
aktueller europäischer
Integrationsweite und –
Krisen am Beispiel der
tiefe
durch nationalstaatliche
□ CAP‐Szenarien Interessen und
mangelnde Solidarität
und Kooperations‐
Ein Europa der zwei bereitschaft bedingte
Geschwindigkeiten als Reduktion der EU auf
einzig gangbarer Weg? ein progressives
□ Abschlussbeurteilung Kerneuropa
des (zukünftigen)
IntegrationsprozessesInhaltsfeld 5: Europäische Union
inhaltliche Schwerpunkte
‐ EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen (Sequenz 1)
‐ Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union (Sequenz 2)
‐ Europäischer Binnenmarkt (Sequenz 3)
‐ Europäische Integrationsmodelle (Sequenz 4)
‐ Strategien und Maßnahmen europäischer Krisenbewältigung (Sequenz 5a, b)
Inhaltsfeld 5: Europäische Union
Sequenz 5a: „Eurokrise ‐ Gemeinsame Finanz‐ und Wirtschaftspolitik: Bewältigung oder Verschärfung der Krise?“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/
Material / Hinweise
Die Entwicklung der SuS SuS SuS SuS Buch: „Sowi NRW“,
Eurokrise analysieren an beurteilen die führen die MK 5, Mk ■ entwickeln aus der Kapitel 7.3, S. 218 ff.;
Darstellung der einem Vorgehensweise 5 und MK 9 fort Analyse zunehmend Siehe auch
Entwicklung in den Fallbeispiel europäischer erheben fragen‐ und komplexerer Ausführungen zu
Krisenstaaten – ein Erscheinungen, Akteure im hypothesengeleitet wirtschaftlicher, Sequenz 1
Beispiel! ‐ und Ursachen und Hinblick auf die Daten und gesellschaftlicher u.
Maßnahmen: Strategien zur Handlungsfähigkeit Zusammenhänge sozialer Konflikte
→Griechenlandhilfe Lösung aktueller der EU durch empirische angemessene
→EFSF europäischer ermitteln in Methoden der Lösungsstrategien u.
→ESM Krisen. Argumentationen Sozialwissenschaft wenden diese an (HK 3)
→Fiskalunion . Positionen bzw. en und wenden
→ggf. „Sixpack“ Thesen und ordnen statistische
diesen Verfahren an
„Rettungsschirme“ und aspektgeleitet (MK2)
Fiskalunion: Argumente und
Wachstumsfeindliche Belege zu (UK1)Austeritätspolitik? Exemplarische Beschreibung der EU‐ Haushaltspolitik Zuordnung dieser Politik zu einer wirtschaftspolitischen Konzeption Exemplarische Darstellung und Analyse der wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Entwicklung der Eurozone seit 2010 Erörterung der Chancen und Gefahren der „Austeritätspolitik“
Inhaltsfeld 5: Europäische Union
inhaltliche Schwerpunkte
‐ EU‐Normen, Interventions‐ und Regulationsmechanismen sowie Institutionen (Sequenz 1)
‐ Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union (Sequenz 2)
‐ Europäischer Binnenmarkt (Sequenz 3)
‐ Europäische Integrationsmodelle (Sequenz 4)
‐ Strategien und Maßnahmen europäischer Krisenbewältigung (Sequenz 5a, b)
Inhaltsfeld 5: Europäische Union
Sequenz 5b: „Migration als Zerreißprobe für die EU‐ nationalstaatliche Interessen anstelle europäischer Regelungen?“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenzen Vereinbarungen/
Material / Hinweise
Die verschiedenen SuS SuS SuS SuS
Formen von Migration ■ ermitteln in ■führen die MK 5, Mk 5 ■ entwickeln aus der → Hinweis:
■ erläutern die Argumentationen und MK 9 fort Analyse zunehmend Bei den präzisierten
□ Beschreibung der verschiedenen Formen Positionen bzw. Thesen ■ erschließen fragegeleitet komplexerer Vorgaben für das
von und Motive für und ordnen diesen in selbstständiger wirtschaftlicher, Zentralabitur 2017 steht
verschiedenen Formen
Auswanderung. aspektgeleitet Recherche aus gesellschaftlicher u. ausschließlich die
von Migration
Argumente und Belege zu sozialwissenschaftlich sozialer Konflikte folgende Ergänzung:
(Wirtschaftsmigration/
(UK1), relevanten Textsorten angemessene „Auseinandersetzung
Armutsflüchtlinge),
zentrale Aussagen und Lösungsstrategien u. über die
Asylbewerber,
Positionen sowie wenden diese an (HK 3), Staatsverschuldung, die
Blue‐Card‐Migration,
Intentionen und mögliche Schuldenbremse,
Binnenmigration.
Adressaten der jeweiligen ■ nehmen u.U. (Zeit!!!) alternative
(> Schengen) Emigration/
Texte und ermitteln in diskursiven, Bewältigungsmöglichkei
Immigration) und der
Standpunkte und simulativen und realen ten“.
Motive für Emigration
Interessen der Autoren sozialwissenschaftlichen(MK1), z.B. insbesondere Aushandlungsszenarien
Zuwanderung als im Hinblick auf die einen Standpunkt ein
unterschiedlichen Zahlen und vertreten eigene
Chance oder
zur Zuwanderung, die Interessen in Abwägung Die Abfolge der
Belastung?
verwendeten Begriffe, den mit den Interessen Sequenzen ist nicht
vermittelten Kontexte und anderer (HK4), verbindlich.
Zur aktuellen Lage: Folgen
Flüchtlingskrise, ‐ströme ■ analysieren ■ vermitteln eigene
‐ oder leistbare unterschiedliche Interessen mit den Aspekte zur
Herausforderung? sozialwissenschaftliche Interessen Nah‐ und Leistungsbewertung:
Eine Bürde für die ■ ermitteln aktuelle
Textsorten wie Fernstehender und ‐ zwei dreistündige
Sozialsysteme – oder Daten zur Migration in
kontinuierliche erweitern die eigene Klausuren pro Halbjahr
langfristige Entlastung? die EU bzw. nach
und diskontinuierliche Perspektive in Richtung bei Schriftlichkeit,
Zukünftige Leistungs‐ Deutschland.
Texte (u. a. positionale und eines Allgemeinwohls ‐ Bewertung mittels
empfänger – oder fachwissenschaftliche (HK7). ausgearbeitetem Be‐
Leistungsträger? Texte, Fallbeispiele, wertungsbogen,
□ Zusammenfassung und Statistiken, Karikaturen ‐ Berücksichtigung der
Auswertung sowie andere schriftlichen
verschiedener Medienprodukte) aus Dimension im Rahmen
Materialien und Quellen sozialwissenschaftlichen der Bewertung der
zum Umfang der Perspektiven (MK4), sonstigen Mitarbeit
Migrationsströme, der durch mindestens eine
■ beurteilen exemplarisch Analyse oder eine
Nationalität der
politische, soziale und schriftliche Übung.
Emigranten, zum Alter,
ökonomische
Geschlecht, dem
Entscheidungen aus der
Bildungsstand, der
Perspektive von Inhaltlich‐methodische
Verteilung in der EU
(politischen) Akteuren, Absprachen:
(>>> vgl. MK 1)
Adressaten und Systemen
■ erschließen die (UK 4),
□ Zusammenfassung und ‐ modellartige u. reale
Auswirkungen des GG hier konkret z.B. eine
Erläuterung EU‐weiter Entwicklungen berück‐
Art. 16a und der Kampagne der Arbeitgeber
bzw. nationaler sichtigen,
Dublin‐Verordnung für zur Beschäftigung von
Regelungen, u.a. die Länder, die EU, den Flüchtlingen, für eineDublin III/ Dublin‐ Migranten. Ausnahmeregelung beim ‐ Ausbau der
Verordnung; GG Art. 16a, Mindestlohn oder die Fachterminologie
sowie Ermittlung der ungleiche Verteilung auf und des
damit verbundenen (Bundes‐)Länder oder Methodenrepertoires,
Auswirkungen für die Regionen.
Länder, die EU, den ‐ Operatorenübungen
Migranten.
■ ordnen einen
□ Analyse eines konkreten Fall in ihr
Fallbeispiels: bisheriges Wissen ein
Migrationsursachen, ‐ und analysieren diesen
weg, ‐ziel, ‐verfahren… weiterführend.
Festung Europa:
Wie soll die EU mit
dem Ausmaß an
Flüchtlingen
umgehen?
□ Beschreibung des
Grenzregimes der EU,
Vertiefung bestimmter
■ beurteilen die
□ Einordnung der
Vorgehensweise
(aktuellen) Maßnahmen
europäischer Akteure im
einzelner EU‐Staaten
Hinblick auf die
zum Schutz der eigenen
Handlungsfähigkeit der EU
Grenzen, zur Abwehr von
Flüchtlingen oder zum
Schutze dieser
Flüchtlingskrise alsZerreißprobe? □ Einordnung und Beurteilung der (aktuellen) Maßnahmen auf EU‐Ebene, z.B. Vorschlag der Kommission zu einer einheitlichen Flüchtlingspolitik, die Idee eines Verteilungsschlüssels
Inhaltsfeld 6 : Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung
Inhaltliche Schwerpunkte:
‐ Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
‐ Sozialer Wandel
‐ Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit
‐ Sozialstaatliches Handeln
Inhaltsfeld 6 : Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung
Sequenz 1: Theorien und Modelle der sozialen Ungleichheit – „oben“ und „unten“ oder fast alles gleich?
Inhaltliche Sachkompetenz Urteilskompetenz Methodenkompetenz Handlungskompetenz Vereinbarungen/Materialien
Schwerpunkte SuS… SuS… SuS… SuS…
Dimensionen sozialer unterscheiden beurteilen die werten fragegeleitet entwickeln aus der Sukzessive
Ungleichheit Dimensionen sozialer politische und Daten und deren Analyse zunehmend Erweiterung der
Ungleichheit und ihre ökonomische Aufbereitung im komplexerer Fachkenntnisse und deren
Indikatoren Verwertung von Hinblick auf wirtschaftlicher, Transfer im Sinne des
Ergebnissen der Datenquellen, Aussage‐ gesellschaftlicher und
Spiralcurriculums
Ungleichheitsforschu und Geltungsbereiche, sozialer Konflikte
• Analyse von
ng Darstellungsarten, angemessene
Trends, Korrelationen Lösungsstrategien und Sachtexten
Modelle sozialer beschreiben Tendenzen beurteilen die und Gesetzmäßigkeiten wenden diese an (HK3)
Ungleichheit des Wandels der Reichweite von aus und überprüfen nehmen in diskursiven, Material
Sozialstruktur in Modellen sozialer diese bezüglich ihrer simulativen und realen • eingeführtes
Deutschland, auch Ungleichheit im Gültigkeit für die sozialwissenschaftliche Fachbuch
unter der Perspektive Hinblick auf die Ausgangsfrage (MK3) n • Kopien aus
der Realisierung von Abbildung von setzen bei Aushandlungsszenarie ausgewählten Lehrwerken
gleichberechtigten Wirklichkeit und sozialwissenschaftliche n einen Standpunkt ein und aus Fachliteratur
Lebensverlaufsperspekti ihren Erklärungswert n Darstellungen und vertreten eigene
ven für Frauen und inhaltliche und Interessen in
Männer sprachliche Abwägung mit den
erläutern Grundzüge Distanzmittel zur Interessen andererund Kriterien von Trennung zwischen (HK4)
Modellen vertikaler eigenen und fremden beteiligen sich, ggf.
und horizontaler Positionen und simulativ, an (schul‐
Ungleichheit Argumentationen ein )öffentlichen Diskursen
(MK10) (HK5)
ermitteln typische vermitteln eigene
Versatzstücke Interessen mit den
ideologischen Denkens Interessen Nah‐ und
(u. a. Vorurteile und Fernstehender und
Stereotypen, erweitern die eigene
Ethnozentrismen, Perspektive in
Chauvinismen, Richtung eines
Rassismus, Allgemeinwohls (HK7)
Biologismus) (MK18)
Sequenz 2: Einkommens‐ und Vermögensverteilung in Deutschland – werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer?
Inhaltliche Sachkompetenz Urteilskompetenz Methodenkompetenz Handlungskompetenz Vereinbarungen/Materialien
Schwerpunkte SuS… SuS… SuS… SuS…
Armut – ein Problem für beschreiben Tendenzen beurteilen die erschließen praktizieren im Sukzessive
Deutschland? des Wandels der politische und fragegeleitet in Unterricht Erweiterung der
Sozialstruktur in ökonomische selbstständiger selbstständig Formen Fachkenntnisse und deren
Deutschland, auch Verwertung von Recherche aus demokratischen Transfer im Sinne des
unter der Perspektive Ergebnissen der sozialwissenschaftlich Sprechens und
Spiralcurriculums
der Realisierung von Ungleichheitsforsch relevanten Textsorten demokratischer
• Analyse von
gleichberechtigten ung zentrale Aussagen und Aushandlungsprozesse
Lebensverlaufsperspekti Positionen sowie und übernehmen Sachtexten
beurteilen
ven für Frauen und unterschiedliche Intentionen und dabei Verantwortung
Männer mögliche Adressaten für ihr Handeln (HK1) Material
Zugangschancen zu
analysieren alltägliche der jeweiligen Texte entwerfen für • eingeführtes
Ressourcen und
Lebensverhältnisse und ermitteln diskursive, simulative Fachbuch
deren
mithilfe der Modelle Standpunkte und und reale • Kopien aus
Legitimationen vor
und Konzepte sozialer Interessen der Autoren sozialwissenschaftlich ausgewählten Lehrwerken
dem Hintergrund
Ungleichheit (MK1) e Handlungsszenarien und aus Fachliteratur
desSozialstaatsgebots analysieren zunehmend komplexe
und des Gebots des unterschiedliche Handlungspläne und
Grundgesetzes zur sozialwissenschaftliche übernehmen fach‐,
Herstellung Textsorten wie situationsbezogen und
gleichwertiger kontinuierliche und adressatengerecht die
Lebensverhältnisse diskontinuierliche zugehörigen Rollen
Texte (u. a. positionale (HK2)
beurteilen und vermitteln eigene
Die Einkommens‐ und erläutern aktuell Tendenzen sozialen fachwissenschaftliche Interessen mit den
Vermögensverteilung in diskutierte Begriffe und Wandels aus der Texte, Fallbeispiele, Interessen Nah‐ und
Deutschland Bilder sozialen Wandels Sicht ihrer Statistiken, Fernstehender und
sowie eigene zukünftigen sozialen Karikaturen sowie erweitern die eigene
Gesellschaftsbilder Rollen als abhängig andere Perspektive in
analysieren alltägliche Arbeitende bzw. Medienprodukte) aus Richtung eines
Lebensverhältnisse Unternehmerin und sozialwissenschaftliche Allgemeinwohls (HK7)
mithilfe der Modelle und Unternehmer n Perspektiven (MK4)
Konzepte sozialer beurteilen die analysieren
Ungleichheit politische und wissenschaftliche
ökonomische Modelle und Theorien
Verwertung von im Hinblick auf die
Ergebnissen der hinter ihnen
Ungleichheitsforschu stehenden Erkenntnis‐
ng und
Verwertungsinteressen
(MK19)
Sequenz 3: Der Sozialstaat in Deutschland – nur das Nötigste oder das „sozial Gerechte“?
Inhaltliche Sachkompetenz Urteilskompetenz Methodenkompetenz Handlungskompetenz Vereinbarungen/Materialien
Schwerpunkte SuS… SuS… SuS… SuS…
Grundlagen des erläutern beurteilen werten fragegeleitet entwickeln aus der Sukzessive
Sozialstaats – was ist Grundprinzipien unterschiedliche Daten und deren Analyse zunehmend Erweiterung der
heute sozial? staatlicher Zugangschancen zu Aufbereitung im komplexererSozialpolitik und Ressourcen und Hinblick auf wirtschaftlicher, Fachkenntnisse und deren
Sozialgesetzgebung deren Legitimationen Datenquellen, Aussage‐ gesellschaftlicher und Transfer im Sinne des
vor dem Hintergrund und Geltungsbereiche, sozialer Konflikte Spiralcurriculums
des Darstellungsarten, angemessene • Analyse von
Sozialstaatsgebots Trends, Korrelationen Lösungsstrategien und
Sachtexten
und des Gebots des und Gesetzmäßigkeiten wenden diese an (HK3)
Grundgesetzes zur aus und überprüfen nehmen in diskursiven,
Material
Herstellung diese bezüglich ihrer simulativen und realen
• eingeführtes
gleichwertiger Gültigkeit für die sozialwissenschaftliche
Fachbuch
Lebensverhältnisse Ausgangsfrage (MK3) n
• Kopien aus
analysieren Aushandlungsszenarien
ausgewählten Lehrwerken
sozialwissenschaftlich einen Standpunkt ein
und aus Fachliteratur
Der Sozialstaat im Alltag analysieren beurteilen relevante Situationen und vertreten eigene
– Probleme, Ziele und alltägliche Tendenzen sozialen und Texte im Hinblick Interessen in
Grenzen staatlicher Lebensverhältnisse Wandels aus der auf die in ihnen Abwägung mit den
Maßnahmen mithilfe der Modelle Sicht ihrer wirksam werdenden Interessen anderer
und Konzepte zukünftigen sozialen Perspektiven und (HK4)
sozialer Ungleichheit Rollen als abhängig Interessenlagen sowie beteiligen sich, ggf.
erläutern Arbeitende bzw. ihre Vernachlässigung simulativ, an (schul‐
Grundprinzipien Unternehmerin und alternativer Interessen )öffentlichen Diskursen
staatlicher Unternehmer und Perspektiven (HK5)
Sozialpolitik und beurteilen die (MK13) entwickeln politische
Sozialgesetzgebung politische und bzw. ökonomische und
ökonomische soziale
Verwertung von Handlungsszenarien
Ergebnissen der und führen diese
Ungleichheitsforschu selbstverantwortlich
ng innerhalb bzw.
außerhalb der Schule
durch (HK6)
Der Sozialstaats am unterscheiden beurteilen
Beispiel der Dimensionen Tendenzen sozialen
Rentenversicherung – sozialer Ungleichheit Wandels aus der
finanzierbar und gerecht? und ihre Indikatoren Sicht ihrer
erläutern zukünftigen sozialen
Grundprinzipien Rollen als abhängigstaatlicher Arbeitende bzw. Sozialpolitik und Unternehmerin und Sozialgesetzgebung Unternehmer analysieren an einem Beispiel sozialstaatliche Handlungskonzept e im Hinblick auf normative und politische Grundlagen, Interessengebunde nheit sowie deren Finanzierung
Inhaltsfeld 7: Globale Strukturen und Prozesse
inhaltliche Schwerpunkte:
‐ Internationale Friedens‐ und Sicherheitspolitik
‐ Beitrag der UN zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung
‐ Internationale Bedeutung von Menschenrechten und Demokratie
‐ Merkmale, Dimensionen und Auswirkungen der Globalisierung
‐ Internationale Wirtschaftsbeziehungen
‐ Wirtschaftsstandort Deutschland
Inhaltsfeld 7: Globale Strukturen und Prozesse
Sequenz 1: „Globalisierung II: Globalisierung – weit mehr als Standortwettbewerb und McDonaldization“
inhaltliche Schwerpunkte Sachkompetenzen Urteilskompetenzen Methodenkompetenzen Handlungskompetenze Vereinbarungen/
n Material/ Hinweise
SuS SuS SuS SuS
Globalisierung – weit ■ analysieren komplexere ■ ermitteln ■ führen die MK 5, MK 5 ‐entwickeln aus der Die Abfolge der
mehr als gesellschaftliche Argumentationen und MK 9 fort Analyse zunehmend Sequenzen ist nicht
Standortwettbewerb Bedingungen (SK1), Positionen bzw. Thesen erschließen fragegeleitet in komplexerer verbindlich; aufgrund
■ erläutern komplexere und ordnen diesen selbstständiger Recherche (wirtschaftlicher,) der geforderten Bezüge
und McDonaldization
politische, ökonomische aspektgeleitet aus sozialwissenschaftlich gesellschaftlicher u. bietet sich der Start mit
und soziale Strukturen, Argumente und Belege relevanten Textsorten sozialer Konflikte dieser Sequenz 1
□ poli sche, soziale/
Prozesse, Probleme und zu (UK1), zentrale Aussagen und angemessene „Globalisierung“ an.
gesellschaftliche und
Konflikte unter den ■ ermitteln in Positionen sowie Lösungsstrategien u.
ökonomische Dimensionen
Bedingungen von Argumentationen Intentionen und mögliche wenden diese an (HK
der Globalisierung am
Globalisierung, Positionen und Adressaten der jeweiligen 3), Die Sequenz gilt als
Beispiel aktueller
(ökonomischen und Gegenpositionen und Texte und ermitteln zweite Einheit zur
Veränderungsprozesse
ökologischen Krisen sowie stellen die Standpunkte und Interessen ■ entwerfen für Globalisierung, da in
von Krieg und Frieden) zugehörigen der Autoren (MK1), diskursive, simulative der Q1.1 bereits die
(SK2), Argumentationen ■ werten fragegeleitet und reale Merkmale und
□ Analyse derAuswirkungen der ■ erläutern die antithetisch gegenüber Daten und deren sozialwissenschaftliche Indikatoren der
Globalisierung auf Dimensionen der (UK2), Aufbereitung im Hinblick auf Handlungsszenarien ökonomischen
politischer, ökologischer, Globalisierung am Beispiel ■ entwickeln auf der Datenquellen, Aussage‐ und zunehmend komplexe Globalisierung sowie
gesellschaftlicher und aktueller Veränderungs‐ Basis der Analyse der Geltungsbereiche, Handlungspläne und Standortfaktoren und
wirtschaftlicher Ebene , u. prozesse, jeweiligen Interessen‐ Darstellungsarten, Trends, übernehmen fach‐, Standortwettbewerb
a. Migration, Klimawandel, ■ analysieren politische, und Perspektivleitung Korrelationen und situationsbezogen thematisiert wurden.
nachhaltige Entwicklung gesellschaftliche und der Argumentation Gesetzmäßigkeiten aus und und adressatengerecht
(>> Rückbezug zur Q1.1!) wirtschaftliche Urteilskriterien und überprüfen diese bezüglich die zugehörigen Rollen
Auswirkungen der formulieren abwägend ihrer Gültigkeit für die (HK2),
Globalisierung (u. a. kriteriale Ausgangsfrage (MK3). Aspekte zur Leistungs‐
Aspekte der Migration, Klimawandel, selbstständige Urteile ■ analysieren ■ entwickeln politische bewertung:
ökonomischen nachhaltige Entwicklung), (UK3), unterschiedliche bzw. ökonomische und ‐ zwei dreistündige
Dimension der ■ beurteilen politische, sozialwissenschaftliche soziale Klausuren pro Halbjahr
Globalisierung ■ analysieren komplexere soziale und Textsorten wie Handlungsszenarien bei Schriftlichkeit,
Veränderungen ökonomische kontinuierliche und ‐ Bewertung mittels
□ Ursachen für die gesellschaftlicher Entscheidungen aus der und diskontinuierliche Texte führen diese ausgearbeitetem Be‐
zunehmende weltweite Strukturen und Perspektive (u. a. positionale und selbstverantwortlich wertungsbogen,
wirtschaftliche Lebenswelten sowie darauf von (politischen) fachwissenschaftliche innerhalb bzw. ‐ Berücksichtigung der
Verflechtung (>> bezogenes Handeln des Akteuren, Adressaten Texte, Fallbeispiele, außerhalb der Schule schriftlichenDimension
Rückbezug zur Q1.1) Staates und von und Systemen (UK4), Statistiken, Karikaturen durch (HK6), im Rahmen der Bewer‐
Nichtregierungsorganisation ■ erörtern exemplarisch sowie andere tung der sonstigen
□ Going global: Analyse en (SK5), die gegenwärtige und Medienprodukte) aus ■ nehmen in Mitarbeit durch min‐
aktueller internationaler ■ analysieren aktuelle zukünftige Gestaltung sozialwissenschaftlichen diskursiven, destens eine Analyse
Handels‐ und internationale Handels‐ und von politischen, Perspektiven (MK4), simulativen und realen oder eine schriftliche
Finanzbeziehungen im Finanzbeziehungen im ökonomischen und ■ ermitteln in themen‐ und sozialwissenschaftl. Übung
Hinblick auf grundlegende Hinblick auf grundlegende gesellschaftlichen aspektgeleiteter Aushandlungsszenarie
Abläufe, Akteure und Erscheinungsformen, nationalen und Untersuchung die Position n
Einflussfaktoren Abläufe, Akteure und supranationalen und Argumentation einen Standpunkt ein
Einflussfaktoren, Strukturen und sozialwissenschaftlich und vertreten eigene Inhaltlich‐methodische
Prozessen unter relevanter Texte Interessen in Absprachen:
□ Wer gestaltet die Kriterien der Effizienz (Textthema, Abwägung
■ stellen Anspruch und und Legitimität (UK6), Thesen/Behauptungen, mit den Interessen ‐ soweit möglich sollen
ökonomische
Globalisierung?
Wirklichkeit von ■ ermitteln in Begründungen, dabei anderer (HK4), modellartige u. realeSie können auch lesen